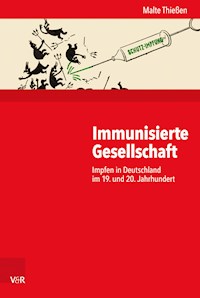Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Corona ist die sozialste aller Krankheiten. Sie betrifft alle Menschen weltweit und sämtliche Bereiche unseres Zusammenlebens – allerdings in ganz unterschiedlichem Ausmaß. Malte Thießen macht sich auf eine historische Spurensuche nach den sozialen Voraussetzungen und Folgen der Pandemie, die seit dem Frühjahr 2020 unser Leben beherrscht. Von den Pocken über die Spanische Grippe bis hin zu Aids, Ebola und Schweinegrippe entwirft er ein Panorama der Seuchen, die die Welt im 20. Jahrhundert heimsuchten, und gibt Antworten auf die Frage, was die Coronapandemie so besonders macht. Dabei geht es nicht nur um Gesundheit und Krankheit, sondern genauso um die Grundsätze unserer Gesellschaft: Wer ist besonders schützenswert, wer eine besondere Bedrohung? Wie ist das Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit, zwischen Zwang und Freiwilligkeit, zwischen uns und den anderen? Das Buch präsentiert damit eine Bestandsaufnahme unserer Gegenwart im Zeitalter der »Neuen Seuchen«: Ist Corona eine Zeitenwende? •Erste historische Gesamtdarstellung der Corona-Pandemie •Interdisziplinärer Blick auf Covid-19 als geistes-, sozial-, kultur-, medien- und gesundheitswissenschaftliches Phänomen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Malte Thießen
Auf Abstand
Eine Gesellschaftsgeschichte der Coronapandemie
Campus Verlag Frankfurt / New York
Über das Buch
Corona ist die sozialste aller Krankheiten. Sie betrifft alle Menschen weltweit und sämtliche Bereiche unseres Zusammenlebens – allerdings in ganz unterschiedlichem Ausmaß. Malte Thießen macht sich auf eine historische Spurensuche nach den sozialen Voraussetzungen und Folgen der Pandemie, die seit dem Frühjahr 2020 unser Leben beherrscht. Von den Pocken über die Spanische Grippe bis hin zu Aids, Ebola und Schweinegrippe entwirft er ein Panorama der Seuchen, die die Welt im 20. Jahrhundert heimsuchten, und gibt Antworten auf die Frage, was die Coronapandemie so besonders macht. Dabei geht es nicht nur um Gesundheit und Krankheit, sondern genauso um die Grundsätze unserer Gesellschaft: Wer ist besonders schützenswert, wer eine besondere Bedrohung? Wie ist das Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit, zwischen Zwang und Freiwilligkeit, zwischen uns und den anderen? Das Buch präsentiert damit eine Bestandsaufnahme unserer Gegenwart im Zeitalter der »Neuen Seuchen«: Ist Corona eine Zeitenwende? • Erste historische Gesamtdarstellung der Corona-Pandemie • Interdisziplinärer Blick auf Covid-19 als geistes-, sozial-, kultur-, medien- und gesundheitswissenschaftliches Phänomen
Vita
Malte Thießen leitet das LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte in Münster und lehrt als außerplanmäßiger Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
Inhalt
Geschichte in Echtzeit schreiben
1.Anfänge: Warum waren wir nicht gewarnt?
Wertloses Seuchenwissen
Die Seuche der Anderen
Immunität: Trügerische Sicherheit
Aktionismus und Gelassenheit
2.Ausbrüche und Ausgrenzungen: Bedrohungswahrnehmungen
Stereotype, Stigmata und Sündenböcke
Skifahrer:innen, Gütersloher:innen und Corona-Partys
Vom Makel zur Modellregion: Heinsberg
Corona und Zombies: Wendepunkt Bergamo
Kränkung und Kontrollverlust
3.Achtsamkeit: Wandel von Risikovorstellungen
Zwei Welten
Probleme mit Kollateralschäden
Vom Eigennutz zur Achtsamkeit
4.Abschottung: Nationale Alleingänge und internationale Konkurrenz
Ländervergleiche als Leistungstest
Vergessene globale Kooperationen
Grenzziehungen gegen den Kontrollverlust
5.Aushandlungen des Ausnahmezustands: Solidarität, Sicherheit oder Freiheit?
Ausnahmezustände als Argument
»Vermummungsgebot« und Gesichtsverluste
Lockdown I: Geld oder Leben
Lockdown II: Starker Staat und Systemfragen
Wer regiert? Wissenschaft und Politik
6.Abstiege: Soziale Ungleichheit
Gegenwart und Gefahren des Totentanzes
Prekariat und Privilegien
Systemrelevante Verliererinnen
Unsolidarische Solidaritätsappelle
Abgesänge auf den Totentanz
7.Ablehnung: »Querdenken« und Protestieren
Gesundheit als Weltanschauung
Bunt bis braun: Quellen der »Querdenker«
Bunt zu braun: Radikalisierung
8.Alltag: In der neuen Normalität
Social Distancing als Körperwandler
Sozialkompetenz als Infektionsrisiko
Kontaktlose Kommunikation
Social Distancing als Raumwandler
9.Auswege: Impfungen als Heilsversprechen
Impfgeschichte als Relativitätstheorie
Verteilungskämpfe
Impfrennen und Impfnationalismus
Nationaler Eigennutz und internationale Solidarität
10.Ausblick: Was bleibt?
Dokumentationslust und Erinnerungskultur
Große und kleine Dinge
Weltweite Verletzlichkeit
Leben in der Verantwortungsgemeinschaft
Dank
Literaturverzeichnis
Geschichte in Echtzeit schreiben
Es ist ein herrlicher Sommertag. Vom Rhein weht ein Luftzug Gitarrenklänge, Gesprächsfetzen und Grillgeruch durch den Park. Man könnte die Pandemie glatt vergessen. Nichts scheint diesem Sommeridyll ferner als der unsichtbare Tod. Dabei ist die Bedrohung sehr sichtbar. Auf dem Rasen markieren 190 weiße Kreise das Abstandsgebot. Die Distanz zwischen den Kreisen beträgt drei Meter, so dass Spazierengehende in gebotener Entfernung durch den Rheinpark flanieren können. Auf ihren kreisförmigen Inseln kommen Menschen zu zweit oder in kleinen Gruppen zusammen und halten Abstand. So sitzen sie kontaktlos in der neuen Normalität.
Wie an diesem schönen Julitag 2020 in Düsseldorf ordneten Menschen auf der ganzen Welt ihren Nahbereich neu. »Auf Abstand« avancierte zum Leitmotiv, das für gut eineinhalb Jahre alles und jeden bestimmte – die große Politik ebenso wie den kleinen Alltag, unsere Freizeit genauso wie unsere Arbeit, unsere Kommunikation und unseren Konsum. »Auf Abstand« blieb selbst Monate später das Leitmotiv, als Impfprogramme eine effektive Eindämmung der Pandemie erlaubten. Noch in einer anderen Hinsicht avancierte der Abstand zum Leitmotiv. Er verweist auf gesellschaftliche Spannungen, die während der Pandemie sichtbar wurden. Maßnahmen zur Eindämmung verschärften Gegensätze – zwischen Arm und Reich, zwischen Frauen und Männern, zwischen uns und »den Anderen« – sowie Konflikte zwischen gesellschaftlichen Gruppen und Parteien. In der Familie und im Freundeskreis gingen Menschen auf Distanz zueinander. Unterschiedliche Ansichten zur Pandemie mitsamt ihren Ursachen und Folgen richteten das Miteinander neu aus. Und nicht zuletzt steht der Abstand für ein neues Zeitgefühl. Der Lockdown riss uns aus dem gewohnten Leben und markierte den Beginn einer neuen Zeitrechnung: der Zeit vor und nach Corona.
Dieses Buch erzählt die Geschichten dieser Distanzierungen. Es macht sich auf eine Spurensuche durch die deutsche Gesellschaft und fragt nach Voraussetzungen, Wandlungen und Folgen der Pandemie. Nichts und niemand blieb zwischen Frühjahr 2020 und Sommer 2021 von Corona unberührt. Auf allen gesellschaftlichen Ebenen und Feldern richtete sich das soziale Koordinatensystem neu aus. Die Pandemie betraf selbst jene, die ihre Existenz leugneten. Denn auch die »Coronaleugner« und »Querdenker« waren eine Folge des Virus.
»Auf Abstand« ist keine Coronageschichte im engeren Sinne. Dieses Buch erzählt keine Geschichte virologischer Forschungen, sondern eine Gesellschaftsgeschichte der Pandemie in Deutschland. Selbstverständlich ließe sich die Geschichte einer weltweiten Bedrohung ebenso gut als Globalgeschichte schreiben.1 Allerdings verliert eine globale Perspektive schnell an gesellschaftlicher Tiefenschärfe, um die es in diesem Buch gehen soll. Denn in der Auseinandersetzung mit Corona ging es nie nur um Gesundheit und Krankheit, um Leben und Tod. Es ging ebenso um die Fundamente unserer Demokratie und um die Frage, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Deshalb erzähle ich die Pandemie nicht von der Medizin, sondern von den Menschen her. Meine Gesellschaftsgeschichte fragt nach sozialen Kontexten, Konflikten und Krisen, die sich während der Pandemie wie in einem Brennglas bündelten. So stritten Presse und Parlamente nicht nur über den Infektionsschutz, wenn das »Infektionsschutzgesetz« oder die »Nationale Impfstrategie« auf der Tagesordnung standen. Darüber hinaus kreisten solche Debatten um das Verhältnis zwischen Bund und Ländern, zwischen Exekutive und Legislative, ja um die Chancen und Schwächen der Parlamente im Angesicht einer Pandemie.
Die gesellschaftliche Dimension der Pandemie liegt also auf der Hand. Etwas komplizierter ist es mit der geschichtlichen Dimension. Denn wie soll das eigentlich gehen, eine Geschichte der Coronapandemie? Sind die Ereignisse nicht viel zu frisch für Geschichte? Lässt sich Geschichte in Echtzeit schreiben? Tatsächlich leiden Historiker:innen unter einem Gegenwartssyndrom. Je näher Ereignisse an unserer Gegenwart liegen, desto schwerer sind sie einzuordnen. Im Falle der Coronapandemie ist das Problem sogar noch größer. Denn wir reden über ein Ereignis, dessen Ende zurzeit nicht absehbar ist. Obgleich sich beim Abschluss des Buchmanuskripts Ende Juni 2021 zumindest ein vorläufiges »Happy End« der Pandemie abzeichnete, falls man das bei mehr als 90.000 Toten allein in Deutschland überhaupt sagen möchte, ist diese Geschichte noch lange nicht vorbei. Selbst wenn weitere Erkrankungswellen ausbleiben, werden uns die Nachwirkungen der Pandemie noch lange beschäftigen.
Das Problem der Gegenwartsnähe und Endlosigkeit des Ereignisses machte sich schon an jenen Studien bemerkbar, die im Laufe des Jahres 2020 erste historische Einblicke in die Coronageschichte boten.2 Die Halbwertszeit dieser Darstellungen war zwangsläufig gering. Heute lesen sich viele dieser Studien als Quellen, die Einblicke in »damalige« Vorstellungen von der Pandemie eröffnen und so einmal mehr vom Problem der Gegenwartsnähe künden. Einige dieser Darstellungen bringen uns heute ins Grübeln, andere fast schon zum Schmunzeln. Wegen der Gegenwartsnähe geht dieses Buch einen anderen Weg als bisherige Darstellungen. Es erzählt keine Seuchengeschichte der Moderne, die dann im letzten Kapitel fast schon folgerichtig mit der Coronapandemie endet. Vielmehr stellt das Buch Ereignisse und Entwicklungen der Jahre 2020/21 in den Mittelpunkt, um diese anhand von Rückblicken ins 19., 20. und 21. Jahrhundert einzuordnen. Im Mittelpunkt dieses Buches steht somit die Coronapandemie mit ihren historischen Wurzeln und Bezügen zur Seuchengeschichte der Moderne.
»Auf Abstand« ist also auch eine Perspektive dieses Buchs. Ich erzähle die Coronapandemie in ihrer historischen Dimension, um Distanz zur Gegenwart zu gewinnen. Bei diesem Abstand geht es nicht um eineinhalb Meter, sondern um Jahrzehnte, mitunter Jahrhunderte. Einige Kapitel werfen Schlaglichter auf die Pest, Pocken und Cholera, andere auf die Diphtherie und Polio, auf zahlreiche Grippezüge oder Aids. Erst die historische Dimension gibt Antworten auf die Frage, was Corona eigentlich so besonders macht, was aber auch relativ typisch für den Umgang mit Seuchen ist. Die historische Einordnung bietet somit Gelegenheit, auf Abstand zur Gegenwart zu gehen, um unsere Erlebnisse aus der Distanz zu betrachten, um aktuelle Debatten zu versachlichen, vielleicht aber auch, um ein wenig demütig zu werden. Denn in historischer Perspektive klingen aktuelle Entwicklungen mitunter erstaunlich bekannt bzw. erschreckend vertraut.
Selbstverständlich wird auch dieses Buch früher oder später an der Gegenwart scheitern. Bis kurz vor Manuskriptabgabe veränderten sich unsere Erfahrungen mit der Pandemie und damit meine Schwerpunktsetzungen der Kapitel. Die historische Einbettung der Gegenwart erhöht gleichwohl die Wahrscheinlichkeit, dass Befunde dieser Gesellschaftsgeschichte für einige Zeit von Belang sein werden. Obwohl sich unsere Gegenwart – und damit unsere Perspektive auf die Seuchengeschichte – immer wieder ändert, können wir die Wurzeln und historischen Bezüge der Coronapandemie auch in Zukunft immer wieder neu für eine Betrachtung der Jahre 2020/21 heranziehen.
Es ist also an der Zeit für eine Bilanz. Denn die Gegenwartsnähe birgt ja nicht nur große Probleme, sondern ebenso große Potenziale. Eines der größten Potenziale hängt mit dem digitalen Wandel unserer Gesellschaft zusammen. Jahrhundertelang schrieben Historiker:innen ihre Seuchengeschichten aus Akten und Archiven. Gesetze und Gutachten, behördliche Anordnungen und wissenschaftliche Aufsätze, Briefe, Bilder und Karikaturen bilden die Basis für bisherige Darstellungen zur Seuchengeschichte.3 Während der Coronapandemie war die Überlieferungslage eine vollkommen andere. Zahlreiche Quellen der Jahre 2020/21 sind noch digital verfügbar. Das gilt nicht nur für Printmedien, Parlamentsprotokolle und Gutachten, die meist ja auch gedruckt vorliegen und daher langfristig überliefert werden. Wichtiger ist der Befund einer digitalen Überlieferungssituation für unzählige Quellen zur Coronapandemie, die ausschließlich online vorliegen. Zahlreiche Stellungnahmen auf Internetseiten, Tweets auf Nachrichtendiensten, Bilder und Blogs, Flyer und Broschüren, Fotos und Programme von Veranstaltungen und vieles mehr wurden nur online veröffentlicht. Digitale Quellen eröffnen einerseits neue Einblicke in eine Pandemie. Denn einfacher als je zuvor können wir eine Pandemie aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Professionen, Parteien und einzelner Menschen betrachten. Andererseits sind ausgerechnet diese vielfältigen digitalen Einblicke in die Pandemie besonders bedroht. Seit langem diskutieren Historiker:innen und Archivar:innen über die Frage, wie sich das digitale Zeitalter langfristig sichern lässt.4 Obwohl zahlreiche Archive die Coronapandemie 2020 zum Anlass genommen haben, digitale Sammlungskonzepte zu formulieren, und obwohl Online-Portale wie das »Coronarchiv« eine breite Überlieferung privater Eindrücke ermöglichen, werden unzählige digitale Quellen in den kommenden Jahren verloren gehen.
Eine Bilanz ist heute also nicht nur möglich, sie ist wahrscheinlich auch besonders dringend. Wenn wir in Zukunft die Geschichte der Coronapandemie verstehen oder fortschreiben wollen, müssen wir jetzt damit anfangen. Bereits im Sommer 2021 gerieten Ereignisse aus der Frühzeit der Pandemie in Vergessenheit. Die Ausgrenzungen »asiatisch« aussehender Menschen, die Auseinandersetzungen um Hotspots wie Heinsberg, Ischgl oder Gütersloh und selbst die anfangs verbreiteten Ängste vor Bergamo spielten in der öffentlichen Debatte eineinhalb Jahre nach Ausbruch des Virus keine Rolle mehr. Mittlerweile blickten viele Deutsche nach vorn – und zwar mit guten Gründen. So setzten allmähliche Erfolge nationaler Impfprogramme endlich gemeinsame Planungen internationaler Präventionsprogramme auf die Tagesordnung. Das monatelang ersehnte Ende des Lockdowns wiederum verschob den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit von den Voraussetzungen der Pandemie auf ihre Folgen und mehr noch auf zukünftige soziale und wirtschaftliche Maßnahmen. Außerdem rangierten im Sommer 2021 wieder all die anderen Krisen auf der Tagesordnung, die von Corona monatelang in den Aufmerksamkeitsschatten gestellt worden waren. Klimawandel, Kriege und Antisemitismus standen in Hochzeiten der Pandemie allenfalls in der zweiten Reihe. Sie kamen im Sommer 2021 mit voller Kraft zurück, fast schon als ob es eine breite Sehnsucht gegeben habe, endlich nicht mehr nur von Viren zu reden.
Vielleicht kommt dieses Buch also doch zum genau richtigen Zeitpunkt. Denn eine Gesellschaftsgeschichte der Coronapandemie eröffnet uns nicht nur die Chance, den Wurzeln unserer Gegenwart nachzuspüren. Sie ist ebenso ein Appell, bei allen Planungen auf eine bessere Zukunft die Geschichte der Pandemien nicht zu vergessen, selbst wenn diese Geschichte mitunter noch allzu gegenwärtig erscheint.
1.Anfänge: Warum waren wir nicht gewarnt?
Es war eine unscheinbare Meldung. Am Silvestermorgen 2019 berichteten einige Zeitungen mit wenigen Zeilen von einer »mysteriösen Lungenkrankheit« im zentralchinesischen Wuhan. 27 Menschen seien erkrankt. Fortan verbreiteten sich Gerüchte über einen »neuen Ausbruch der Lungenseuche Sars«.5 Sars – das stand seit einigen Jahren als Symbol für jene »Neuen Seuchen«, die dank globaler Handels- und Verkehrswege innerhalb kurzer Zeit zur weltweiten Bedrohung mutierten. Beim Sars-Ausbruch Ende 2002 hatte das Virus aus China weltweit um die 8.000 Menschen infiziert. Fast jeder Zehnte war an der Krankheit gestorben.
Sars gab nur den Auftakt. In den Folgejahren sorgten Ausbrüche von »Vogelgrippe« und »Schweinegrippe«, Mers und Ebola für Schlagzeilen. Allein die Schweinegrippe schaffte es im Herbst 2009 innerhalb eines Monats zwölf Mal auf die Titelseite der »Bild«-Zeitung. Allen Gesundheitspolitiker:innen gaben die neuen Seuchen eine eindringliche Warnung. Unter dem Eindruck des Sars-Ausbruchs und der Anthrax-Briefe nach den Terroranschlägen vom 11. September wurden Ende 2005 sämtliche Gesundheitsbehörden aufgefordert, Vorkehrungen für den Pandemiefall zu treffen. Das Robert Koch-Institut bündelte diese Konzepte kurze Zeit später in einem »Nationalen Pandemieplan«, der Leitlinien für die Vorsorge und Eindämmung einer »gesundheitlichen Großschadenslage«6 festlegte.
Wertloses Seuchenwissen
Wir hätten also gewarnt sein können. Zu Beginn der Coronapandemie standen strategische Konzepte und praktische Erfahrungen mit Seuchenzügen bereit. Unser Vorwissen erscheint sogar noch größer, wenn wir in der Geschichte der Bundesrepublik einige Schritte zurückgehen. Denn der Nationale Pandemieplan des RKI war nicht das erste Konzept zur Eindämmung eines globalen Ausbruchs. Vielmehr planten Bundesinnenministerium, Bundesgesundheitsamt, Bundesverteidigungsministerium, Bundesamt für Katastrophenschutz und Robert Koch-Institut seit den 1950er Jahren fieberhaft für die Eindämmung des epidemiologischen Ernstfalls.
Es sollte nicht bei Planspielen bleiben. Mehrfach kamen seit Mitte der 1960er Jahre »Pockenalarmpläne« der Bundesländer zum Einsatz. Für den Fall einer Pockeneinschleppung warteten die Alarmpläne mit detaillierten Ausarbeitungen zu Meldewegen und Isolationsmaßnahmen, zum Aufbau von Quarantänestationen und Impfstellen auf.7 Ihren Praxistest absolvierten Pockenalarmpläne zuletzt 1972 – und zwar äußerst erfolgreich. Eine Einschleppung der Pocken nach Hannover konnte dank systematischer Rückverfolgungen der Infizierten sowie mit schnellen Quarantäne-, Impf- und Aufklärungsmaßnahmen umgehend eingedämmt werden.8 Nach Ausrottung der Pocken Ende der 1970er Jahre waren die Alarmpläne dennoch nicht vom Tisch. So blätterten Medizinalbeamte Anfang der 2000er Jahre plötzlich wieder hektisch in den Unterlagen, als Sorgen vor Terroranschlägen mit biologischen Kampfstoffen in der gesamten Republik Ängste schürten.
Erfahrungen im Seuchenkampf sammelten deutsche Ministerien und Forschungseinrichtungen zudem in der Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder später im European Center for Disease Control. Die an sich uralte Erkenntnis, dass Seuchen jegliche Grenze überwinden, sorgte in der Bundesrepublik ab Mitte der 1950er Jahre für einen gewaltigen Internationalisierungsschub und damit für neue Erkenntnisse im Seuchenkampf. Der Wissensdurst war so groß, dass er sogar den »Eisernen Vorhang« überwand. Seit den 1970er Jahren tauschten selbst die erbitterten »Systemgegner« Bundesrepublik und DDR ihre Erfahrungen bei der Seuchenbekämpfung aus. Das deutsch-deutsche Bewusstsein, dass man im Pandemiefall in einer »Verantwortungsgemeinschaft« steckte,9 war offenbar größer als Ängste vor einer sozialistischen bzw. kapitalistischen Unterwanderung.
Es war also eigentlich alles da: Wissen, Konzepte und Erfahrungen. Sowohl Notfallpläne von Bund und Ländern als auch medizinische Studien zur Häufung der neuen Seuchen lagen bereit. 2008 hatten vier Fraktionen des Bundestags in einem »Grünbuch des Zukunftsforums öffentliche Sicherheit« besorgniserregende Konsequenzen aus jüngeren Pandemien gezogen. Die Vertreter der Union, SPD, FDP und Grünen konstatierten nicht nur strukturelle Defizite wie eine schnelle Überlastung des Gesundheitswesens oder das Fehlen einer »einheitlichen überregionalen Notfallplanung« im Seuchenfall. Darüber hinaus beschrieb das Grünbuch Gesundheitsmaßnahmen, die damals noch apokalyptisch anmuten mochten, die aus heutiger Perspektive jedoch allenfalls visionär genannt werden können: »Die hochinfektiöse Variante des SARS-Virus würde einschneidende Maßnahmen verlangen: zum Beispiel die Seuchengebiete abriegeln, die Ansteckungsrate durch Mund-Nasen-Schutz mindern, Desinfektionsschleusen einrichten, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Bevölkerung durchsetzen.«10 Noch ein gutes halbes Jahre vor der Coronapandemie zitierte beispielsweise die Pharmazeutische Zeitung Sylvie Briand, Leiterin der WHO-Pandemieabteilung, mit einer ebenso nüchternen wie ernüchternden Bestandsaufnahme: »Denn eins ist klar: Es ist keine Frage ›ob‹, sondern ›wann‹ eine neue Pandemie kommt.«11
Trotzdem blieben die meisten Deutschen Anfang 2020 erstaunlich gelassen. Selbst das zunehmende Rauschen im bundesdeutschen Blätterwald änderte daran wenig. Ab Ende Januar berichteten Zeitungen über die Quarantäne chinesischer Millionenstädte, über Isolationsmaßnahmen und überfüllte Krankenhäuser. Am 30. Januar rief die WHO eine internationale Notlage aus, einen Monat später stufte die Weltgesundheitsorganisation die internationale Gefährdungslage bereits als sehr hoch ein. Ungeachtet dieser Anzeichen ging das Leben in Deutschland weiter wie bisher. Ende Februar 2020 stellte das Bundesgesundheitsministerium auf einer Pressekonferenz klar, dass die Deutschen nichts zu befürchten hätten: »Gegenwärtig gibt es keine Hinweise für eine anhaltende Viruszirkulation in Deutschland, sodass die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland aktuell weiterhin gering bleibt.«12 Ein gewisser Pragmatismus gegenüber der Pandemie kennzeichneten die ersten beiden Monate des Jahres 2020.
Im Rückblick ist dieser Pragmatismus erstaunlich oder schlimmer: Der Historiker Mark Honigsbaum hat gar von einem »kollektiven Versagen« gesprochen.13 Warum waren wir nicht gewarnt? Was waren die Hintergründe für die anfängliche Gelassenheit? Warum war all das jahrzehntelang gesammelte Seuchenwissen offenbar wertlos für Presse und Parlamente? Ordnet man die Coronapandemie in die Seuchengeschichte der Moderne ein, gibt es auf diese Fragen zwei Antworten: Immunität und Othering.
Die Seuche der Anderen
Die Seuche, das sind immer die Anderen: Auf diese knappe Formel lässt sich der Umgang mit Infektionskrankheiten in historischer Perspektive bringen. Denn die Wahrnehmung von Seuchen ist seit jeher geprägt von Fremdzuschreibungen, die sich bis in die Namensgebung niederschlagen. Die Syphilis beispielsweise hieß schon im 15. Jahrhundert »Franzosenkrankheit«. In Deutschland verband sich diese nationale Zuschreibung seit dem 19. Jahrhundert zudem aufs Beste mit der Wahrnehmung als »Lustseuche«.14 Geografische und moralische Zuschreibungen gingen hier also Hand in Hand, entsprach die Geschlechtskrankheit doch dem deutschen Stereotyp vom unsittlichen Frankreich. Das bekannteste Beispiel für nationale Zuschreibungen ist heute wohl die Spanische Grippe. Spanisch wurde die Grippe zunächst einmal nur wegen der relativ frühen und ausführlichen Berichterstattung. Im Gegensatz zu anderen Gazetten Europas standen spanische Zeitungen nicht unter der Militärzensur. Allerdings entsprach die »Spanische Grippe« eben auch zeitgenössischen Vorstellungen vom geheimnisvollen, barbarischen Spanien. Im Bild von der »Spanischen Lady« verdichteten sich solche Fremdzuschreibungen zur perfekten Projektionsfläche für Ängste vor dem unbarmherzigen Seuchentod.15
Sozialwissenschaftler:innen haben für solche Fremdzuschreibungen den Begriff des Othering geprägt. Dabei geht es um die Beobachtung, dass insbesondere neue, unbekannte Bedrohungen auf »Fremde« und »die Anderen« projiziert werden.16 Dank ethnischer, moralischer, religiöser oder habitueller Zuschreibungen mutieren Seuchen demnach häufig zu Krankheiten »der Anderen«. Corona schreibt zur Geschichte des Otherings ein Kapitel fort, das die Deutschen im 19. Jahrhundert aufschlugen. Seit dieser Zeit fanden deutsche Seuchenängste ihre größte Projektionsfläche »im Osten«. Die Russische Grippe von 1889/90 mochte ihren Ursprung zwar tatsächlich in Russland haben. In die Schlagzeilen fand sie allerdings bevorzugt mit stereotypen Zuschreibungen vom rückständigen Osten.17 Dass solche Fremdzuschreibungen in Deutschland besonders gut verfingen, überrascht nicht. Auch im Ersten Weltkrieg galten militärische Operationen im Osten als medizinische Feldzüge zur Sanierung schmutziger »Seuchenherde«, wie Polen und Russland von deutschen Medizinalbeamten gern umschrieben wurden.18 Deutsche Impfprogramme bekämpften in dieser Vorstellung nicht nur medizinische Missstände der »russischen Herrschaft« oder der russischen »Volksseele«. Der Seuchenkampf in Osteuropa stellte zugleich den Leistungen des deutschen »Kulturvolkes« ein vorbildliches Zeugnis aus.19 Im »Dritten Reich« steigerten sich solche Selbst- und Fremdzuschreibungen in eine Gigantomanie des Grauens. Auch dank stereotyper Seuchenvorstellungen gingen Holocaust und Vernichtungskrieg eine furchtbare Verbindung ein. Zeitgenössische Fremdzuschreibungen wie das »antisemitische Stereotyp des bärtigen ›Ostjuden‹« bündelten sich in Bildern von gefährlichen »Seuchenträgern«, die zum Schutze des deutschen »Volkskörpers« immunisiert oder gar »ausgemerzt« werden sollten.20
Mit Ausrottungsphantasien war es in Deutschland nach 1945 zwar vorbei. Allerdings klang »der Osten« als Grundakkord für deutsche Seuchenängste noch lange nach. Stereotype vom rückständigen, unhygienischen »Russen« oder »Chinesen« waren auch in der Bundesrepublik denk- und sagbar, ja mehr noch: Im Kalten Krieg erhielten Fremdbilder vom bedrohlichen Osten neue Nahrung. Dass die »Hongkong-Grippe« in Westdeutschland Ende der 1960er Jahre schon mal als »Mao-Grippe« verunglimpft wurde, die sich in die Bundesrepublik »einschleiche«, gibt für die anhaltende Attraktivität östlicher Seuchenzuschreibungen nur ein Beispiel von vielen.21 Und noch nach der Jahrtausendwende waren die Deutschen während der Ausbrüche von Sars und Vogelgrippe mit Fremdzuschreibungen vom »Fernen Osten« schnell zur Hand.
Othering wird häufig als Erklärung für soziale Exklusionsprozesse herangezogen. Tatsächlich brachte die Coronapandemie zahlreiche Fälle brutaler Ausgrenzungen der »Anderen« auch in Deutschland zutage, auf die ich im nächsten Kapitel zurückkomme. Zur Beantwortung unserer Ausgangsfrage ist allerdings ein weiterer Effekt des Otherings von Bedeutung, der bislang sehr viel seltener betrachtet worden ist. Fremdzuschreibungen bündeln und verstärken nicht nur Ängste. Sie können uns ebenso Ängste nehmen und damit in falscher Sicherheit wiegen. Denn Fremdzuschreibungen führen zu einer Exotisierung der Bedrohung – und damit zu einer Ausgrenzung auch im geografischen Sinne, als Auslagerung von Ängsten aus unserer Lebenswelt. Insbesondere die verbreitete Betrachtung von Seuchen als Ausdruck von Rückständigkeit machte Seuchen in der Wahrnehmung vieler Deutscher zu einem Problem der Anderen, das wenig mit uns zu tun zu haben schien.
Corona demonstrierte diesen Effekt der Auslagerung geradezu vorbildlich, wie ein Blick in die frühe Berichterstattung offenbart. Gerade in den ersten Wochen waren die Zeitungen voll von Exotik. Insbesondere im Boulevard ging es um graue Großstadtsilos und schmutzige Märkte, vor allem aber um Schlangen, Hunde und Fledermäuse auf chinesischen Speisekarten. Dass das Coronavirus wahrscheinlich von Fledermäusen auf Menschen übergesprungen war, bekräftigte Stereotype vom rückständigen, schmutzigen Chinesen, wie sie die »Bild«-Zeitung in gewohnter Manier vorführte: »Futtert uns China in die Katastrophe?«, fragte das Blatt besorgt und beschrieb anschließend ekelerregende Szenen auf »gefährlichen Wildtiermärkten«.22 Das Fremdbild vom exotischen »Chinesen« bildete einen besonders krassen Kontrast zum deutschen Selbstbild, das sich aus einer großen Selbstsicherheit speiste. Altertümliche, geradezu abstoßende Essenspraktiken erklärten demnach den Ausbruch einer Pandemie, die so gar nicht zum »zivilisierten«, »hygienischen« und »fortschrittlichen« Leben in Deutschland passen wollte. Auch die Lebensbedingungen in Wuhan schienen entsprechende Erklärungen zu bieten: In dem Millionen-Moloch mit seinen engen Wohnungen und unhygienischen Arbeitsbedingungen lag die Ausbreitung des Virus ja quasi auf der Hand.
Am Anfang war Corona also die Seuche der Anderen mit ihren exotischen Lebensverhältnissen im fernen Osten. Die Pandemie schien nichts mit uns zu tun zu haben und daher auch keine große Bedrohung zu sein. Ende Januar 2020, da war die Krankheit bereits in sieben Länder eingeschleppt worden, verstand das Wochenmagazin Der Spiegel Corona allein als Herausforderung für China: »Die drohende Pandemie fordert nicht nur Chinas Gesundheitswesen, sondern auch seine Politik und Wirtschaft heraus.«23 Eine Woche später machte das Magazin erstmals mit einem Corona-Titel »Made in China« auf, der heute in zahlreichen Studien als Ikone für die frühe Wahrnehmung der Deutschen herhält. Tatsächlich schien die Pandemie in diesem Titelbericht vor allem ein Problem Chinas zu sein, dessen Krisenlösungskompetenz über das Wohl und Wehe der Weltwirtschaft entscheide. In dasselbe Horn stieß in der Titelstory der Virologe Christian Drosten, der fortan die Berichterstattung prägen sollte wie kein anderer: »In Wuhan, wo alles begann und wo die Erkrankungs- und Todeszahlen nun von Tag zu Tag steigen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen, ob das neue Virus aufgehalten werden kann.«24 Letztlich verminderte Othering zu Beginn der Pandemie also den Handlungsdruck, da sich Corona als Problem der Anderen verstehen und letztlich aus unserer Lebenswelt auslagern ließ.
Immunität: Trügerische Sicherheit
Für eine anfängliche Arglosigkeit gegenüber der Pandemie findet sich noch eine zweite Erklärung und damit eine weitere Antwort auf die Frage, warum wir Anfang 2020 nicht gewarnt waren. Sie lautet Immunität. Die Geschichte der Moderne ist eine Geschichte des Impfens. Seit dem 19. Jahrhundert setzten sich auf der ganzen Welt systematische Impfprogramme durch, wie wir sie heute kennen. Den Auftakt gab die Pockenimpfung durch den britischen Arzt Edward Jenner 1796. In Bayern und Hessen wurde sie bereits Anfang des 19. Jahrhunderts als Pflichtimpfung eingeführt, für das gesamte Deutsche Reich galt eine Impfpflicht seit 1874. Seit den 1930er Jahren folgten Impfkampagnen gegen Diphtherie, Scharlach sowie Tetanus. In der Bundesrepublik und DDR wiederum flankierten zunächst Impfungen gegen Polio, Tuberkulose, Keuchhusten und Grippe das deutsch-deutsche Gesundheitswesen, ab den 1970er Jahren kamen Mehrfachimpfstoffe hinzu, die die Herdenimmunität noch einmal deutlich erhöhten.
Waren Infektionskrankheiten für unsere Eltern und Großeltern noch allgegenwärtig, ging diese Erfahrung im Laufe der Jahrzehnte verloren. Der Bedeutungswandel der »Kinderkrankheiten« steht dafür als Sinnbild. Denn lange Zeit meinte das Wort keineswegs jene Verniedlichungsform, die wir heute kennen. Kinderkrankheiten waren vielmehr Ausdruck einer Alltäglichkeit von »Volksseuchen«, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein für eine hohe Kindersterblichkeit sorgten. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts waren Pockennarben im Alltag der Deutschen omnipräsent, der charakteristische Tuberkulosebuckel hielt sich noch einige Jahrzehnte länger, genauso wie die charakteristischen Sprachprobleme und häufigen Taubheitsfälle nach Diphtherieerkrankungen. Auch die Behinderungen von Armen und Beinen als Folge der Kinderlähmung blieben lange Zeit ein bekanntes Bild auf deutschen Straßen.
Erst die Durchsetzung systematischer Impfprogramme und der Masseneinsatz von Antibiotika seit den 1970er Jahren drängten diese Bedrohungen allmählich aus dem Alltag. Heute ist Immunität zumindest in Deutschland Normalität und eine Selbstverständlichkeit, ja eine Art Lebensgefühl geworden. Der Umstand, dass man gegen Infektionskrankheiten nicht geimpft werden kann oder beim Ausbruch neuer Seuchen nicht umgehend Impfstoffe bereitstehen, ist seither schwer vorstellbar. Der Ausbruch von Aids in den 1980er Jahren unterstreicht diese Vorstellung noch. Denn die Suche nach einem Impfstoff begleitete den Umgang mit der Immunschwächekrankheit von Anfang an. Immer wieder schien die Impfung kurz vor der Marktreife zu stehen, immer wieder »kam Hoffnung auf«,25 schien das »Licht am Ende des Tunnels«26 endlich sichtbar, bis die Aufmerksamkeit für Aids dank effektiver Therapeutika in Deutschland zurückging.27
Ausgerechnet die Erfolgsgeschichte der Medizin bietet also eine weitere Erklärung auf die Ausgangsfrage, warum wir nicht gewarnt waren. Im Zeitalter der Immunität verschwanden Pandemien allmählich aus unserem Erfahrungshorizont. Seit den 1970er Jahren verloren die Deutschen sukzessive die Angst vor dem »unsichtbaren Tod«, Immunität avancierte nun zu einem selbstverständlichen Sicherheitsgefühl. Mitte Februar 2020 warnte der Virologie Tom Frieden, ehemaliger Leiter des US-amerikanischen Center for Disease Control (CDC), vor den fatalen Folgen des Fortschrittglaubens: »Wir sollten uns nicht in falscher Sicherheit wiegen.«28 Zu diesem Zeitpunkt waren solche Stimmen noch die Ausnahme. Paradoxerweise hatten Erfolge im Kampf gegen eine Vorläuferin von Corona, die Sars-Epidemie 2002, am trügerischen Sicherheitsgefühl einen erheblichen Anteil. Schließlich drängten sich die Parallelen zwischen Sars und Corona geradezu auf. Auch 2002 hatte das Epizentrum wahrscheinlich auf einem Markt in China gelegen, damals in der bevölkerungsreichsten Provinz Guangdong. Und trotz der globalen Dimension und einer sehr zurückhaltenden Informationspolitik Chinas war es damals insbesondere dank global koordinierter Maßnahmen relativ schnell gelungen, die Pandemie vor ihrer »Take-off«-Phase zu beenden.
Immunität hielt das Aufmerksamkeitsfenster für Corona also zunächst geschlossen. Selbst einige Wochen später, während des Anstiegs der Infektions- und Todeszahlen, stand Immunität noch als Sicherheitsgarantie vor aller Augen. So war Angela Merkels berühmte »Corona-Rede«, eine Fernsehansprache am 18. März 2020 mit mehr als 25 Millionen Zuschauern, durchzogen vom Heilsversprechen einer Corona-Impfung. Obgleich der Stand der Impfstoffentwicklung zu diesem Zeitpunkt noch vollkommen unklar war, bildete Immunität für die Bundeskanzlerin bereits eine Planungsgröße, an der sich alle Präventionsmaßnahmen ausrichteten, zumindest aber ein öffentlichkeitswirksames Beruhigungsmittel. Merkel ging es mit der Einführung von Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln schließlich insbesondere darum, »Zeit zu gewinnen. Zeit, damit die Forschung ein Medikament und einen Impfstoff entwickeln kann.«29
Beim Ausbruch der Pandemie wurden die Deutschen letztlich also Opfer ihrer medizinischen Erfolge. Gerade weil Mediziner:innen seit Jahrzehnten auf eine beachtliche Bandbreite effektiver Gesundheitsmaßnahmen zurückgreifen können, gerade weil Impfungen und Vorsorgemaßnahmen in unseren Alltag mittlerweile als selbstverständliches Sicherheitsversprechen eingeschrieben sind, war die Coronapandemie zunächst nicht nur geografisch, sondern auch mental weit weg. Seuchen waren in der Vorstellung vieler Deutscher nicht nur ein Problem der Anderen, sondern zugleich ein Relikt grauer Vorzeiten, das nichts mit unserem Leben zu tun hatte.
Aktionismus und Gelassenheit
Warum also waren wir nicht gewarnt? Für eine frühe Alarmbereitschaft fehlte es nicht an Wissen und Konzepten. Vielmehr mangelte es am Bewusstsein, dass die Seuche der Anderen schnell zu unserer Seuche mutieren konnte. Im Zeitalter der Immunität blieb der Handlungsdruck zunächst gering. Vertreter:innen wichtiger Interessengruppen aus medizinischen Forschungseinrichtungen, Ärztekammern und Verbänden stießen in den ersten Wochen kaum auf Gehör oder schätzten die Situation selbst als nicht besonders bedrohlich ein. Ende Januar brachte der Spiegel die beruhigende Lage für Deutschland anhand von Expertenstimmen auf den Punkt: »Das Robert Koch-Institut hält die Gefahr für Deutschland weiterhin für gering; andere Experten erwarten einzelne Fälle, sehen jedoch keinen Grund zur Beunruhigung.«30 Bundesgesundheitsminister Jens Spahn propagierte angesichts der geringen Erkrankungszahlen eine Haltung der »aufmerksamen Gelassenheit«,31 die er sich von allen Bundesbürger:innen wünsche. Noch Mitte März bewertete das RKI in seinem täglich erscheinenden »COVID-19-Lagebericht« die Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung als »mäßig«.32
Eine »aufmerksame Gelassenheit« speiste sich wohl nicht zuletzt aus den Erfahrungen mit der Schweinegrippe im Herbst 2009. Seit Aids war keine Pandemie deutschen Gesundheitspolitiker:innen so nahe gegangen. Auf die Titelseiten wanderte die Schweinegrippe nämlich nicht nur wegen Horrorzahlen wie den zu erwartenden »35.000 Toten«, die von der »Bild«-Zeitung unters Volk gebracht wurden.33 Ebenso grelle Schlagzeilen konnte man im späteren Verlauf der Schweinegrippe lesen. Innerhalb weniger Monate war ein Impfstoff gegen die Grippe gefunden und zur Massenproduktion gelangt. Allein in Deutschland bevorrateten sich die Bundesländer mit zig Millionen Impfstoffdosen. Am Ende kam es aber noch besser – oder eben noch schlimmer. Wegen des milden Verlaufs der Schweinegrippe waren die Millionen an Impfstoffdosen weitgehend unnötig. Die Bundesländer blieben auf ihren teuren Einkäufen sitzen und mussten sich wochenlang hämische Kommentare anhören, dass sie einer Hysterie aufgesessen seien. Dass Zeitungen und Magazine wie der Spiegel in ihrer anschließenden Bilanz von »teurer Panikmache«34 sprachen und die »Chronik einer Hysterie«35 im Detail nachzeichneten, spricht indes für mangelndes Erinnerungsvermögen. Schließlich dürfte der Spiegel mit Titelgeschichten über »Das Weltvirus« und den »Angriff aus dem Schattenreich«36 zur Schweinegrippen-Hysterie selbst seinen Teil beigetragen haben.
Die Enttäuschung über entbehrliche Impfstoffreserven saß in den Bundesländern so tief, dass diese Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) aufforderten, die Millionenkosten für Impfstoffe zu übernehmen, und sogar eine Neuordnung der Seuchenbekämpfung ins Spiel brachten. Angesichts der Erfahrungen mit dem Impfstoffdebakel wolle man »die Verantwortung für die Pandemiebekämpfung« zukünftig an den Bund abgeben.37 In der aufmerksamen Gelassenheit von 2020 hallten letztlich also auch noch die Erfahrungen von 2009 nach. Der »Alarmismus« um die Schweinegrippe machte allen Gesundheitspolitiker:innen den hohen Schädigungsfaktor einer übertriebenen Seuchenbekämpfung schmerzlich bewusst. Im Frühjahr 2020 galt manchem Verantwortlichen wohl nicht allein die Pandemie als Gefahr, sondern ebenso eine voreilige Pandemiebekämpfung, die schnell als teurer Aktionismus gebrandmarkt werden konnte.
Im Nachhinein ist man immer klüger. Und bevor jetzt der Eindruck entsteht, ich würde es mir in der Retrospektive zu einfach machen, möchte ich von einem Interview im Südwestdeutschen Rundfunk Ende Januar 2020 erzählen. An diesem Tag durfte ich gemeinsam mit ARD-Chinakorrespondent Steffen Wurzel und Volker Wildermuth, Wissenschaftsjournalist und Biochemiker, über die Frage »Was schützt vor der Corona-Pandemie?« nachdenken. Meine damalige Einschätzung kann man als ziemlich gelassen, vielleicht sogar als ziemlich naiv beschreiben. Eine im Vergleich zu früheren Pandemien transparentere Kommunikation Chinas, ein intensiverer internationaler Austausch sowie eine »Versachlichung der Debatte« zeigten meinem damaligen Ausblick nach nämlich, dass wir aus der Geschichte gelernt hätten. Historiker:innen sind also nicht nur miese Prognostiker. Sie sind ebenso Kinder ihrer Zeit wie Expert:innen aus Gesundheitspolitik, Medizin und Medien.
Anfang 2020 war der deutsche Blick auf Corona also gerahmt vom Lebensgefühl der Immunität und von der Gewissheit um ein funktionierendes Gesundheitswesen, von »westlichen« Standards sowie vom guten Gefühl, dass es in der jüngeren Vergangenheit letztlich immer noch mal gut gegangen war. In einem der ersten Rückblicke auf den Beginn der Pandemie brachte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das trügerische Sicherheitsgefühl gut auf den Punkt: »Vielleicht haben wir zu lange geglaubt, dass wir unverwundbar sind, dass es immer nur schneller, höher, weiter geht. Das war ein Irrtum.«38 Auch deshalb haben Pandemien der Gegenwart viel mit der Vergangenheit vergangener Jahrhunderte zu tun. Weil wir im Zeitalter der Immunität leben und unsere Seuchenängste auf einen ebenso fernen wie fremden Osten projizieren konnten, blieb unser Aufmerksamkeitsfenster am Anfang geschlossen. Nach den jüngeren Erfahrungen mit der Schweinegrippe schien zudem ein voreiliger Alarmismus eine ebenso große Gefahr zu sein wie die Pandemie selbst. Die ebenso triviale wie uralte Erkenntnis, dass Seuchen mühelos jede Grenze überwinden, sickerte in der öffentlichen Debatte daher nur langsam durch. Und so rutschten wir zunächst mit erstaunlicher Gelassenheit in die große Krise.
2.Ausbrüche und Ausgrenzungen: Bedrohungswahrnehmungen
Mit der Ruhe war es Mitte Februar vorbei. Seither nahmen Coronafälle auch in Deutschland zu. Die erste Infektion eines 33-jährigen Mannes in Bayern am 27. Januar hatte zunächst noch ein Vorbild für eine effektive Seuchenbekämpfung gegeben. Der Mitarbeiter des Unternehmens Webasto hatte sich bei einer chinesischen Geschäftspartnerin angesteckt. Schnell waren im Unternehmen sämtliche Infektionsketten identifiziert sowie potenzielle Kontaktpersonen isoliert worden, so dass der behandelnde Chefarzt Clemens Wendtner am 22. Februar zum Fall Webasto ein beruhigendes Schlusswort sprach: »Ich gehe derzeit nicht von einer größeren Coronawelle hierzulande aus.«39
Stereotype, Stigmata und Sündenböcke
Ganz und gar nicht beruhigt waren zu dieser Zeit Menschen mit »ausländischem« Aussehen. Insbesondere Deutsche mit asiatischen Wurzeln erlebten seit Mitte Februar vermehrt Demütigungen und Anfeindungen. Besorgniserregende Berichte häuften sich auf dem Nachrichtendienst Twitter unter dem Hashtag »#ichbinkeinvirus«. Ende Februar schilderte beispielsweise eine asiatisch aussehende Deutsche folgende Szene an einer Sicherheitskontrolle im Frankfurter Flughafen. Ein Mitarbeiter habe dort ihre Abfertigung mit deutlichen Worten abgelehnt: »Mit Coronavirus muss ich mich nicht abgeben.« Einen Tag später berichtete Thea Suh von einem ähnlichen Erlebnis im Feierabendverkehr: »Zu früh auf den Feierabend gefreut. Bin in der Bahn von einer Frau angeblafft worden, ich solle meinen Corona-Körper woanders hinsetzen. Habe Sie angehustet und bin zu früh ausgestiegen. Aber was soll man tun, wenn NIEMAND im vollen Wagen hilft?«40 Eine weitere Betroffene, die Bloggerin Minh Thu Tran, ordnete solche Stigmatisierungen in eine unheilvolle Tradition deutscher Ausgrenzungen ein. In der Wochenzeitung Die Zeit zog sie lange Linien von kolonialen Stereotypen bis zu den Ausgrenzungen vietnamesischer Menschen in der DDR. Corona sei indes der traurige Höhepunkt rassistischer Anfeindungen: »So offenen Rassismus auf der Straße wie in Corona-Zeiten, die Dimension und auch die Feindseligkeit, habe ich aber noch nie erlebt.«41
Alltägliche Anfeindungen offenbaren eine weitere Seite des Otherings, die in der Anfangsphase der Pandemie immer offener zu Tage trat. Hatten Fremdbilder zunächst noch dazu verleitet, Corona als Problem »der Anderen« abzutun, sorgten sie nun für Stigmatisierungen im Alltag. Die »Anderen« standen nun als Sündenböcke hoch im Kurs. Ein Paradebeispiel für das fatale Zusammenspiel von Othering und Sündenböcken bietet der Tweet des CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Stein Mitte März: »Ich wünschte mir, dass bestimmte Volksgruppen mal aufhören #Fledermäuse, #Gürteltiere, #Affenschädel und anderen Scheiß zu essen. Das war bei #SARS schon so und bei #Ebola und jetzt wieder …«42 Um die Anklage ganz unmissverständlich zu machen, zierte Steins Tweet am Ende ein Emotionssymbol mit zwei chinesischen Essstäbchen.
Derartige Anfeindungen und Ausgrenzungen waren keine deutsche Spezialität. Unter dem Hasthag »#JeNeSuisPasUnVirus« hatte das Phänomen beispielsweise in Frankreich bereits für Aufsehen gesorgt. In Frankreich ließen sich auch besonders drastische Ausbrüche im Alltag beobachten wie an einem japanischen Restaurant, dessen Fenster in großen Lettern mit »Coronavirus« beschmiert worden war. Vor allem aber waren alltägliche Anfeindungen kein Novum, im Gegenteil. Die Seuchengeschichte ist von Anfang eine Geschichte der Ausgrenzung gewesen, die sich auf eine weitere knappe Formel bringen lässt: Seuchen machen Sündenböcke. Bis heute gelten die Pestpogrome des 14. und 15. Jahrhunderts als trauriger Höhepunkt solcher Ausgrenzungen. Dass jüdische Bürger während der Pestzüge auch in Deutschland als Brunnenvergifter abgestempelt und als »Seuchenbringer« verfolgt wurden, gab daher in Medienberichten des Jahres 2020 ein warnendes Beispiel für die Gegenwart ab. Allerdings müssen wir in der Seuchengeschichte gar nicht so viele Jahrhunderte zurückgehen, um auf Sündenböcke und Stigmatisierungen zu treffen. Anfeindungen und Ausgrenzungen sind eben keine Spezialität eines »finsteren Mittelalters«. Gerade das 19. und das 20. Jahrhundert sind voll von Sündenböcken und für eine Einordnung der Coronapandemie ungleich relevanter. Drei solcher Fälle möchte ich im Folgenden skizzieren, um anschließend die alltäglichen Ausbrüche des Jahres 2020 klarer einordnen zu können.
Das erste Beispiel führt uns nach Berlin ins Jahr 1895. An einem grauen Novembermorgen konnten die Leser der Staatsbürger-Zeitung Folgendes über einen Pocken-Ausbruch in der preußisch-deutschen Hauptstadt lesen: »Einem polnischen Juden haben wir es in Berlin wieder einmal zu verdanken, dass die echten Pocken nach Berlin eingeschleppt worden sind. […] Irgendwelche Veranlassung zur allgemeinen Beunruhigung gibt das Vorkommnis nicht. Eins aber ergibt sich aus dem Geschehnis mit zwingender Notwendigkeit: strengste und rücksichtslose Maßregeln gegen den Zuzug russisch-polnisch-galizisch-ungarischer Juden in das Pestnest, das ›Scheunenviertel‹!«43
Der Bericht ist aus zwei Gründen bemerkenswert. Zunächst einmal tradiert er das uralte Stereotyp vom Juden als »Pestbringer«. Interessanter ist aber noch die Beobachtung, dass erst das Stereotyp vom »Juden« und »Ausländer« die Seuche überhaupt zur Bedrohung machte. Schließlich hob die Staatsbürger-Zeitung in diesem Artikel selbst hervor, dass die Pocken an sich keine Bedrohung darstellten. Und tatsächlich hatte die lang etablierte Pockenschutzimpfung zu diesem Zeitpunkt die Erkrankungszahlen im Deutschen Reich beinahe gen Null gedrückt. Zu einem Problem wurden die Pocken für die Berliner erst durch die Verbindung mit dem »Fremden«. Erst der Sündenbock und das Stereotyp vom schmutzigen, jüdischen Migranten verwandelten die Seuche in einen Skandal. Othering ist also nicht nur ein Modus, um Seuchen als Problem der Anderen aus der eigenen Lebenswelt auszulagern. Fremdzuschreibungen können umgekehrt auch Aufmerksamkeit erhöhen und Seuchen überhaupt erst zu einem Problem machen. Seuchenängste sind also nicht nur Katalysatoren für Sündenböcke, sondern ebenso umgekehrt: Sündenböcke befördern Seuchenängste.
Ein zweites Beispiel aus der Bundesrepublik macht diesen Zusammenhang besonders deutlich. Während der 1960er und frühen 1970er Jahre kehrten die Pocken nach Deutschland zurück. Reiserückkehrer brachten das tödliche Souvenir meist aus Afrika und Asien mit nach Hause. 1970 traf es die Mittelstadt Meschede im Sauerland. »Ein Gespenst geht um«, titelte die Tageszeitung Die Welt nach dem dortigen Pockenausbruch. Große Tages- und Wochenzeitungen machten mit umfangreichen Beiträgen über die Pocken-Panik von Meschede auf.44 Über die fatalen Folgen dieser Panik sprachen beispielsweise die Gesundheitsminister:innen der Bundesländer auf einer gemeinsamen Sitzung einige Wochen später: »Da wurde Autos mit dem Mescheder Kennzeichen die Benzinabgabe verweigert. […] Reisende aus Meschede wurden auf Bahnhöfen […] gleich wieder zurückgeschickt. […] Briefe aus Meschede wanderten ungeöffnet ins Feuer.«45 Die Analogien zu ähnlichen Ausgrenzungen der in Heinsberg oder Gütersloh lebenden Menschen im Jahr 2020 liegen auf der Hand. Auch für beliebte Stereotype von feierwütigen Jugendlichen, die angeblich auf »Corona-Partys« die Pandemie verbreiteten, finden sich im Sauerland Parallelen. 1970 hatte Bernd Klein, ein junger Mann aus Meschede, die Pocken aus einem Asienurlaub mitgebracht, da seine Pockenimpfung offenbar unsachgemäß ausgeführt worden war. In den folgenden Tagen beobachteten die Gesundheitsbehörden in Meschede einen »lautstark geäußerten Zorn darüber, daß ein junger Mann […] von einer Gammlertour die Pocken eingeschleppt hatte«. Ein Ärztemagazin sprach sogar von »Sippenhaftung« gegenüber Klein und seiner Familie: »Mit der mittelalterlichen Plage brach mittelalterliches Denken wieder durch: Daß Klein die Pocken eingeschleppt hatte, hätte man ihm in der sauerländischen Kleinstadt noch verziehen. […] Da der junge Mann aber als Gammler galt, Haschis [sic] rauchte und lange Haare trug, brach der Volkszorn über ihn herein.«46 Dass Stereotype von Jugendlichen Seuchenängste schüren, ist also kein Phänomen erst der Coronapandemie. Auf diesen Punkt komme ich später noch einmal zurück.
Der Ausbruch in Meschede macht noch weitere Parallelen zwischen den 2020er und den 1970er Jahren sichtbar, beispielsweise zur Rolle der Medien. Mit Ausbruch der Coronapandemie standen insbesondere soziale Medien im Kreuzfeuer der Kritik: Dank Facebook, Instagram, TikTok oder Twitter würden Stereotypen und Sündenböcke in die Welt gesetzt. Schuld an den aufgeladenen Auseinandersetzungen sei also letztlich »das Internet«, das Stigmatisierungen, Sündenböcke und Verschwörungstheorien »viral« verbreite. Ein Blick in die Seuchengeschichte setzt hinter solche Diagnosen allerdings ein Fragezeichen. Zwar erhöhen digitale Medien dank vereinfachter Bild(re)produktionsmöglichkeiten zweifellos die Sichtbarkeit von Stereotypen. Auch die Geschwindigkeit, mit der Stereotype und Sündenböcke unter’s Volk gebracht werden, wird durch Digitalität noch einmal erhöht. Allerdings ist eine virale Verbreitung von Stereotypen, Sündenböcken und Stigmata nichts Neues, sondern seit Jahrzehnten Thema. 1970 ging das Berliner Ärzteblatt so weit, sogar die Medienberichte über die Pocken in Meschede wortwörtlich als »Seuche« zu bezeichnen. In einer etwas sperrigen Metapher umschrieb das Periodikum das große Tempo der Medienberichterstattung als »Infektiösität einer Hysterie, die, auf dem Nährboden von Unwissenheit und psychologischer Ungeschicklichkeit angegangen, von den Massenmedien mit der Geschwindigkeit eines Waldbrandes verbreitet wurde«.47