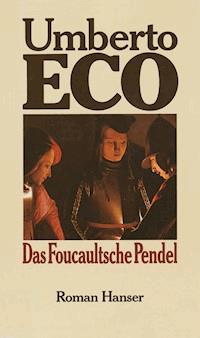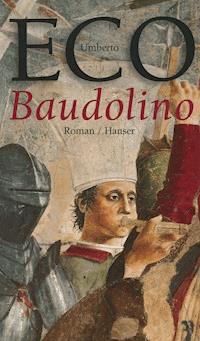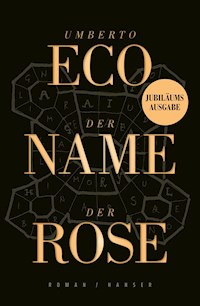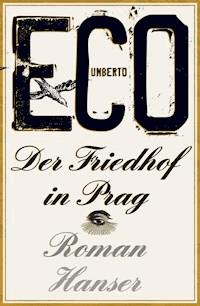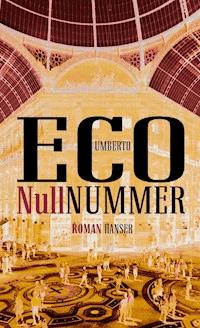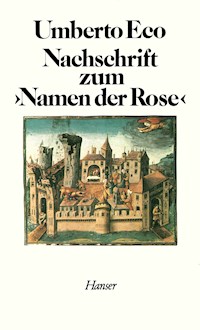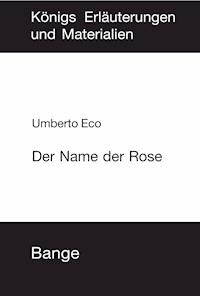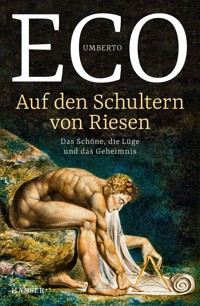
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Lügner, die die Wahrheit sagen, der Klimawandel als apokalyptischer Weltenbrand, die Literatur und das Unsichtbare – kaum jemand kombinierte seine Beobachtungen zu Gesellschaft, Politik und Kultur zu so überraschenden Einsichten wie Umberto Eco. Mit pointierten Analysen zu Literatur und Sprache, zu Kunst, Philosophie und Medien vereint „Auf den Schultern von Riesen" die Quintessenz von Umberto Ecos Gedankenwelt. In zwölf Vorträgen, die er bis kurz vor seinem Tod in Mailand gehalten hat, scheinen noch einmal alle großen Themen auf, die im Zentrum seines Schaffens standen – messerscharf beobachtet, spielerisch präsentiert und von ungebrochener Relevanz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Wie entwickeln Verschwörungstheorien ihre erzählerische Überzeugungskraft? Wie hängen Fakt, Fiktion und Fake News miteinander zusammen? Woher rührt die faszinierende Kraft des Hässlichen? Und was hat der Klimawandel mit antiken Vorstellungen des Kataklysmus zu tun?
Umberto Ecos Arbeiten zu Literatur und Kunst, zu Geschichte, Philosophie und Medien förderten nicht nur immer wieder überraschende Einsichten und Querverbindungen zu Tage. Sie sind auch bis heute von fast verblüffender Aktualität und Relevanz. Auf den Schultern von Riesen nimmt seine Leser mit auf eine fulminante Reise durch die Gedankenwelt des »Rockstars unter den Intellektuellen«, wie der Spiegel ihn einst nannte. Der vorliegende Band versammelt zwölf Vorträge, die Eco bis kurz vor seinem Tod in Mailand gehalten hat und in denen noch einmal alle Themen aufscheinen, die zeitlebens im Zentrum seines wissenschaftlichen, literarischen und essayistischen Schaffens standen.
Umberto Eco
Auf den Schultern von Riesen
Das Schöne, die Lüge und das Geheimnis
Aus dem Italienischen von Martina Kempter und Burkhart Kroeber
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Editorische Notiz zur italienischen Originalausgabe
Auf den Schultern von Riesen
Über Schönheit
Über Hässlichkeit
Absolut und relativ
Die Flamme ist schön
Das Unsichtbare. Warum es falsch ist, dass Anna Karenina in der Baker Street wohnt
Paradoxe und Aphorismen
Falsches sagen, lügen, fälschen
Über einige Formen der Unvollkommenheit in der Kunst
Einige Enthüllungen über das Geheimnis
Komplotte, Verschwörungen, Konspirationen
Darstellungen des Heiligen
Anmerkungen
Fußnoten
Abbildungsnachweis
Personenregister
Editorische Notiz zur italienischen Originalausgabe
Die hier veröffentlichten zwölf Texte verfasste Umberto Eco in den jeweils am Ende angegebenen Jahren für das Mailänder Kulturfestival La Milanesiana, wo er sie von 2001 bis 2015 in Form einer auch illustrierten lectio magistralis vortrug. Seit 2008 stand jeder Jahrgang der Milanesiana, wie ebenfalls jeweils am Ende vermerkt, unter einem bestimmten Thema, an das Eco sich hielt und das er mitunter selbst angeregt hatte.
Der erste, nicht illustrierte Vortrag »Auf den Schultern von Riesen« aus dem Jahr 2001 wird hier als Einleitung vorangestellt. Er vermittelt Ecos Sicht auf den Beitrag der Klassiker zu unserer Gegenwart sowie seine Auffassung von der Aufgabe des Intellektuellen.
Das letzte Kapitel »Darstellungen des Heiligen« wurde, obwohl ausdrücklich für La Milanesiana gedacht, dort nicht vorgetragen. Deshalb wurde es hier ans Ende gestellt.
In Ecos Vorträgen gibt es wiederkehrende Themen, die eher Leitmotive als Wiederholungen sind. Sie bezeugen vor allem seine nie erlahmende Aufmerksamkeit für die Fragen, die ihm am Herzen lagen.
Die redaktionellen Eingriffe beschränken sich auf einige wenige Anmerkungen und die Einfügung der Bilder, selbstverständlich unter Berücksichtigung der Angaben des Autors.
Auf den Schultern von Riesen
Die Geschichten von Zwergen und Riesen haben mich schon immer fasziniert. Allerdings ist die historische Fehde zwischen Zwergen und Riesen nur ein Kapitel des jahrtausendealten Kampfes zwischen Vätern und Söhnen, der auch uns noch, wie wir am Ende sehen werden, aus der Nähe betrifft.
Man braucht nicht die Psychoanalytiker zu bemühen, um zu erkennen, dass Söhne dazu neigen, ihre Väter zu töten – und nur um mich an die einschlägige Literatur zu halten, benutze ich hier die Maskulinformen, wohl wissend, dass es eine ebenfalls jahrtausendealte gute Gewohnheit ist, von den üblen Beziehungen zwischen Nero und Agrippina bis zu den Zeitungsmeldungen auf den Seiten Vermischtes, auch die Mütter zu töten.
Das Problem ist eher, dass es symmetrisch-parallel zum Angriff der Söhne auf die Väter immer auch den der Väter auf die Söhne gegeben hat. Ödipus erschlägt Laios, sei’s auch schuldlos, aber Saturn verschlingt seine Söhne, und Medea kann gewiss nicht eine vorbildliche Mutter genannt werden. Lassen wir den armen Thyestes beiseite, der sich ahnungslos einen Big Mac aus dem Fleisch seiner Söhne zubereitet, aber auf soundso viele Erben des Throns von Byzanz, die ihre Väter blendeten, kommen in Konstantinopel ebenso viele Sultane, die sich nur dadurch vor einer zu frühen Nachfolge retten konnten, dass sie ihre Erstgeborenen umbrachten.
Der Konflikt zwischen Vätern und Söhnen kann auch gewaltlose, aber deshalb nicht minder dramatische Formen annehmen. Man kann sich auch gegen den Vater wenden, indem man ihn verhöhnt, denken wir nur an Ham, der Noah nach all dem vielen Wasser keinen Schluck Wein gönnt, worauf Noah bekanntlich mit einer Abschiebung der rassistischen Art reagiert, indem er den respektlosen Sohn in die sogenannten unterentwickelten Länder verbannt. Und geben wir’s zu, ein paar Tausend Jahre endemischen Hungers und Versklavung als Strafe für eine Ungehörigkeit gegenüber dem Papa, der zu tief ins Glas geschaut hat, sind entschieden zu viel. Oder denken wir an die Bereitschaft Abrahams, seinen Sohn Isaak zu opfern: Auch wenn man sie als sublimes Beispiel für Unterwerfung unter den Willen Gottes betrachtet, würde ich sagen, dass Abraham seinen Sohn als sein Eigentum behandelt, über das er nach Belieben verfügen kann – doch den eigenen Sohn als Opfer zu schlachten, um sich Jahwes Gunst zu erwerben, ist das die Art, wie man sich nach unseren moralischen Regeln verhält? – Zum Glück hatte Jahwe nur einen Scherz gemacht, aber das wusste Abraham nicht. Dass Isaak dann vom Unglück verfolgt wird, können wir daran sehen, was ihm widerfährt, als er seinerseits Vater geworden ist: Zwar tötet ihn sein Sohn Jakob nicht, aber er stibitzt von ihm das Erstgeburtsrecht durch einen fiesen Trick, indem er seine Blindheit ausnutzt, eine Kriegslist, die vielleicht noch schmachvoller ist als ein schöner Vatermord.
Jede querelle des anciens et des modernes steht im Zeichen eines symmetrisch-parallelen Kampfes. Bei derjenigen im 17. Jahrhundert, deren Namen wir uns hier entlehnen, haben Perrault oder Fontenelle stets behauptet, dass die Werke ihrer Zeitgenossen reifer seien als die der Alten und somit besser (und darum bevorzugten die poètes galants und die esprits curieux die neuen Formen der Erzählung und des Romans), aber zum Streit zwischen den Alten und den Modernen kam es dann deshalb, weil Boileau und alle, die sich für die Nachahmung der Alten einsetzten, machtvoll dagegen protestierten.
Wo immer es einen solchen Streit gibt, widersprechen den Innovatoren die laudatores temporis acti, die Verehrer der guten alten Zeiten, und oft entsteht das Lob der Neuheit und des Bruchs mit der Vergangenheit gerade als Reaktion auf den verbreiteten Konservativismus. Gab es zu unserer Zeit in Italien die Poeti Novissimi, so haben wir doch alle in der Schule gelernt, dass es vor zweitausend Jahren die poetae novi gegeben hat. Zur Zeit von Catull existierte das Wort modernus noch nicht, aber novi nannten sich diejenigen Dichter, die sich auf die griechische Lyrik beriefen, um gegen die lateinische Tradition zu opponieren. Ovid schreibt in der Ars amatoria (III, 121 f.): prisca iuvent alios, »ich überlasse die Vergangenheit den anderen«, ego me nunc denique natum gratulor; haec aetas moribus apta meis, »ich bin stolz darauf, heute geboren zu sein; diese Zeit passt zu mir«, da sie, so Ovid weiter, verfeinerter sei und nicht so rustikal wie die früheren. Dass diese Neuen jedoch den Laudatoren der alten Zeiten Verdruss bereiteten, ruft uns Horaz in Erinnerung (Epistulae II, 1, 75 ff.), der statt modernus das Zeitadverb nuper, »neulich, dieser Tage«, benutzt, um auszudrücken, dass es empörend sei, ein Buch nicht wegen fehlender Eleganz zu verurteilen, sed quia nuper, sondern weil es erst dieser Tage erschienen sei. Das ist dann genau die Haltung von heute, wenn in Rezensionen neuer Werke beklagt wird, heutzutage würden keine Romane mehr geschrieben, wie man sie früher kannte.
Der Ausdruck modernus kommt genau zu der Zeit auf, als das endet, was wir Antike nennen, also gegen Ende des 5. Jahrhunderts, als ganz Europa in die Zwischenzeit jener wirklich dunklen Jahrhunderte fällt, die der karolingischen Renaissance vorangehen und uns als die am wenigsten modernen aller Zeiten erscheinen.
Genau in jenen Dark Ages, in denen die Erinnerung an die einstige Größe verblasst und nur verkohlte und zerfallene Trümmer davon bleiben, breitet sich die Erneuerung aus, auch ohne dass die Erneuerer sich dessen immer bewusst sind. Denn genau da beginnen die neuen europäischen Sprachen sich zu etablieren, vielleicht das innovativste und folgenreichste Ereignis der letzten zweitausend Jahre. Parallel dazu wandelt sich das klassische Latein zum Mittellatein. In dieser Zeit tauchen die Anzeichen eines Innovationsstolzes auf.
Erster Akt dieses Stolzes ist, dass man offen zugibt, ein neues Latein zu erfinden, ein Latein, das nicht mehr das der alten Römer ist. Nach dem Zerfall des Römischen Reiches erleidet der alte Kontinent eine Abnahme der Bevölkerung, eine schwere Krise der Landwirtschaft, die Zerstörung der großen Städte und den Verfall der römischen Straßen und Aquädukte. In einem von Wäldern bedeckten Europa sehen Mönche, Poeten und Miniaturenmaler die Welt als eine selva oscura, einen dunklen Wald voller Monsterwesen. Gregor von Tours beklagte seit 580 das Ende der Literatur, und ich weiß nicht mehr, welcher Papst sich fragte, ob die in Gallien vorgenommenen Taufen noch gültig waren, seit man dort in nomine Patris et Filiae (sic, also der Tochter) et Spiritus Sancti taufte, weil auch die Priester nicht mehr richtig Latein konnten. Doch zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert entwickelte sich dann das, was man die »hisperische Ästhetik« genannt hat, ein Stil, der sich von Spanien über Gallien bis zu den britischen Inseln und nach Irland ausdehnte. Die klassisch-lateinische Tradition hatte diesen Stil noch als »asianisch« und später »afrikanisch« bezeichnet (und abgelehnt), im Gegensatz zur Ausgewogenheit des »attischen« Stils. Am asianischen Stil verurteilte man das, was die klassische Rhetorik kakozelon oder mala affectatio, »schlechten Eifer« nannte, das heißt die Affektiertheit und die Vorliebe für das Ausgefallene. Als Beispiel dafür, wie sich die Kirchenväter zu Anfang des 5. Jahrhunderts über Fälle dieser mala affectatio empörten, lese man diese Schmährede des hl. Hieronymus (Adversus Jovinianum I):
Es gibt heutzutage so viele barbarische Schreiber und so viele durch stilistische Laster entstellte Reden, dass man nicht mehr versteht, wer da spricht, noch wovon die Rede ist. Alles bläht sich auf und erschlafft wieder, wie eine kranke Schlange, die zusammenbricht, während sie sich aufzubäumen versucht. Alles verknäuelt sich zu unentwirrbaren Wörterknoten, sodass man mit Plautus ausrufen möchte: »Das versteht ja niemand außer der Sibylle!« Was sollen all diese Wortungetüme?
Doch was die klassische Tradition als »Laster« ansah, wird für die hisperische Poetik zur Tugend. Der hisperische Stil gehorcht nicht mehr den Gesetzen der Syntax und der traditionellen Rhetorik; die Regeln des Rhythmus und Metrums werden verletzt, um Listen nach barocker Manier zu erstellen. Lange Alliterationsketten, die der klassische Geschmack als kakophonisch verurteilt hätte, erzeugen nun eine neue Musik, und der angelsächsische Bischof Aldhelm von Malmesbury steigert sich bis zur Bildung von Sätzen, in denen möglichst jedes Wort mit demselben Buchstaben anfängt (Brief an König Aldfrid von Northumbrien, PL 89, 159): Primitus pantorum procerum praetorumque pio potissimum paternoque praesertim privilegio panegyricum poemataque passim prosatori sub polo promulgantes und so weiter.
Der hisperische Wortschatz bereichert sich mit unglaublichen Kreuzungen aus hebräischen und hellenistischen Ausdrücken, die Texte verdichten sich durch Kryptogramme und Rätsel, die jedem Bemühen um Übersetzung hohnsprechen. Hatte die klassische Ästhetik als Ideal die Klarheit, so wird das Ideal der hisperischen nun die Dunkelheit. Strebte der klassische Stil nach ausgewogenen Proportionen, so bevorzugt der hisperische Stil die Komplexität, den Überfluss an Epitheta und Paraphrasen, das Gigantische, Monströse, Unbändige, Maßlose und Wunderbare. Um die Wellen des Meeres zu bezeichnen, treten Adjektive wie astriferus oder glaucicomus auf, und man schätzte auch Neologismen wie pectoreus, placoreus, sonoreus, alboreus, propriferus, flammiger, gaudifluus …
Es sind die gleichen lexikalischen Erfindungen, die im 7. Jahrhundert von Virgilius Grammaticus in seinen Epitomae und Epistolae gepriesen werden. Dieser verrückte Grammatiker aus Bigorre bei Toulouse zitierte angebliche Passagen von Cicero und seinem Namensvetter Vergil (dem richtigen, dem Dichter), die unmöglich von diesen Autoren stammen konnten, aber dann entdeckt oder errät man, dass er einem Rhetorenzirkel angehörte, dessen Mitglieder sich die Namen klassischer Autoren zugelegt hatten, aber unter diesen falschen Namen ein Latein schrieben, das alles andere als klassisch war, wofür sie sich dann rühmten. Virgilius von Bigorre erschuf eine sprachliche Welt, die aussieht, als wäre sie der Fantasie eines Edoardo Sanguineti entsprungen, obwohl es vermutlich umgekehrt war. So behauptete er, es gebe zwölf verschiedene Arten von Latein, und in jeder von ihnen könne das Feuer anders heißen, nämlich ignis, quoquihabin, ardon, calax, spiridon, rusin, fragon, fumaton, ustrax, vitius, siluleus und aeneon (Epitomae I, 4). Die Schlacht werde praelium genannt, weil sie auf dem Meer stattfinde (das praelum heiße, weil es dank seiner Weite die Suprematie oder das praelatum des Wunderbaren habe, Epitomae IV, 10). Zugleich wurden aber die Regeln der lateinischen Sprache selbst infrage gestellt, und man erzählte sich, die Grammatiker Galbungus und Terentius hätten vierzehn Tage lang pausenlos über den Vokativ von ego disputiert – ein Problem von größter Wichtigkeit, galt es doch zu bestimmen, wie man sich selbst emphatisch anreden soll (O egone, recte feci? – »O ich, habe ich recht getan?«).
Aber kommen wir nun zu denen, die nicht Latein, sondern in ihren Volkssprachen schrieben, den sogenannten volgari. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts sprach das Volk nicht mehr Latein, sondern gallo-romanisch, italo-romanisch, hispano-romanisch oder balkan-romanisch. Das waren gesprochene Sprachen, die noch nicht geschrieben wurden, und doch feiert man schon vor den Serments de Strasbourg (842) und der Carta Capuana (960–63) die sprachliche Innovation. Und in denselben Jahrhunderten liest man unter dem Eindruck der Sprachenvielfalt die Geschichte vom Turm zu Babel neu und sieht in ihr gewöhnlich ein Zeichen von Unglück und Verdammnis. Doch es gibt auch schon Leute, die es wagen, in der Geburt neuer Volkssprachen ein Zeichen von Modernität und Perfektionierung zu sehen.
Im 7. Jahrhundert versuchen einige irische Grammatiker, die Vorzüge des Gälischen gegenüber der lateinischen Grammatik zu definieren. In einem Werk mit dem Titel Die Fibel der Gelehrten berufen sie sich direkt auf den Bau des Turms zu Babel: So wie beim Bau dieses Turms acht oder neun (je nach Überlieferung) Materialien verwendet worden seien, nämlich Ton und Wasser, Wolle und Blut, Holz und Kalk, Pech, Leinen und Teer, so seien bei der Bildung des Gälischen acht bis neun Wortarten benutzt worden: Nomen, Pronomen, Verb, Adverb, Partizip, Konjunktion, Präposition und Interjektion. Die Parallele ist vielsagend: Es wird erst Hegel kommen müssen, um im Mythos vom Turm zu Babel wieder ein positives Modell zu finden. Die irischen Grammatiker behaupten, das Gälische stelle das erste und einzige Beispiel einer Überwindung der babylonischen Sprachverwirrung dar. Seine Schöpfer hätten durch ein Verfahren, das wir heute cut and paste nennen würden, das Beste aus jeder Sprache für jedes Ding genommen, für das es in anderen Sprachen noch keinen Namen gab, und hätten es so zusammengefügt, dass es eine Einheit in Form, Wort und Sache ergab.
Mit noch viel größerem Selbstbewusstsein hinsichtlich seines Unternehmens und seiner Würde betrachtet sich ein paar Jahrhunderte später Dante als ein Erneuerer, nämlich als Erfinder einer neuen Volkssprache. Angesichts der Vielzahl italienischer Dialekte, die er mit der Genauigkeit eines Linguisten analysiert, aber auch mit der Überheblichkeit und manchmal sogar Verachtung des Dichters, der nie bezweifelt, der größte von allen zu sein, kommt er zu dem Schluss, dass es darum gehe, ein volgare illustre zu erschaffen, eine erleuchtete Volkssprache, die zugleich cardinale (als Bezugspunkt und Regel fungierend), regale (eines Königs würdig, sollten die Italiener je einen haben) und curiale (als Sprache des Hofes, des Rechts und der Weisheit geeignet) sein müsse. In seiner Abhandlung De vulgari eloquentia legt er die Kompositionsregeln dieses einzigen wahren volgare illustre dar, der poetischen Sprache, als deren Begründer sich Dante sieht und die er den Sprachen der babylonischen Verwirrung entgegenstellt als eine, die zu der ursprünglichen Affinität mit den Dingen zurückfindet, wie sie der adamitischen Sprache zu eigen war. Diese illustre Volkssprache, nach der Dante »auf der Jagd wie nach einem Panther« ist, steht für eine Restauration der Sprache Edens, sodass sie die Wunde nach Babel heilen kann. Aus dieser kühnen Konzeption seiner Rolle als Restaurator der vollkommenen Sprache ergibt sich, dass Dante, anstatt die Vielfalt der Sprachen zu beklagen, deren fast biologische Kraft hervorhebt, ihre Fähigkeit, sich zu erneuern und mit der Zeit zu verändern. Gerade aufgrund dieser so beteuerten sprachlichen Kreativität kann er sich vornehmen, eine perfekte moderne und natürliche Sprache zu erfinden, ohne sich auf die Jagd nach verlorenen Vorbildern zu machen wie zum Beispiel dem ursprünglichen Hebräisch. Dante bewirbt sich für die Rolle eines neuen (und perfekteren) Adam. Verglichen mit diesem dantischen Stolz klingt Arthur Rimbauds ein wenig später verkündetes Programm, »il faut être absolument moderne« [es gilt absolut modern zu sein] veraltet. Im Kampf zwischen Vätern und Söhnen ist Dantes Anfang »Nel mezzo del cammin di nostra vita« [In der Mitte unseres Lebensweges, bzw. Dem Höhepunkt unseres Lebens nahe] um einiges vatermörderischer als RimbaudsSaison in der Hölle.
Den vielleicht ersten Fall eines Kampfes zwischen Generationen, in dem explizit der Ausdruck modernus auftaucht, finden wir nicht auf dem Gebiet der Literatur, sondern auf dem der Philosophie. Hatte das frühe Mittelalter sich noch an Texten des späten Neoplatonismus als seinen primären philosophischen Quellen orientiert, an Augustinus und jenen aristotelischen Schriften, die es Logica vetus nannte, so traten ab dem 12. Jahrhundert allmählich andere aristotelische Texte in den Fokus der scholastischen Bildung, Texte wie die Erste und die Zweite Analytik, die Topik und die Sophistischen Widerlegungen, die dann als Logica nova bezeichnet wurden. Doch nach diesem Anstoß ging man von einem lediglich metaphysischen und theologischen Diskurs zur Erforschung all jener Subtilitäten des Räsonnements über, die unsere heutige Logik als die lebendigste Hinterlassenschaft des mittelalterlichen Denkens studiert, und so entstand jene Logik, die man (mit dem offenkundigen Stolz jeder Innovationsbewegung) als Logica modernorum definierte.
Wie neuartig diese Logik der Modernen gegenüber dem theologischen Denken der Vergangenheit war, sehen wir daran, dass die Kirche nur Denker wie Anselm von Canterbury, Thomas von Aquin und Bonaventura heiliggesprochen hat, nie aber einen Vertreter der modernen Logik. Nicht dass diese als Ketzer galten. Sie beschäftigten sich nur, während es um die theologischen Debatten der vergangenen Jahrhunderte ging, mit anderen Dingen – heute würden wir sagen, sie beschäftigten sich mit der Funktionsweise unseres Verstandes. Sie waren mehr oder weniger bewusst dabei, ihre Väter zu töten, genau wie die Philosophie des Humanismus dann versuchen sollte, sie, die nun überholten Modernen, zu töten (wobei es ihr jedoch nur gelang, sie in die Hörsäle der Universitäten zu verbannen, wo unsere heutigen Universitäten sie dann wiederentdecken sollten).
In allen hier genannten Fällen wird jedoch deutlich, dass jeder Akt der Erneuerung und der Opposition gegen die Väter stets durch den Rückgriff auf einen Vorfahren erfolgt, den man für besser als den zu tötenden Vater erklärt und als Bezugsgröße nimmt. Die poetae novi wandten sich gegen die lateinische Tradition, indem sie sich auf die griechische Lyrik bezogen, die hisperischen Dichter und Virgilius Grammaticus schufen sich ihre hybriden Sprachmodelle, indem sie sich keltischer, westgotischer, hellenistischer und hebräischer Elemente bedienten, die irischen Grammatiker feierten eine Sprache, die sich dem Latein entgegenstellte, weil es eine Collage aus deutlich älteren Sprachen war, Dante brauchte einen so starken Vorfahren wie den römischen Dichterfürsten Vergil, und die Logica modernorum verdankte ihre Modernität der Wiederentdeckung des verlorenen Aristoteles.
Ein im Mittelalter recht häufiger Topos war der Glaube, dass die Menschen früher schöner und größer gewesen seien. Eine Annahme, die heute ganz und gar unhaltbar wäre – man sehe sich nur die Länge der Betten an, in denen Napoleon schlief –, die aber damals vielleicht nicht ganz unsinnig war; und zwar nicht nur, weil das Bild, das man von der Antike hatte, von Statuen als Ehren- und Ruhmesmalen geprägt war, die den zu Rühmenden um viele Zentimeter vergrößerten, sondern auch, weil es nach dem Fall des Römischen Reiches eine jahrhundertelange Entvölkerung und Hungersnot gab, sodass die Kreuz- und Gralsritter, die wir in unseren heutigen Kinos sehen, in Wirklichkeit höchstwahrscheinlich viel kleiner waren als die siegreichen Ritter unserer Zeiten. Alexander der Große war bekanntlich ein Knirps, aber Vercingetorix war vermutlich größer als König Artus. Als symmetrisches Gegenbild dazu gab es, von der Bibel bis zur Spätantike und darüber hinaus, den Topos vom puer senilis, einem Jugendlichen, in dem sich die Vorzüge der Jugend mit allen Tugenden des Alters verbanden. Nun mag es zwar so scheinen, als sei das Lob der antiken Größe ein Ausdruck konservativer Gesinnung und innovativ dagegen das Modell jener »Klugheit des Greises im Jungen«, die Apuleius preist (senilis in iuvene prudentia, Florida IX, 38). Aber dem ist nicht so. Das Lob der Ältesten ist die Geste, mit der die Innovatoren sich daranmachen, die Gründe ihrer Innovation in einer Überlieferung zu suchen, die ihre Väter vergessen haben.
Abgesehen von den wenigen hier zitierten Fällen, vor allem von Dantes Stolz, nahm man sich im Mittelalter vor, wahre Dinge zu sagen, deren Wahrheit dadurch bezeugt wurde, dass sie von einer früheren auctoritas gesagt worden waren – was so weit ging, dass, wenn man befürchtete, die auctoritas werde diese neue Idee womöglich nicht unterstützen, man sich nicht scheute, ihre Aussagen entsprechend zu manipulieren, denn die auctoritas hat, wie Alain de Lille im 12. Jahrhundert sagte, eine wächserne Nase – sie konnte verschieden ausgelegt werden.
Wir müssen uns anstrengen, diesen Sachverhalt recht zu verstehen, denn seit Descartes ist der Philosoph jemand, der mit dem bisherigen Wissen Tabula rasa macht und sich – wie Jacques Maritain sagte – als ein »Debütant im Absoluten« präsentiert. Jeder heutige Denker (zu schweigen von den Dichtern oder Romanschriftstellern oder Malern), der ernst genommen werden will, muss irgendwie zeigen, dass er etwas anderes zu sagen hat als seine unmittelbaren Vorgänger, und selbst wenn das nicht der Fall ist, muss er zumindest so tun, als ob. Nun, und die Scholastiker taten genau das Gegenteil. Sie begingen die dramatischsten Vatermorde, bildlich gesprochen, wobei sie jedoch behaupteten und zu beweisen versuchten, dass sie nur exakt wiederholten, was ihre Väter gesagt hatten. Thomas von Aquin hat für seine Zeit die christliche Philosophie revolutioniert, aber jedem, der ihm das hätte vorwerfen wollen (und es hat Leute gegeben, die das versucht haben), hätte er ohne zu zögern erwidert, er wiederhole nur, was acht Jahrhunderte vor ihm der heilige Augustinus gesagt hatte. Und das wäre weder Lüge noch Heuchelei gewesen. Der mittelalterliche Denker dachte einfach nur, dass es richtig sei, die Meinungen seiner Vorgänger da und dort zu korrigieren, wenn ihm schien, dass er, gerade dank ihrer Vorarbeit, klarer sehe als sie. Und hierauf fußt nun der Aphorismus, den ich diesem Vortrag als Titel gegeben habe, der Spruch von den Zwergen auf den Schultern von Riesen:
Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre, non utique proprii visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum subvehimur et extollimur magnitudine gigantea.
[Also sprach Bernhard von Chartres, wir sind wie Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen, sodass wir mehr als sie und weiter sehen können, nicht weil wir scharfsichtiger oder größer wären, sondern weil die Größe der Riesen uns hochhebt und über sie hinausschauen lässt.]
Wer ein Verzeichnis der Quellen dieses Ausspruchs haben möchte, kann fürs Mittelalter auf das Büchlein Nani sulle spalle di giganti von Édouard Jeauneau zurückgreifen,1 aber unterhaltsamer, ausschweifender und anregender ist die Monografie On the Shoulders of Giants, die 1965 von einem der größten zeitgenössischen Soziologen verfasst wurde, nämlich von Robert K. Merton.2 Dieser war eines Tages fasziniert von der Formulierung, in der Isaac Newton den Aphorismus 1675 in einem Brief an Robert Hooke zitierte: »If I have seen further it is by standing on ye shoulders of Giants«, und so machte er sich auf die Suche nach den Quellen, um die Geschichte dieses Ausspruchs durch die Jahrhunderte zu verfolgen und in einer Reihe von gelehrten Abschweifungen darzulegen, die er von Auflage zu Auflage mit Zusätzen und Notizen erweiterte, bis er das Buch, nachdem es 1991 ins Italienische übersetzt worden war (wozu er mich liebenswürdigerweise um ein Vorwort gebeten hatte), schließlich 1993 noch einmal als »The post-italianate edition« vorlegte.
Den Spruch von den Zwergen und Riesen hat, so jedenfalls berichtet es Johannes von Salisbury in seinem Metalogicon (III, 4), dessen Lehrer Bernhard von Chartres im 12. Jahrhundert geprägt. Vielleicht war Bernhard nicht der Erste, denn der Gedanke (wenn nicht die Zwerg-Metapher) taucht bereits sechs Jahrhunderte vorher bei Priscian auf, und als Bindeglied zwischen Priscian und Bernhard könnte Wilhelm von Conches fungieren, der in seinen Glossen zu Priscian von Zwergen und Riesen spricht, sechsunddreißig Jahre vor Johannes von Salisbury. Doch was uns hier interessiert, ist, dass nach Johannes von Salisbury der Aphorismus ein bisschen überall auftaucht: 1160 in einem Text der Schule von Laon, um 1185 bei dem dänischen Historiker Svend Aggesen, bei Gérard de Cambrai, Raoul de Longchamp, Gilles de Corbeil, Gérard d’Auvergne, im 14. Jahrhundert bei Alexandre Ricat, dem Leibarzt des Königs von Aragon, zwei Jahrhunderte später in den Werken von Ambroise Paré und im 17. Jahrhundert bei einem Naturwissenschaftler und Arzt wie Daniel Sennert und dann bei Newton. Tullio Gregory verzeichnet ein Auftreten des Aphorismus bei Gassendi (Scetticismo e empirismo. Studio su Gassendi, 1961), aber man könnte mindestens bis zu Ortega y Gasset weitergehen, der in seinem Essay »En torno a Galileo« (Obras completas, V, Madrid 1947, S. 45), wo er über die Abfolge der Generationen spricht, von den Menschen sagt, sie stünden »einer auf den Schultern des anderen, und wer am höchsten steht, genießt den Eindruck, die anderen zu beherrschen, doch er sollte spüren, dass er gleichzeitig ihr Gefangener ist«. Andererseits finde ich in Jeremy Rifkins Buch Entropy (1980)3 ein Zitat von Max Gluckman, das lautet: »Wissenschaft ist jede Art von Disziplin, in der auch ein Dummkopf der jetzigen Generation übertreffen kann, was ein Genie der vorherigen Generation erreicht hat.« Zwischen diesem Zitat und dem, das Bernhard von Chartres zugeschrieben wird, liegen acht Jahrhunderte, und in dieser Zeit hat sich etwas getan: Ein Ausspruch, der sich auf das Verhältnis zu den Vätern im philosophischen und theologischen Denken bezog, ist zu einem Ausspruch über den progressiven Charakter der Naturwissenschaft geworden.
In seiner mittelalterlichen Entstehungszeit wurde der Aphorismus populär, weil er es erlaubte, den Konflikt zwischen Generationen auf eine scheinbar nicht revolutionäre Weise zu lösen. Die Alten sind verglichen mit uns gewiss Riesen, aber wir sitzen, obwohl wir Zwerge sind, auf ihren Schultern, das heißt, wir profitieren von ihrer Weisheit, und daher können wir weiter sehen als sie. War dieser Ausspruch ursprünglich demütig oder hochmütig gemeint? Wollte er sagen, dass wir wissen, sei’s auch ein wenig besser, was uns die Alten gelehrt haben, oder dass wir, sei’s auch dank dem, was wir den Alten schulden, sehr viel mehr wissen als sie?
Da eines der wiederkehrenden Themen des mittelalterlichen Denkens die fortschreitende Vergreisung der Welt ist, könnte man Bernhards Diktum auch in dem Sinne interpretieren, dass wir Jüngeren zwar, da mundus senescit, schneller alt werden als unsere Vorfahren, aber dank ihnen wenigstens etwas verstehen oder tun können, was ihnen noch nicht zu verstehen oder zu tun gelungen war. Bernhard von Chartres formulierte das Diktum im Rahmen einer Debatte über Grammatik, in der es um das Konzept der Kenntnis und Imitation des Stils der antiken Autoren ging, doch wie Johannes von Salisbury bezeugt, warf er dabei seinen Schülern vor, dass sie die antiken Autoren sklavisch kopierten, und sagte, die Herausforderung sei nicht, genauso zu schreiben wie sie, sondern von ihnen zu lernen, wie man genauso gut schreibt wie sie, damit die nach uns Kommenden sich an uns orientieren, so wie wir uns an den Vorfahren orientieren. Daher enthielt sein Aphorismus, wenn auch nicht in den Begriffen, in denen wir ihn heute lesen, einen Appell an die Autonomie und den Mut zur Innovation.
Im Kern hieß die Aussage: »Wir sehen weiter als unsere Vorfahren.« Dabei ist das »weiter« offenkundig räumlich gemeint und impliziert das Bild eines Marsches zum Horizont. Wir können nicht vergessen, dass die Geschichte, verstanden als fortschreitende Bewegung, von der Schöpfung zur Erlösung und von dieser zur Rückkehr des triumphierenden Christus, eine Erfindung der Kirchenväter ist – weshalb, ob es uns gefällt oder nicht, ohne Christentum (sei’s auch mit dem jüdischen Messianismus im Rücken) weder Hegel noch Marx von dem hätten sprechen können, was Leopardi skeptisch als »le magnifiche sorti e progressive« sah.*1
Der Aphorismus entstand im frühen 12. Jahrhundert. Seit weniger als einem Jahrhundert war damals eine Debatte verstummt, die in der christlichen Welt seit den ersten Lektüren des Buches der Apokalypse begonnen und bis zu den Schrecken des Jahres Tausend angehalten hatte – nicht als Massenbewegung, aber präsent in der ganzen mittelalterlichen Endzeitliteratur und in vielen mehr oder minder verdeckten häretischen Strömungen: der Millenarismus, sprich die neurotische Erwartung eines apokalyptischen Zeitenendes. Als Bernhard den Aphorismus prägte, gab es diese Erwartung zwar noch in vielen häretischen Bewegungen, aber aus dem orthodoxen Diskurs war sie verschwunden. Man bewegte sich weiter hin zu einer finalen Parusie im Sinne einer endgültigen Wiederkunft Christi, aber diese galt nun als idealer Endpunkt einer Geschichte, die insgesamt positiv gesehen wurde. Die Zwerge wurden zum Symbol dieses erwartungsfrohen Marsches in die Zukunft.
Mit dem Auftritt der Zwerge im Mittelalter beginnt die Geschichte der Moderne als Innovation, die ihre Innovationskraft daraus bezieht, dass sie wieder an die vergessenen Modelle der Väter anknüpft. Nehmen wir zum Beispiel die kuriose Situation der ersten Humanisten und jener Philosophen wie Pico della Mirandola oder Marsilius Ficinus. Sie sind die Vorkämpfer – so haben wir es in der Schule gelernt – einer Schlacht gegen die mittelalterliche Welt, und mehr oder weniger zu dieser Zeit kommt das Wort »gotisch« auf, mit keineswegs nur positiven Konnotationen. Jedoch, was tut der wiedergeborene Platonismus? Er bringt Platon gegen Aristoteles in Stellung, er entdeckt das Corpus hermeticum oder die Chaldäischen Orakel, er konstruiert ein neues Wissen auf einer sapientia prisca, einer uralten Weisheit, die sogar noch hinter Christus zurückgeht. Humanismus und Renaissance sind kulturelle Bewegungen, die gemeinhin als revolutionär verstanden werden, die jedoch ihre Strategie der Erneuerung auf einen der reaktionärsten Handstreiche gründen, den es jemals gegeben hat, wenn man unter reaktionärer Haltung in der Philosophie eine Rückkehr zur zeitlosen Überlieferung versteht. Wir haben es also mit einem Vatermord zu tun, der die Väter durch Rückgriff auf die Großväter abräumt und auf deren Schultern sitzend versucht, die wiedergeborene Vision des Menschen als Mitte des Kosmos zu rekonstruieren.
Es ist dann vermutlich die Naturwissenschaft des 17. Jahrhunderts, mit der sich die okzidentale Kultur bewusst macht, dass sie die Welt auf den Kopf gestellt und somit das Wissen nun wirklich revolutioniert hat. Aber der Ausgangspunkt dieses Prozesses, die kopernikanische Hypothese, berief sich auf platonische und pythagoräische Reminiszenzen. Die Jesuiten der Barockzeit versuchten dann, eine alternative Moderne gegenüber der kopernikanischen zu errichten, indem sie antike Schriften und Kulturen des fernen Ostens wiederentdeckten. Isaac La Peyrère, ein überzeugter Häretiker, hatte zu demonstrieren versucht (indem er die biblische Chronologie über den Haufen warf), dass die Welt schon lange vor Adam begonnen habe, nämlich in den Meeren vor China, und dass folglich die Inkarnation nur eine zweitrangige Episode in der Geschichte dieses unseres Planeten sei. Giambattista Vico sah die gesamte menschliche Geschichte als einen Prozess, der uns durch die Riesen von einst dazu bringt, endlich mit klarem Kopf nachzudenken. Die Aufklärung empfand sich als radikal modern, und gleichsam als Kollateralschaden tötete sie den Vater dann wirklich, indem sie Louis XVI. als Sündenbock nahm. Aber auch hier, man lese nur Diderots und d’Alemberts Encyclopédie, waren die Riesen von einst sehr gefragt. In der Encyclopédie gibt es Tafeln voller Maschinen, mit denen die neue Manufakturindustrie gefeiert wird, aber sie hat auch keine Scheu vor »revisionistischen« Artikeln (revisionistisch in dem Sinn, dass sie als fleißiger Zwerg die Geschichte neu liest), in denen antike Lehren ausführlich dargelegt werden.
Die großen kopernikanischen Revolutionen des 19. Jahrhunderts berufen sich stets auf vorangegangene Riesen. Kant hat es nötig, dass Hume ihn aus seinem dogmatischen Schlaf weckt; die Romantiker bereiten sich auf den Sturm vor, indem sie die Nebel und Schlösser des Mittelalters wiederentdecken; Hegel bestätigt definitiv den Primat des Neuen gegenüber dem Alten, indem er die Geschichte als Vervollkommnungsbewegung ohne Schlacken und Nostalgien sieht; Marx liest die ganze Geschichte des menschlichen Denkens neu und entwickelt seinen Materialismus, indem er, in seiner Dissertation, von Epikur und den altgriechischen Atomisten ausgeht; Darwin tötet seine biblischen Väter, indem er die großen Menschenaffen zu Riesen erklärt, auf deren Schultern die Menschen einst von den Bäumen herabstiegen, um sich, noch voller Staunen und Wildheit, dabei wiederzufinden, jenes Wunder der Evolution zu verwalten, das der frei bewegliche Daumen ist. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entsteht eine künstlerische Erneuerungsbewegung, die sich fast gänzlich in einer Wiederaneignung der Vergangenheit erschöpft, von den Präraffaeliten bis zu den Décadents. Die Wiederentdeckung einiger ferner Vorväter dient als Revolte gegen die unmittelbaren Väter, die von den mechanischen Webstühlen korrumpiert worden sind. Und Giosuè Carducci macht sich zum Herold der Moderne mit einer Hymne an Satan, sucht aber unentwegt nach Gründen und Idealen im Mythos des kommunalen Italiens.
Die klassischen Avantgarden zu Beginn des 20. Jahrhunderts repräsentieren die äußerste Zuspitzung des modernistischen Vatermords, der von jeder Ehrfurcht vor der Vergangenheit frei sein zu wollen behauptet. Ihre Markenzeichen sind der Sieg des Rennwagens über die Nike von Samothrake, die Ermordung des Vollmonds, die Verehrung des Krieges als einziger Hygiene der Welt, die kubistische Auflösung der Formen, der Durchmarsch zur Abstraktion der weißen Leinwand, die Ersetzung der Musik durch den Lärm oder durch die Stille, zumindest der Tonleiter durch die atonale Serie, die Curtain Wall, die das Ambiente nicht beherrscht, sondern aufsaugt, das Gebäude als Stele, als reines Parallelepiped, die Minimal Art; und in der Literatur sind es die Zerstörung des Redeflusses, der Erzähltempora, die Collage, die leere Seite. Aber auch hier taucht unter dem Auftrumpfen neuer Riesen, die das Erbe der alten Riesen zertreten wollen, wieder die Ehrfurcht der Zwerge auf. Ich meine nicht nur Marinetti, der als Buße für die Ermordung des Vollmonds in die Accademia d’Italia eintrat, die dem Vollmond sehr wohlgesonnen war. Sondern auch Picasso, der zu einer Entstellung des menschlichen Antlitzes gelangt, indem er über die Modelle der klassischen Antike und der Renaissance meditiert, und der sich am Ende auf die antiken Minotauren zurückbesinnt; oder Duchamp, der die Mona Lisa mit einem Schnurrbart verhöhnt, aber die Mona Lisa benötigt, um seinen Schnurrbart zu malen; oder Magritte, der, um zu negieren, dass das, was er malt, eine Pfeife ist, mit peniblem Realismus eine Pfeife malen muss. Und schließlich den großen Vatermord am historischen Körper des Romans, den Joyce vollbracht hat, ausgehend vom Modell der Erzählung Homers. Auch der neueste Ulysses segelt auf den Schultern, oder dem Hauptmast, seines antiken Vorbilds.
Womit wir zur sogenannten Postmoderne gelangen. Postmodern ist gewiss ein Allerweltsbegriff, den man auf viele und vielleicht zu viele Dinge anwenden kann. Aber es gibt gewiss auch etwas Gemeinsames in den diversen als postmodern bezeichneten Operationen, und es entsteht als Reaktion, womöglich als unbewusste, auf die zweite der Unzeitgemäßen Betrachtungen von Nietzsche, in der er das Übermaß unseres Geschichtsbewusstseins anprangert. Wenn dieses Bewusstsein nicht einmal durch den Gestus der Avantgarde beseitigt werden kann, dann kann man auch ebenso gut die Einflussangst akzeptieren und die Vergangenheit scheinbar voller Verehrung betrachten, tatsächlich aber mit der aus dieser Distanz ermöglichten Ironie.
Kommen wir schließlich zur letzten Episode der Generationenrevolte, einem klaren Beispiel für das Aufbegehren von »neuen« Jungen, die »Trau keinem über dreißig!« rufen, gegen die erwachsene Gesellschaft: zu den Achtundsechzigern. Abgesehen von den amerikanischen Blumenkindern, die sich an der Botschaft des alten Marcuse orientierten, bezeugen die Slogans der italienischen Demonstranten (»Viva Marx! Viva Lenin! Viva Mao Tsetung!«), wie sehr die Revolte es nötig hatte, sich Riesen an die Seite zu holen, um gegen den Verrat der Väter der parlamentarischen Linken zu protestieren, und sogar der puer senilis war wieder da – in Gestalt der Ikone des jung gestorbenen Che Guevara, der durch seinen Tod zum Träger jedweder altväterlich-antiken Tugend erhöht worden war.
Doch in der Zeit zwischen Achtundsechzig und heute ist etwas geschehen, und das wird uns bewusst, wenn wir ein Phänomen analysieren, das manche schon oberflächlich als neues Achtundsechzig deuten, nämlich die Anti-Globalisierungsbewegung. In der Presse wird häufig das größte Gewicht auf ihre jugendlichen Komponenten gelegt, in denen sich diese Bewegung jedoch keineswegs erschöpft, denn es gibt in ihr offensichtlich auch über Siebzigjährige. Die Bewegung von Achtundsechzig war tatsächlich eine Jugendbewegung, der sich höchstens ein paar unangepasste Erwachsene anschlossen, die mit bedeutsamer Geste die Krawatte gegen den Rollkragenpulli und den gepflegten Vollbart gegen eine befreiend wildwachsende Haartracht tauschten. Aber einer der ersten Slogans dieser Bewegung war, wie gesagt, die Ermahnung, trau keinem über dreißig. Die Anti-Globalisierungsbewegung ist jedoch zum großen Teil kein Generationsphänomen, ihre Anführer sind reife Erwachsene wie José Bové oder Veteranen anderer Revolutionen. Sie repräsentiert keinen Generationenkonflikt, auch keinen Streit zwischen Tradition und Erneuerung, sonst müsste man (ebenso oberflächlich) sagen, die Erneuerer seien die Technokraten der Globalisierung und die gegen sie Demonstrierenden die laudatores temporis acti mit maschinenstürmerischen Neigungen. Was seit den Protesten in Seattle 1999 bis zu denen gegen den G8-Gipfel in Genua 2001 geschehen ist, stellt zwar eine ganz neue Form von politischer Konfrontation dar, aber diese Konfrontation verläuft quer zu den Generationen wie auch zu den Ideologien. In ihr stehen sich zwei Forderungen gegenüber, zwei Visionen über das Schicksal der Welt, man könnte sagen: zwei Mächte, deren eine auf dem Besitz der Produktionsmittel basiert und die andere auf der Erfindung neuer Kommunikationsmittel. Doch in der Schlacht, in der die Globalisierer den Tute bianche*2 gegenüberstehen, verteilen sich Junge und Alte gleichmäßig auf beide Seiten, und die Dreißigjährigen der New Economy stehen den Dreißigjährigen der Sozialen Zentren gegenüber, jeder mit den eigenen Eltern an seiner Seite.
Der Grund dafür ist, dass sich in den über dreißig Jahren, die zwischen Achtundsechzig und der Schlacht gegen die G8 vergangen sind, ein Prozess vollendet hat, der lange zuvor begonnen hatte. Versuchen wir seine innere Mechanik zu verstehen. Um eine Dialektik zwischen Vätern und Söhnen in Gang zu setzen, bedurfte es zu allen Zeiten eines starken Vatermodells, dem gegenüber die Provokation des Sohnes so beschaffen war, dass der Vater sie nicht akzeptieren konnte, auch nicht die in ihr erfolgte Wiederentdeckung vergessener Riesen. Die poetae novi konnten nicht akzeptiert werden, quia nuper, wie Horaz sagte, eben weil sie neu waren, ihre Sprache war inakzeptabel für die hochtrabenden Latinisten an den Universitäten; Thomas von Aquin und Bonaventura betrieben die Erneuerung heimlich in der Hoffnung, dass niemand es merken würde, aber die Feinde der Bettelorden an der Universität in Paris bemerkten es bald und versuchten, über ihre Lehren den Bann zu verhängen. Und so ging es weiter bis zu Marinettis Rennwagen, der nur deshalb der Nike von Samothrake gegenübergestellt werden konnte, weil die braven Bürger in ihm noch nichts anderes als einen hässlichen Haufen rostiger Blechteile sahen.
Die Modelle müssen daher generationsbezogen sein. Die Väter mussten die bleichen Venusfiguren von Lucas Cranach verehrt haben, damit sie die zellulitischen Venusfiguren von Rubens als Beleidigung der Schönheit empfinden konnten; die Väter mussten Maler wie Alma-Tadema geliebt haben, damit sie die Söhne fragen konnten, was zum Teufel denn diese Kritzelei von Miró bedeuten solle oder die Wiederentdeckung der afrikanischen Kunst; die Väter mussten sich nach Greta Garbo verzehrt haben, damit sie die Söhne empört fragen konnten, was sie an diesem Äffchen Brigitte Bardot so toll fanden.
Doch heute haben die Massenmedien, besonders die mediale Aufrüstung der Museen, die auch von den Ungebildeten früherer Zeiten besucht werden, eine gleichzeitige Präsenz und synkretistische Akzeptanz aller Modelle geschaffen, um nicht zu sagen aller Werte. Wenn Megan Gale im Werbespot einer Telefongesellschaft durch die Kuppeln und Bögen des Guggenheim-Museums in Bilbao wirbelt, ist sie sowohl als sexuelles wie als artistisches Modell reizvoll für alle Generationen, das Museum ist sexuell ebenso begehrenswert wie Megan und Megan ein ebensolches Kulturobjekt wie das Museum, da beide im Amalgam einer filmtechnischen Erfindung leben, die den gastronomischen Charakter des Werbeappells mit der ästhetischen Kühnheit dessen vereint, was einst nur ein Film für Cineasten war.
Zwischen neuen Versuchen und Nostalgieübungen verallgemeinert das Fernsehen generationsübergreifend Modelle wie Che Guevara und Mutter Teresa, Lady Diana und Pater Pio, Rita Hayworth, Brigitte Bardot und Julia Roberts, den supervirilen John Wayne der Vierzigerjahre und den sanften Dustin Hoffman der Sechziger. Der schmale Fred Astaire der Dreißigerjahre tanzt in seinen Vierzigern mit dem eher kompakten Gene Kelly, die Leinwand bringt uns ins Träumen angesichts femininer Glitzergewänder, wie wir sie in dem Film Roberta vorüberziehen sehen, und der androgynen Models von Coco Chanel. Wem die raffinierte männliche Schönheit von Richard Gere nicht zusagt, für den gibt es den feinen Zauber von Al Pacino und die proletarische Sympathie von Robert De Niro. Wer sich die Majestät eines Maserati nicht leisten kann, für den gibt es die elegante Nützlichkeit des Mini Morris.
Die Massenmedien präsentieren heute kein allgemeingültiges Modell mehr. Sie können sich, selbst in einer Werbeaktion, die nur eine Woche dauert, alle Erfahrungen der Avantgarde zunutze machen und gleichzeitig eine Ikonografie des 19. Jahrhunderts wiederentdecken, sie bieten uns den Märchenrealismus der Rollenspiele und die verdrehten Perspektiven von M.C. Escher, die Opulenz von Marilyn Monroe und die schwindsuchtverdächtige Grazie der neuen Top Models, die afrikanische Schönheit von Naomi Campbell und die nordische von Claudia Schiffer, die Grazie des traditionellen Stepptanzes in A Chorus Line und die schaurig-futuristischen Architekturen in Blade Runner, die Androgynie von Jodie Foster und die Natürlichkeit von Cameron Diaz, Rambos und Dragqueens, George Clooney (den sich alle Väter als frisch in Medizin promovierten Sohn wünschen) und die Neo-Cyborgs, die ihr Gesicht aus Metall formen und ihre Haare in einen Wald aus farbigen Spießen verwandeln.
Angesichts dieser Orgie der Toleranz, dieses absoluten und unaufhaltsamen Polytheismus, wo gibt es da heute noch die Wasserscheide, die zwischen Vätern und Söhnen verläuft und Erstere zum Saturn-Komplex sowie Letztere zum Vatermord zwingt (der sowohl Rebellion als auch Huldigung ist)?
Wir stehen noch ganz am Anfang dieses Trends, aber denken wir nur einen Augenblick an den ersten Auftritt des Personalcomputers und dann des Internets. Der Computer wurde von Vätern in die Häuser gebracht, sei es auch nur aus ökonomischen Gründen. Die Söhne wiesen ihn nicht zurück, sondern bemächtigten sich seiner und konnten bald besser mit ihm umgehen als die Väter. Aber keiner der beiden sah oder sieht in ihm das Symbol einer Rebellion oder einer Ablehnung des anderen. Der Computer trennt die Generationen nicht, er verbindet sie eher. Niemand verflucht seinen Sohn, weil er im Internet surft, und niemand opponiert deshalb gegen seinen Vater.
Nicht dass es an Innovationen fehlte, aber es sind fast immer technische Innovationen, die von einem internationalen, gewöhnlich von älteren Männern beherrschten Produktionszentrum eingeführt werden und dann Wellen schlagen, die von den jüngeren Generationen begrüßt und aufgegriffen werden. Man spricht heute von einer neuen Jugendsprache der Mobiltelefone und E-Mails, aber ich könnte zehn Jahre alte kritische Aufsätze zitieren, in denen genau diejenigen, die diese neuen Instrumente erfunden haben, oder auch ältere Soziologen und Semiotiker, die sie studierten, die Voraussage trafen, dass sie genau die Sprache und die Formeln erzeugen würden, die dann tatsächlich entstanden sind. Und als Bill Gates noch ein junger Mann war (heute ist er ein reifer Herr, der den Jungen genau die Sprache beibringt, die sie sprechen sollen), hat er auch als Junger nicht eine Revolte erfunden, sondern ein kluges und wohldurchdachtes Angebot, um sowohl Väter wie Söhne dafür zu interessieren.
Bedenken wir, dass die selbstmarginalisierten Jugendlichen sich ihren Familien durch die Flucht in die Droge entziehen, aber diese Flucht in die Droge ist das Modell, das ihnen die Väter vorgesetzt haben, schon seit den Zeiten der künstlichen Paradiese im 19. Jahrhundert. Die neuen Generationen beziehen ihren Input von der erwachsenen Internationale der Drogenhändler.
Sicher, man könnte sagen, es ist ja nicht so, dass es keine Gegenmodelle gäbe, sondern nur immer schnellere Ersetzung der vorhandenen. Aber das ändert nichts. Für sehr kurze Zeit kann ein bestimmtes Kultmodell der Jugend (von Pier Paolo Pasolini bis hin zu Nike-Schuhen) den Vätern unerträglich erscheinen, aber die Schnelligkeit seiner medialen Verbreitung führt dazu, dass es binnen Kurzem auch von den Älteren angenommen wird, mit höchstens der Gefahr, dass es nach ebenso kurzer Zeit den Söhnen lächerlich vorkommt. Aber niemand hat Zeit genug, sich diesen Staffellauf bewusst zu machen, und das weltweite Resultat bleibt immer der absolute Polytheismus, das synkretistische Nebeneinander aller Werte. War »New Age« eine generationsbedingte Erfindung? Inhaltlich ist es eine Collage jahrtausendealter Esoterismen. Mag sein, dass anfangs Gruppen von Jugendlichen gegen sie aufbegehrt haben wie gegen eine neue Schar wiedergefundener Riesen, aber sehr bald ist die Verbreitung von Bildern, Tönen, typischen Glaubensinhalten des New Age mit all ihren disko- und kinematografischen, editorialen und religiösen Paraphernalien von alten Hasen der Massenmedien betrieben worden, und wenn ein Jugendlicher in den Orient flieht, dann um sich in die Arme eines uralten Gurus mit vielen Geliebten und zahlreichen Cadillacs zu werfen.
Was als krasseste Form der Abgrenzung erscheint, der Ring durch die Nase, das Piercing in der Zunge oder die blauen Haare, ist in dem Maße, in dem es nicht mehr Erfindung einiger weniger, sondern universales Modell ist, den Jugendlichen von gerontokratischen Zentren der internationalen Mode vorgesetzt worden. Und bald wird die Macht der Massenmedien es auch ihren Eltern aufoktroyieren, es sei denn, Junge und Alte lassen irgendwann gemeinsam davon ab, einfach weil ihnen klar wird, dass man mit einem Stift in der Zunge schlecht Eis essen kann.
Warum also sollten die Väter heute noch ihre Söhne verschlingen, warum die Söhne ihre Väter erschlagen? Das Risiko für beide, bei dem keiner schuldlos wäre, ist, dass bei einer ununterbrochenen und ununterbrochen allseits akzeptierten Erneuerung Scharen von Zwergen auf den Schultern anderer Zwerge säßen. Aber seien wir realistisch: In einer normalen Epoche müsste bis dahin ein Generationswechsel eingetreten sein, und dann wäre ich schon pensioniert.
Sehr gut, wird man sagen. Wir sind in eine neue Epoche eingetreten, in der mit dem Untergang der Ideologien, dem Verblassen der traditionellen Trennlinien zwischen rechts und links, Progressiven und Konservativen, auch endlich jeder Generationskonflikt an Kraft verliert. Aber ist es biologisch empfehlenswert, dass die Revolte der Söhne nur eine oberflächliche Anpassung an die von den Vätern vorgesehenen Rebellionsformen ist und dass die Väter ihre Söhne nur dadurch verschlingen, dass sie ihnen die Räume für eine bunte Randexistenz schenken? Wenn das Prinzip des Vatermords selbst in die Krise gerät, mala tempora currunt.
Aber die schlimmsten Diagnostiker jeder Epoche sind immer die Zeitgenossen. Meine Riesen haben mich gelehrt, dass es Durchgangszonen gibt, in denen die Koordinaten fehlen und man nicht sehr gut in die Zukunft sieht, weshalb man die Listen der Vernunft und die unmerklichen Komplotte des Zeitgeists*3 noch nicht versteht. Vielleicht bildet sich das heilsame Ideal des Vatermords gerade in anderen Formen neu, vielleicht werden sich in künftigen Generationen geklonte Söhne auf noch unvorstellbare Weise gegen ihre gesetzlichen Väter und ihre Samenspender erheben.
Vielleicht lauern im Schatten schon Riesen, die wir noch nicht kennen, bereit, sich auf die Schultern von uns Zwergen zu setzen.
[Vortrag im Rahmen der Milanesiana 2001]
Über Schönheit
Im Jahr 1954 habe ich meinen Doktor mit einer Arbeit über das Problem des Schönen gemacht, wenn auch beschränkt auf die wenigen einschlägigen Seiten bei Thomas von Aquin. 1962 habe ich das Projekt eines Bildbandes zur Geschichte der Schönheit angestoßen, das der Verlag dann später, obwohl bereits ein Viertel oder zumindest ein Fünftel der Arbeit getan war, aus banalen wirtschaftlichen Gründen aufgab. Vor einigen Jahren habe ich das Projekt für eine CD-ROM wieder aufgegriffen, dann auch für ein Buch, aus dem einfachen Grund, dass ich Sachen nur ungern halbfertig liegen lasse. Wenn ich also bedenke, dass ich mir in den letzten fünfzig Jahren wiederholt Gedanken über den Begriff der Schönheit gemacht habe, fällt mir auf, dass ich diesbezüglich heute wie damals problemlos wiederholen könnte, was Augustinus auf die Frage »Was ist Zeit?« antwortete: »Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es, aber wenn ich es einem erklären will, der mich danach fragt, weiß ich es nicht.«
Getröstet habe ich mich über meine Unsicherheiten hinsichtlich der Definition von Schönheit, als ich 1973 in einem dem Kunstbegriff gewidmeten schmalen Band der Enciclopedia filosofica ISEDI las, wie Dino Formaggio Kunst definierte: »Kunst ist alles, was die Menschen Kunst genannt haben.« Entsprechend würde ich sagen: »Schön ist alles, was die Menschen schön genannt haben.«
Ein relativistischer Ansatz, gewiss – was man als schön empfindet, hängt vom Zeitgeschmack und von den Kulturen ab. Auch handelt es sich nicht um eine moderne Häresie. Denn schon in einem berühmten Passus des Vorsokratikers Xenophanes von Kolophon heißt es (nach Clemens von Alexandria, Stromateis V, 109): »Aber wenn Rinder und Pferde und Löwen Hände hätten wie Menschen / und mit den Händen zu malen und Werke zu schaffen vermöchten, / malten sie wohl auch Bilder der Götter und machten die Körper / so, wie ein jeder von ihnen selbst ist am Körper gestaltet: / Pferde malten sie ähnlich den Pferden und Rinder den Rindern.«1 Wie Voltaire sagte: Das Schöne an der Kröte ist ihre Krötenhaftigkeit.
Schönheit ist nie etwas Absolutes und Unveränderliches gewesen, sondern erhielt je nach Epoche und Land unterschiedliche Gesichter, und dies nicht nur in Hinblick auf die physische Schönheit (des Mannes, der Frau, der Landschaft), sondern auch auf die Schönheit Gottes, der Heiligen, der Ideen …
Man braucht nur die folgenden Zeilen von Guido Guinizelli zu zitieren und sie einer mehr oder minder zeitgenössischen gotischen Skulptur wie der wunderschönen Uta von Naumburg zur Seite zu stellen:
Vedut’ho la lucente stella diana,
ch’appare anzi che ’l giorno rend’albore,
[…]
viso de neve colorato in grana,
occhi lucenti, gai e pien’ d’amore;
non credo che nel mondo sia cristiana
sì piena di biltate e di valore.
[Die Venus sah am Morgenhimmel prangen
ich kaum dass von der Nacht sie ausgeruht,
…
das Antlitz weiß wie Schnee, mit roten Wangen,
die Augen, liebreich strahlend, frohgemut;
und keine Frau, dünkt mich, wie sie umfangen
von solcher Schönheit, solchem Edelmut.]
Und dann überzugehen zu diesem Bild aus dem 19. Jahrhundert von Redon und einem Zitat aus Léa (1832) von Barbey d’Aurevilly: »Aber ja doch! Doch! Meine Léa, du bist schön, du bist das schönste aller Geschöpfe! Ich würde dich nicht hergeben, dich, deine gequälten Augen, deine Blässe, deinen kranken Körper, ich würde dich nicht gegen die Schönheit der himmlischen Engel eintauschen wollen.«
Naumburger Dom Detail der Statue der Uta von Ballenstedt, 13. Jahrhundert
Odilon Redon (1840–1916) L’apparitionPrivatsammlung
Pablo PicassoPortrait de Dora Maar, 1937 Paris, Musée Picasso
Können Sie zwischen diesen beiden Ideen der Schönheit einen Zusammenhang entdecken?
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, nicht unserem zeitgenössischen Geschmack zu erliegen. Manch junger Mann unserer Zeit, mit Ohrring und vielleicht Nasenstecker, mag eine Botticelli-Schönheit faszinierend finden, weil sie ihm entzückend verrucht von Cannabis besäuselt erscheint, doch war das gewiss nicht so für die Zeitgenossen, die das Antlitz der Primavera, wenn überhaupt, dann aus ganz anderen Gründen bewunderten.
Und was verstehen denn wir darunter, wenn wir von Schönheit sprechen? Wir Menschen unserer Zeit, oder wenigstens wir durch die idealistische Ästhetik beeinflussten Italiener setzen Schönheit nahezu immer mit künstlerischer Schönheit gleich. Jahrhundertelang sprach man jedoch vom Schönen vor allem im Zusammenhang mit der Schönheit der Natur, der Schönheit von Gegenständen, von menschlichen Körpern oder von Gott. Kunst war recta ratio factibilium, das richtige Verfertigen von Dingen, doch techne oder ars bezeichnete sowohl die Kunst des Malers als auch die des Schiffsbauers oder sogar die des Barbiers (und erst viel später hat man begonnen, von den Schönen Künsten oder Beaux Arts zu sprechen).
Gleichwohl haben wir zum Schönheitsideal einer gegebenen historischen Epoche heute nur drei Arten von Zeugnissen, und alle stammen aus »gebildeten« Quellen. Wenn heute oder in tausend Jahren ein außerirdischer Besucher auf die Erde käme, könnte er aus Filmen, Illustrierten und Fernsehprogrammen darauf schließen, welche Art von Schönheit die einfachen, ungebildeten Leute unserer Zeit an menschlichen Körpern, Kleidern und Gegenständen schätzten. Doch wir befinden uns gegenüber den vergangenen Jahrhunderten in der Lage eines Reisenden aus dem Weltraum, der zur Bestimmung unseres weiblichen Schönheitsideals lediglich Picasso als Zeugnis heranziehen könnte.
Freilich stehen uns auch verbale Zeugnisse zur Verfügung. Aber auch hier stellt sich die Frage: Was sagen uns die Worte? Wenn Proust in der Recherche die Gemälde von Elstir beschreibt, denken wir – wenn wir gut lesen – an die Impressionisten; die Biografen berichten jedoch, Proust habe in einem Fragebogen, den er mit dreizehn Jahren ausfüllte, Meissonier als seinen Lieblingsmaler bezeichnet und diesen auch später immer bewundert. Also erzählte er von der Vorstellung künstlerischer Schönheit eines inexistenten Elstir und dachte dabei vielleicht an etwas ganz anderes als das, was uns seine Worte vermuten lassen.
Dieser Umstand legt uns außerdem ein Kriterium nahe, das man (wollte man Semiotik für Eingeweihte betreiben, was ich meinem wie auch immer geneigten Publikum heute gern ersparen würde) nach Peirce als »Kriterium der Interpretierbarkeit« bezeichnen könnte: Die Bedeutung eines Zeichens wird immer durch ein weiteres Zeichen geklärt, das jenes in gewisser Weise interpretiert. Deshalb können wir Texte, die vom Schönen sprechen, mit zeitgenössischen Bildern vergleichen, die vermutlich schöne Gegenstände darstellen sollen. Das könnte uns zu klareren Ideen über die Schönheitsideale einer bestimmten Zeit verhelfen.
Bisweilen jedoch kann der Vergleich brutal enttäuschend ausfallen. Nehmen wir die Beschreibung einer hinreißend verführerischen Schönheit, als die sie jedenfalls der Erzähler schildert, nämlich der Kreolin Cecily aus Die Geheimnisse von Paris von Eugène Sue (1842–43):
Die von der Kreolin freigegebene dichte, tiefschwarze Haarpracht reichte ihr, in der Mitte gescheitelt und natürlich gelockt, bis zum Halsband der Venus, das den Hals mit den Schultern verband. […] Niemand, der sie einmal gesehen hat, kann Cecilys Gesichtszüge je wieder vergessen […] Über dem reinen Oval ihres Gesichts wölbt sich eine kühne […] Stirn; ihr Teint ist von der matten Helligkeit und samtenen Frische einer von der Sonne gestreiften Kamelienblüte; […] die feine gerade Nase endet in zwei beweglichen Nüstern, die sich bei der geringsten Erregung weiten; der schmachtende, aufreizende Mund ist lebhaft gerötet.2
Wie stellen wir uns diese prächtige Cecily heute vor, wenn wir die Worte in ein Bild übersetzen sollen? Wie eine Brigitte Bardot oder wie eine Femme fatale der Belle Époque? Nun, für den Illustrator der Erstausgabe des Romans (und mit ihm vermutlich auch für dessen Leser) sah Cecily aus wie auf dem hier abgedruckten Bild. Wir müssen uns seinem Vorschlag fügen und unsere Fantasie mit dieser Cecily spielen lassen. Zumindest um zu verstehen, nach welchem Schönheitsideal sich, Eugène Sue und seinen Lesern zufolge, der Notar Ferrand in Satyriasis verzehrte.
Cecily la créole Illustration zu Les mystères de Paris von Eugène Sue, 1851
Der Vergleich zwischen Texten und Bildern ist oft produktiv, weil er uns zu verstehen erlaubt, wie ein und derselbe sprachliche Ausdruck im Übergang von einem Jahrhundert zum nächsten, manchmal von einem Jahrzehnt zum nächsten, unterschiedlichen visuellen oder musikalischen Idealen entsprechen kann. Nehmen wir ein klassisches Beispiel: die Proportion. Pythagoras hat als Erster behauptet, am Grund aller Dinge stehe die Zahl. Mit Pythagoras kommt eine ästhetisch-mathematische Sicht des Universums auf: Alle Dinge existieren, weil sie geordnet sind, und geordnet sind sie, weil in ihnen mathematische und musikalische Gesetze wirksam sind, die ihre Existenz und zugleich ihre Schönheit bedingen. Diese Vorstellung der Proportion wird für die gesamte Antike prägend und gewinnt durch das Werk des Boëthius im 6. Jahrhundert auch Einfluss auf das Mittelalter. Boëthius erzählt, wie Pythagoras eines Tages beobachtete, dass verschiedene Schmiedehämmer auf dem Amboss unterschiedliche Töne hervorbrachten, und erkannte, dass diese Unterschiede proportional zum Gewicht des Hammers waren. Die Größenverhältnisse bei den griechischen Tempeln, die Abstände zwischen den Säulen oder die Verhältnisse zwischen den einzelnen Fassadenteilen entsprechen denselben Proportionen, wie sie bei musikalischen Intervallen zum Tragen kommen. Platon beschrieb dann in seinem Timaios die Welt als zusammengesetzt aus regelmäßigen geometrischen Körpern.
Piero della FrancescaDie Geißelung Christi, 1455 Urbino, Galleria nazionale delle Marche
In Humanismus und Renaissance werden die regelmäßigen platonischen Körper genau als die idealen Modelle studiert und gefeiert, von Leonardo über Piero della Francesca in De prospectiva pingendi (vor 1482) bis Luca Pacioli in De divina proportione (1509).
Albrecht DürerStudie zu den Proportionen des menschlichen Körpers, in: Vier Bücher von menschlicher Proportion, 1528 London, British Library
Leonardo da Vinci Schema der Proportionen des menschlichen Körpers oder Vitruvianischer Mensch, um 1490 Venedig, Gallerie dell’Accademia
Le CorbusierLe modulor, 1950 Paris, Centre Pompidou Musée national d’art moderne Centre de création industrielle
Bei der göttlichen Proportion, von der Pacioli spricht, handelt es sich um den Goldenen Schnitt, jenes Verhältnis, das beispielsweise zwischen zwei Rechtecken besteht, wenn das kleinere sich zum größeren wie das größere zur Summe aus beiden verhält. Genau diese Beziehung wird etwa in der Geißelung von Piero della Francesca wunderbar hergestellt.
Doch meinten all diejenigen, die den Begriff »Proportion« verwendeten, im Laufe der zehn Jahrhunderte, die zwischen Boëthius und Pacioli liegen, immer dasselbe? Durchaus nicht. In den Manuskripten der ersten mittelalterlichen Jahrhunderte, die Boëthius