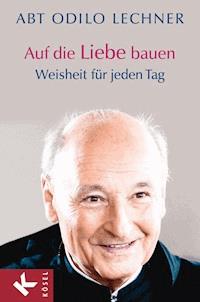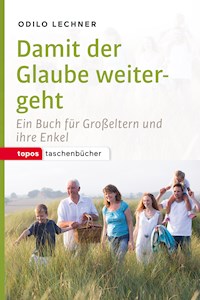Inhaltsverzeichnis
Titel
Wie ich Mönch und Abt wurde
JANUAR
1. Januar
2. Januar
3. Januar
4. Januar
5. Januar
6. Januar
7. Januar
8. Januar
9. Januar
10. Januar
11. Januar
12. Januar
13. Januar
14. Januar
15. Januar
16. Januar
17. Januar
18. Januar
19. Januar
20. Januar
21. Januar
22. Januar
23. Januar
24. Januar
25. Januar
26. Januar
Copyright
»Gott steh’ ihr bei -der Klerikei -die Laien lernen lesen«
So ein bekanntes Zitat des schwäbischen Satirikers Karl Julius Weber (1767-1832), der dieses 1797 an eine Fensterscheibe schnitt, als er sein Zimmer für einen Beichtvater und Hofkaplan seiner Herrschaft räumen musste.
Für lange Zeiten war Lesen-Können ein Privileg der gebildeten Oberschicht sowie des Klerus. Wer lesen konnte, hatte Macht! Von seiner Wortbedeutung leitet sich das deutsche Wort lesen vom altdeutschen lesan ab, was so viel bedeutet wie »verstreut Umherliegendes aufnehmen und zusammentragen, sammeln«. So kennen wir bis heute etwa im Weinbau die Traubenlese, die Auslese oder die Spätlese. Lesen können bedeutet also, sich Wissen anzusammeln, sich zu bilden und sich selbst ein Urteil bilden zu können. Es ist interessant, dass der hl. Benedikt etwa ein Drittel der Tageszeit für die geistliche Lesung reserviert. Ihm geht es dabei weniger um Wissensvermittlung. Die tägliche »Lectio divina« soll der Herzensbildung des Mönches dienen, indem er geistliche Texte meditiert und diese verinnerlicht. Das Buch gehört als Attribut somit wesentlich zum Mönch.
Unseren lieben Jubilar, Abt Odilo, der im Januar 2011 seinen 80. Geburtstag feiert, kann man sich ohne Bücher nicht vorstellen. Als belesener Geistlicher schöpft er aus dem reichen Schatz der christlichen Spiritualität und versteht es in unzähligen Publikationen und Büchern, mit diesem seinen Schatz andere zu beschenken. Für ihn stellt es bestimmt keine Gefahr dar, dass die »Laien« lesen können. Ganz im Gegenteil! Vielmehr macht es ihm Freude, ganz entsprechend der benediktinischen Tradition durch seine Gedanken bildend wirken zu können.
So dürfen wir dankbar sein für dieses Kalenderbuch, das mit seinen sorgfältig ausgewählten Texten einer kostbaren Auslese gleichkommt.
Unserem Jubilar wünschen wir noch viele geistreiche Jahre, in denen wir uns auf seine »Spätlese« freuen dürfen, zählt doch diese häufig zu den »besten Tropfen«.
Dr. Johannes Eckert OSBAbt der Abtei St. Bonifaz in München und Andechs
Wie ich Mönch und Abt wurde
Mein Lebensbericht kann mit etwas Erfreulichem beginnen (das man mit Stolz sagen darf, weil man selbst nichts dazu kann): Ich bin 1931 in München geboren, also der immer seltener werdenden Spezies der Münchner zugehörig. Altbayerisch ist auch die familiäre Herkunft. Mütterlicherseits stammt die Familie aus München und weiter zurück aus dem Werdenfelser Land, väterlicherseits aus Regensburg und der Oberpfalz.
Wie wird aus dem Münchner Kindl in der Wiege ein Vertreter dessen, was »Munichen« im Wappen führt, ein Mönch? Wie wird ein normaler Mensch ein katholischer Geistlicher? Solche Fragen sind ja nicht so leicht zu beantworten und assoziieren oft genug eine Menge falscher Vorstellungen, vom einen Extrem einer außerordentlichen Berufung durch eine Stimme von oben bis zum anderen Extrem, solch ein Entschluss lasse sich nur aus enttäuschter Liebe oder aus Lebensangst erklären. Nun ist es wohl immer etwas Einmaliges, wie einer seinen Beruf und seinen Lebensweg findet. So wuchs auch bei mir in einer langen Entwicklung die Überzeugung, dass der Priesterberuf mir am meisten Freude, Erfüllung und Sinnhaftigkeit geben könnte. Da waren die kindlichen Vorstellungen, in denen noch vor dem vielseitigen Wirken des Priesters das des Trambahnschaffners, Lehrers und Dichters rangierte, da waren Begegnungen mit Priestern, die von ihrem Auftrag ganz erfüllt schienen, da war die Erkenntnis einer stillen Stunde der Nachkriegszeit, dass das Evangelium in einer sich wandelnden Welt das Bleibende und wahrhaft Heilende ist und dass es zu seiner Verkündigung Menschen braucht. Oft sind ganz kleine Begebenheiten prägend. Eine ist mir in Erinnerung geblieben. Es war wohl 1943, als am Münchner Wilhelmsgymnasium gerade die Angriffe des regimetreuen Klasslehrers auf die Katholische Kirche mein Interesse an Geschichte weckten. Ich gehörte damals zur verrufenen Spezies der Fahrschüler, weil wir in den letzten Kriegsjahren auf unser Wochenendhaus in Weßling vor München geflüchtet waren.Als ich so einmal mit dem Mittagszug heimfuhr im Kreis von Kameraden aus anderen Münchner Schulen, saß uns gegenüber ein alter Bauer mit weißem Haar und feinem Gesicht, der uns trotz unseres nicht gerade sanften Benehmens sehr wohlwollend betrachtete und uns schließlich fragte: Geht ihr auf die höhere Schule? Wir bejahten und er fragte weiter: Geht ihr etwa auf das Gymnasium? Die Oberschüler zu meiner Seite verneinten, während ich mit einigem Stolz Ja sagte. Nun wandte sich sein ganzes Interesse mir zu und er fragte wieder: Das ist da, wo man Latein lernt? Und als ich wiederum bejahte, beugte er sich vor und fragte leise:Willst du etwa gar Priester werden? Ich schüttelte den Kopf und er meinte noch mit Wohlwollen, aber doch auch mit Enttäuschung: Das denn doch nicht. Ich habe damals in einer die »Pfaffen« verächtlich machenden Zeit die Sehnsucht des Volkes nach Priestern gespürt und einen Auftrag, den ich damals in keiner Weise als wichtig empfand, der mir aber viel später zur Verpflichtung wurde. Nach dem Krieg, als die Münchner Schulverhältnisse recht unbefriedigend waren, besuchte ich das Benediktiner-Gymnasium in Metten und widmete mich dann - zunächst einmal etwas ins Ungewisse hinein - philosophischen und theologischen Studien in München und Innsbruck.
Warum aber bin ich 1952 in das Benediktinerkloster St. Bonifaz eingetreten? Im Mettener Internat hatte ich benediktinische Lebensart kennengelernt. Der Dienst am Evangelium schien mir in den Orden intensiver, konsequenter und in einer familiären Gemeinschaft wie der benediktinischen menschlicher zu sein. Mich faszinierte auch eine ideale Lebensform, in der das Geistige die ganze Daseinsgestalt trägt, wie es ein Lieblingsdichter so vieler junger Generationen, Hermann Hesse, in seinem »Glasperlenspiel« vor Augen stellt. Freilich zeigt die Erfahrung, dass ideale Entwürfe und Ordnungen immer wieder an den menschlichen Unzulänglichkeiten zerbrechen. Christliche Gemeinschaft, auch und gerade die klösterliche, ist nur tragbar und möglich, weil der Glaube den Herrn in unserer Mitte weiß, der unsere menschliche Schwachheit auf sich genommen hat und trägt.
Abt Hugo Lang gab mir bei der ersten Profess 1953 den Ordensnamen Odilo, wohl um mir ein großes Vorbild aus unserer Hausgeschichte zu geben, P. Odilo Rottmanner, den großen Bibliothekar, Augustinusforscher und Prediger um die Jahrhundertwende. Nach der Priesterweihe 1956 war ich mehrere Jahre als Kaplan in unserer Pfarrei St. Bonifaz tätig, durfte dann aber meine Dissertation vollenden und bis 1964 in Salzburg als Sekretär des Philosophischen Instituts und als Spiritual am Kolleg St. Benedikt wirken. Dass durch diese Ferne meine Mitbrüder in St. Bonifaz meine Fehler nicht lebendig vor Augen hatten, war wohl ein Grund, dass sie mich 1964 zum Abtkoadjutor und Nachfolger von Abt Hugo wählten. In dem Vertrauen des Konvents zu dem damals jüngsten Pater der Gemeinschaft drückt sich wohl auch die Aufgabe aus, die meiner Generation bis heute gestellt ist. Ich empfinde es als Gnade, mich noch der Bedrängnisse der Diktatur und der Kriegs- und Nachkriegsnot zu erinnern, ohne wie die Älteren von ihren Verheerungen geschädigt zu sein. Dem neuen Aufbruch nach 1945 fühle ich mich bis heute verpflichtet.
Dr. Odilo Lechner OSB Altabt der Abtei St. Bonifaz in München und Andechs
JANUAR
1. Januar
Für den Glauben gibt es den großen Rahmen: den einen Ursprung und das eine Ziel der ganzen Geschichte und eine geheime Mitte. Diese Mitte ermöglicht, dass die Menschen zwischen Anfang und Ende ihrer Geschichte nicht verloren umherirren. Er, der Ursprung und Ziel von allem ist, hat sich in diese unsere Geschichte, in unsere Mitte hineingegeben und geht mit uns die irdischen Wege. Das feiern wir an Weihnachten.
2. Januar
Das ist ja der Kern des Weihnachtsgeheimnisses: Gottes Weg führt in Ort und Zeit des Menschen hinein. Das Wort ist Fleisch geworden. Der Mensch kann Ja sagen zu seinem Leben, nicht weil es aus sich so großartig wäre, sondern weil es von Gott angenommen ist. Der Mensch kann sich selbst lieben, weil er geliebt wird. Ich kann den Nächsten lieben wie mich selbst, ich kann meine Zeit und meine Welt lieben, weil ich von dem geliebt werde, der alles liebt.
3. Januar
Die Annahme der Nacht, dass alles versinken darf in Schlaf, ist zugleich auch Einübung ins gelassene Sterben. In dieser Gelassenheit kann der Mönch den Wechsel der Zeiten und seine Vergänglichkeit annehmen und das Kloster als einen Ort des Friedens erfahren, weil er Leben und Heil nicht von den Versprechungen der Mächte dieser Welt und den Paradiesen dieser Zeit, sondern von Gott und von der ewigen Vollendung in ihm erwartet.
4. Januar
Der sichere Platz im Himmel ist nicht erwerbbar. Und doch ist dem Glaubenden etwas ganz sicher: die Liebe, die Gnade, die Treue Gottes. Unendlich schön ist es, sich auf Gott einzulassen, auf Liebe zu bauen, auf das Teilen und Schenken, das bedeutet: sein Leben auf etwas gründen, das unverrückbar, das ewig bleibt.Wenn wir Gottes Liebe als unseren Schatz betrachten, ist unser Herz in Sicherheit trotz aller Gefahren.
5. Januar
Vielleicht entdeckt gerade der Wissende, der, der immer weiter sucht und doch um die tödlichen Grenzen des Menschen weiß, vielleicht entdeckt er, dass zum menschlichen Erkennen, Planen und Tun gläubiges Vertrauen treten muss, wenn sich der Mensch nicht selbst aufgeben will.
6. Januar
So wird es allen gehen, die heute Christus suchen: Sie werden Christus in der Kirche finden, die aus Menschen besteht, bei alltäglichen Menschen in Häusern, in Kirchen, die wie andere Gebäude sind. Und sie werden im Alltäglichen der Kirche, im Alltäglichen der Liturgie, im Menschlichen doch zutiefst das Göttliche sehen, das da verborgen ist. Denn Gott lässt sich finden.
7. Januar
Lebt in uns nicht die Sehnsucht nach Größerem, Kostbarerem, Bleibenderem? So suchen sie in sich selbst, um zu finden, was in ihnen an Kraft und Tiefe steckt, von anderen und auch von ihnen selbst so oft übersehen.
8. Januar
Das Leben hat mich inzwischen gelehrt, dass die Wirklichkeit einerseits noch viel schwieriger und anderseits doch auch viel einfacher ist. Schwieriger, weil jede Lebenssituation doch wieder anders ist als die Fälle, die in Schulbüchern und Gelehrtendisputationen dargestellt werden, einfacher, weil ich oft erfahren habe, dass der Blick auf Jesus viele Fragen beiseitegeschoben hat.
9. Januar
Die Bilder von Europa zeigen gewiss die geprägte Gestalt des Einzelnen, der seine Geschichte immer wieder bestimmt hat, sie zeigen ebenso eindrucksvoll die Kraft der Gemeinsamkeit. Das gilt von den Kathedralen des Mittelalters, an denen Ungezählte aus mehreren Generationen gebaut haben, bis zu modernen Industrieanlagen, Bahnhöfen und Flugplätzen, an denen sich ein vielfältiges Miteinander manifestiert. Gerade in der Erfahrung der Gespaltenheit unserer Welt erwacht die Suche nach einer umgreifenden Einheit, die Ahnung einer solchen verborgenen letzten Einheit, der Koinzidenz der Gegensätze des Nikolaus von Kues.
10. Januar
Wir müssen zurück! Das ist eine immer häufiger werdende Einsicht: zurück zum einfachen Leben, zurück zur Natur, zurück vielleicht zur guten alten Zeit. Lässt sich damit umschreiben, dass die Menschheit wieder nachdenklich wird und zu sich selbst heimfinden möchte?
Der Herr versichert uns, dass er uns vorausgeht, um uns eine Wohnung zu bereiten. Er versichert uns ebenso, dass er wiederkommt. Der Zusammenfall dieser beiden Richtungen bezeichnet das endgültige Daheimsein. Es ist schon bereitet, und es ist doch im Kommen.
11. Januar
Weihnachten bedeutet eine Welt, die sich entwickelt, die die Freiheit von Ja und Nein, von Gut und Böse ermöglicht und die von einer herrlichen wie schrecklichen Freiheitsgeschichte geprägt ist.
Der Herr ist da im Scheitern und im Leiden und in der Verlassenheit am Kreuz von Golgota und damit an jeder Stätte der Verzweiflung, des Elends, der Verfolgung und der Hinrichtung. Er, die Fülle des Seins und der Schönheit, ist da im Grauen des Sterbens und im Zunichtewerden des Todes.Wenn Er da ist, ist Mensch und Welt nicht verloren: Es ist Hoffnung da, die Hoffnung durch den, der aus dem Elend und dem Tod erweckt ist zu neuem Leben. Seine Auferstehung ist der Anfang einer neuen Welt mitten in unserer alten.
12. Januar
In meiner Kindheitserinnerung gehört zu den vielen Schönheiten des Winters das Wunder des Schnees. Über Nacht ist das so vielgestaltige Land in ein einziges neues Kleid gehüllt. Im beschneiten Garten sieht man, wohin die menschlichen und tierischen Hausgenossen schon gegangen sind. Ist dies nicht ein tiefes Verlangen des Menschen, nicht ganz spurlos über die Erde zu gehen? Wir möchten etwas Bleibendes hinterlassen, nicht umsonst gelebt zu haben.
13. Januar
Wir können diese Wirklichkeit des Zerbrechens und Versagens aushalten, nicht im Vertrauen auf unsere eigene Kraft, Zerbrochenes wieder zu heilen, Zerstörtes wieder aufzurichten. Wir können es im Vertrauen auf den, der treu bleibt, auch wenn wir untreu geworden sind, und der aus Gnade neuen Anfang schenkt. Wir können unser Heil nicht finden ohne Bindung an den ewigen Gott, ohne Entscheidung und Entschiedenheit auf unserem Weg durch die Endlichkeit und in der Beständigkeit menschlicher Gemeinschaft.
14. Januar
Das Wunder der Liebe Gottes ist dies: Sie ist wie ein Schneefall, dessen Kleid all unsere Spuren aufnimmt und der doch zugleich immer wieder gnädig verhüllt, sodass wir rein und neu beginnen können.Vor Gottes Angesicht ist nichts umsonst, verloren, in Vergessenheit versunken, verweht in Gottes Liebe ist uns immer wieder ein neuer, reiner Anfang möglich.
15. Januar
Schatzsuche heißt nichts anderes als zu suchen, mit Gott in eine lebendige Beziehung zu kommen. Immer wieder scheint der Schatz verborgen, das Ziel unendlich ferne zu sein. Wir haben keinen Schatz als Besitz in unseren Händen. Aber wir tragen die Sehnsucht nach dem Geheimnis Gottes im Herzen und dürfen uns immer wieder aufmachen, das Heil zu suchen.
16. Januar
Weihnachten ermutigt uns, den kleinen Bereich unseres Herzens groß zu sehen, die Weltbedeutung des scheinbar Singulären und Lokalen zu erfassen, weil wir hier von der Liebe des Unendlichen berührt werden und Antwort geben dürfen. Weihnachten ermutigt uns, der Welt des Konkurrenzkampfes zuzurufen: Werde klein, werde dem Kleinen, dem Kind, dem Letzten gerecht. Was suchen wir die ersten Plätze, wenn Gott den letzten Platz wählt, den kleinsten Ort heiligt und die dunkelste Nacht zur Weihnacht macht?
17. Januar
Hier genau liegt der Ansatz, wo sich ein Leben aus dem Glauben bewähren muss: dass jemand sein Leben aus Gottes Hand als Aufgabe, als Geschenk und als Chance annimmt.
Auf diese Weise kann sich der Mensch im Laufe seines Lebens immer mehr dem in ihm wirkenden Gott zur Verfügung stellen, sodass durch ihn Gutes getan, Licht verbreitet und Frieden gewirkt wird. In der Kraft Gottes kann er schließlich auch Böses durch Gutes überwinden.
18. Januar
Wo einer sich nicht nur blind treiben lässt oder in sinnloser Wut gegen eherne Mauern anrennt, gegen eine Entwicklung sich sträubt, die nicht aufzuhalten ist, wo einer vielmehr voll Liebe ist und seinen Weg bejaht, einen Weg, sich für das Gute zur Verfügung zu stellen, gleichviel, wie stark das Böse auch sein mag, dort ist ein Raum der Freiheit, der durch die Gewalt nicht beseitigt werden kann, der in der Überlieferung die Gewalt überwindet. Scheinbar restlos ausgeliefert und der Gewalt preisgegeben, hat der, der sich selbst in Liebe hingab, sich eingereiht in jene Überlieferung, die der Herr auslöste und die still und sanft alle Fesseln der Macht von innen her aufbricht.
19. Januar
Das Unverzichtbare des Glaubens liegt im lebendigen Verhalten des Menschen. Das Entscheidende am christlichen Glauben, also am Glauben an Christus, ist nicht das Wissen, was ich alles über Jesus sagen kann, sondern wie ich zu ihm stehe. Unverzichtbar ist so für den Christen: dass er sein Leben orientiert an der Gestalt des Jesus von Nazareth; dass Leben und Wort Jesu das eigene Leben verpflichten; dass man glaubt, dass Jesus nicht nur vor zweitausend Jahren die Menschen lieb hatte, sondern dass er jetzt mich meint und liebt, dass der Sinn meines Lebens mir durch ihn aufgeht; dass man darauf vertraut, in der Welt der Zweideutigkeiten durch ihn einen eindeutigen Weg zu haben; dass man sich ihm übergibt im Vertrauen darauf, dass von ihm Leben ausgeht, das durch keinen Tod bedroht ist.
20. Januar
Was wäre das Leben, ohne dass wir etwas anderes als uns selbst erfahren: Welt um uns, Anspruch und Anforderung, Gegensatz und Bestätigung. Nur weil uns andere Menschen ansprechen, lernen wir selbst als Kinder reden, erwacht unser Geist zu seinem Leben. Er wird weit und reich, weil er anderes in sich aufnehmen kann und weil andere uns führen. Unser persönliches Leben vollendet sich erst, wenn wir in Freundschaft und in Liebe ein anderes Ich erfahren, das Du zu uns sagt. In der Begegnung liegen die Freude und Lust unseres Lebens.
21. Januar
Vielleicht sollten wir in den Fremden und in der Situation des neuen Europa, in der Herausforderung der Ärmeren in Europa und der ganz Armen in der Welt nicht nur eine Belastung, eine Bedrohung unseres Wohlstandes sehen, sondern mitten in unserer Müdigkeit und in unserer Hoffnungslosigkeit eine Chance, dass wir zu neuen Aufgaben gerufen werden, dass wir etwas Neuem begegnen und dadurch Heil erfahren.
22. Januar
Der Dienst der Kirche an der Welt kann nicht darin bestehen, dass sich die Kirche dieser Welt anpasst oder in das Gemisch verschiedenster Sehnsüchte und Hoffnungen eingeht, sondern dass sie ihrem Geheimnis treu bleibt. Und dieses Geheimnis ist gerade das ganz Andere dieser Welt. Die immer neu erforderte Reform, Wandlung und Anpassung der Kirche besteht vielmehr darin, zeitbedingte und überholte Anpassungen wieder aufzugeben. Darstellungen des Geheimnisses, die es in einer gewandelten Welt mehr verstellen als sichtbar machen, zurückzunehmen und neue zu formen, niemals aber von der Treue zum Weihnachtsgeheimnis, das die Hoffnung der Welt trägt und bestimmt, zu lassen.
23. Januar
Seit Weihnachten findet der Mensch inmitten des irdischen Raumes immer schon mehr. Die Welt, die diese Botschaft einmal erfahren hat, kann sie gewiss verschütten, ablehnen und pervertieren; die Sehnsucht nach diesem Mehr bleibt und lässt sie unruhig in die Zukunft wandern. Sosehr der an Weihnachten vorbeigeht, der fühlend oder denkend in ferne Höhen schweift und nicht weiß, dass das Ferne und Hohe Fleisch geworden ist, ebenso geht der am Menschen vorüber, der ihn auf das reduziert, was nur menschlich ist, und sein weihnachtliches Geheimnis ignoriert.
24. Januar
Judentum und Christentum leben vom Wort, von der Sprache, vom Anruf Gottes und der Antwort des Menschen. Aber sie wissen auch um die Begrenztheit des Menschen, seiner Erkenntnis und seiner Sprache. Sie wissen, dass Gott der Unaussagbare ist und der Unbegreifbare. So wird auch unser Beten immer wieder das Ungenügen unserer Worte spüren. Je tiefer und echter es wird, desto mehr wird es verstummen.
25. Januar
Für jedes Leben ist schon immer von Gott das Wort gesprochen, das es ganz einfordert, um es schön und sinnvoll zu machen. Aber um es in seiner vollen Klarheit zu vernehmen, bedarf es wohl eines lebenslangen wachen Hörens, eines immer wieder neuen Fragens, Suchens, Betens. Dem, der sich so bemüht, wird es wohl geschehen, dass ihm immer wieder ein Stück seines Weges deutlich wird und dass das Ziel allmählich klarere Gestalt gewinnt. Die Kreise werden enger, führen näher an den Mittelpunkt heran.
26. Januar
Glaube heißt: Not und Bedrängnis, Dunkel und Bitternis sehen und doch darin eine Verheißung spüren. Die Weihnachtsgeschichte erzählt davon, wie menschliche Pläne durchkreuzt werden, wie etwa Josefs Vertrauen auf eine glückliche Zukunft mit seiner Braut Maria jäh enttäuscht wird, wie neues menschliches Leben auf Ablehnung und Verfolgung stößt. Aber die Engel eröffnen einen Blick auf tiefere Wirklichkeiten: Die durchkreuzten menschlichen Pläne werden zum Heilsplan Gottes, das gestörte private Glück verändert sich zur unendlichen Freude, am umfassenden Glück der Menschheit mitzuwirken.
Copyright © 2010 Kösel-Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Texte aus: Das Geheimnis erfahren. Mit Abt Odilo durch das Jahr, hg. v. Michael Langer u. Anselm Bilgri, München, Kösel-Verlag 2000 Umschlag: Kaselow Design, München Umschlagmotiv: Kaufmann Grafikdesign, Miesbach
eISBN 978-3-641-06231-6
Weitere Informationen zu diesem Buch und unserem gesamten lieferbaren Programm finden Sie unterwww.koesel.de
Leseprobe
www.randomhouse.de