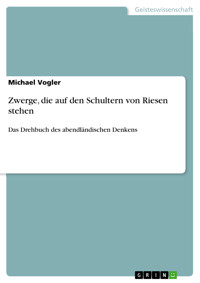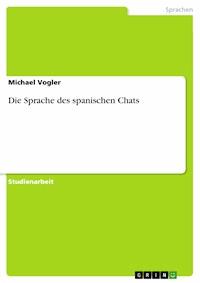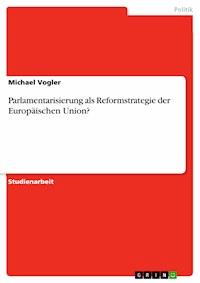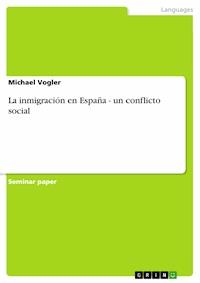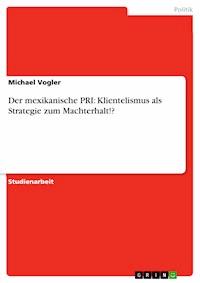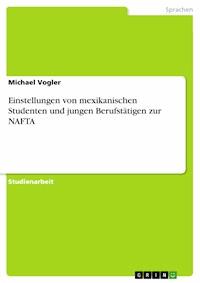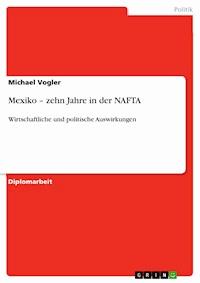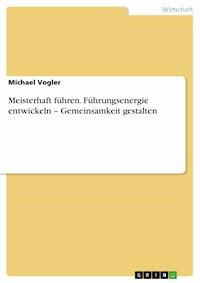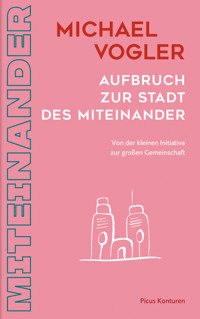
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Picus Konturen
- Sprache: Deutsch
Politik, vor allem Lokalpolitik kann sich nicht darin erschöpfen, Bewohnerinnen und Bewohnern fertige Lösungen nach technokratischen oder ideologischen Vorgaben vorzusetzen. Erfolgreiche Entwicklungsprojekte binden die Betroffenen ein, ja entstehen vielleicht sogar aus deren Mitte. Verantwortungsvolle Politik muss daher Menschen zusammenzuführen, um zu einem neuen Miteinander zu finden. Doch wie fängt man das an? Welche Voraussetzungen sind erforderlich, damit dieses Kunststück gelingt? Michael Vogler beschreibt den Ausgangspunkt für einen hoffnungsvollen Start, erörtert das dafür notwendige Handwerkszeug und führt die vier Schritte erfolgreicher Umsetzung aus. Viele eindrucksvolle internationale Beispiele aus der Praxis – von Augsburg bis Bilbao – beschreiben die erfolgreichsten Strategien von der Vorbereitung bis zur Umsetzung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Picus KonturenHerausgegeben von Georg Hauptfeld
Copyright © 2025 Picus Verlag Ges.m.b.H.Friedrich-Schmidt-Platz 4/7, 1080 [email protected]
Alle Rechte vorbehaltenGrafische Gestaltung: Buntspecht, WienISBN 978-3-7117-3501-0eISBN 978-3-7117-5532-2
Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
MICHAEL VOGLER
AUFBRUCH ZURSTADT DESMITEINANDER
VON DER KLEINEN INITIATIVE ZUR GROSSENGEMEINSCHAFT
PICUS VERLAG WIEN
INHALT
1. TEIL: WAS DIE GESELLSCHAFT ZUSAMMENHÄLT
Worum es geht
1. WENN DIE SAAT DES MITEINANDER AUFGEHT
Geteilte Emotionen sind der Kitt der Gesellschaft
Der Orientierungsverlust schafft Raum für neues Miteinander
Urbanes Miteinander als Antithese zur Vereinzelung
Erfolgreiche Miteinander-Initiativen haben Gemeinsamkeiten
2. MITEINANDER IST EIN WEG UND KEIN ZIEL
Wie ein Kürbis die Welt verändert
Ein neues Wir-Gefühl entsteht
Wir bauen uns die Brücke selbst
Erfolgsintelligenz und Ermöglichung
Der Weg zum Gestalter
Der Weg ist wichtiger als das Ziel
Funktion und Aufgabe sozialer Navigatoren
2. TEIL: DAS WERKZEUG / WORAUF ZU ACHTEN IST
1. DER WOHNORT ALS MENTALER RAUM
Der mentale Raum erzeugt Orientierung
Altenburg schafft sich einen neuen Bedeutungsraum
Wenn mentale Räume ihre Strahlkraft verlieren
Carmen verzaubert die Welt um einen Augsburger Spielplatz
Das Wunder von Bilbao und die Arbeiterhelme in der Bar
Gemeinde ist ein lebender Organismus
2. WIE WIR DIE WELT DENKEN, SO IST SIE UNS
Auf der Suche nach dem verlorenen Engagement
Halb voll oder halb leer, das ist die Frage
Die Welten des halb leeren Glases
Die Welten des halb vollen Glases
Die Gesellschaft ist auf der Suche nach neuem Halt
Die Legende von den langen Löffeln
3. EMOTIONEN HALTEN DIE GEMEINSCHAFT ZUSAMMEN
Der Astronaut mit der roten Nase
Nähe und Beziehung sind Elixiere des guten Lebens
Der Stolz, ein Vorreiter zu sein
Neugier ermöglicht den ersten Motorflug
Begeisterung synchronisiert die Gesellschaft
Von wehenden Geistern und fliegenden Fischen
Die grünen Wiesen jenseits des Gewohnten
Der Geist, mit dem du deine Gemeinde fütterst
3. TEIL: DIE VIER PHASEN DER UMSETZUNG
1. WOHIN SOLL DIE REISE GEHEN?
Eine Gemeinde entwickelt Gemeinsinn
Die Kraft folgt der Aufmerksamkeit
Der Markenkern der Entwicklung
Was eine Vision stark macht
2. WELCHER WEG BRINGT UNS ANS ZIEL?
Perspektiven schaffen
Der beste Weg zum Gemeinsinn
Die konsequente Wir-Strategie
Strategische Werkzeuge für ein Klima des Miteinander
3. WAS BRAUCHEN WIR DAZU?
Suche nette Leute!
Resonanz ist Pflicht
Der Empfänger entscheidet über die Wirkung
Das Yoga des Fragens
Die Signatur des Miteinander
Medien schaffen Bestätigung
Ein Gravitationszentrum für das Miteinander einrichten
Das Schwammerl-Prinzip
Initiativen gehören sich selbst
4. WIE PACKEN WIR ES AN?
Was bringt Menschen ins Tun?
Vom politischen und wirtschaftlichen Nutzen sozialen Kapitals
Struktur folgt Strategie
Auf dem Weg zu gelebtem Miteinander
Es geht um geeignete Emotionen
LITERATUR
DER AUTOR
1. TEILWAS DIE GESELLSCHAFT ZUSAMMENHÄLT
WORUM ES GEHT
Dieses Buch will Mut machen und zeigen, dass die »Mission Impossible« doch möglich ist. Wenn es Sie, geschätzter Leser, auf die eine oder andere Idee bringt oder Sie ermutigt, selbst eine Initiative ins Leben zu rufen, dann wäre seine Aufgabe erfüllt.
Im ersten Teil dieses Buches geht es um die Bedeutung von gelingendem Miteinander für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft. Konkrete Beispiele zeigen, worauf es für eine erfolgreiche Umsetzung von Wir-Strategien ankommt. Im zweiten Teil wird das dafür notwendige Handwerkszeug beschrieben. Zunächst werden erfolgreiche Umsetzungen aus Kommunen unterschiedlicher Größe analysiert. Die Frage nach geeigneten Grundhaltungen im Gemeinwesen wird ebenso behandelt wie die Bedeutung und die Förderung günstiger emotionaler Grundstimmungen. Der dritte Teil befasst sich damit, wie ein erfolgreicher Prozess Schritt für Schritt entwickelt, initiiert und umgesetzt werden kann.
1. WENN DIE SAAT DES MITEINANDER AUFGEHT
Stellen Sie sich eine Gemeinde, einen Marktflecken oder eine Stadt vor, in der Miteinander und Gemeinsinn gelebte Realität sind. Einen Ort also, in dem die Menschen aufeinander achten und füreinander da sind. Wo ein starkes Gemeinschaftsgefühl herrscht, wo nachbarschaftliche Unterstützung und Hilfe niemals weit sind. Wo die Menschen zufrieden sind, sich angenommen fühlen und wo der »Grad des Lächelns« hoch ist.
An einem solchen wohltuenden Ort sind Menschen nachweislich gesünder, fröhlicher und kreativer.
Wir spüren, dass um uns herum viele Veränderungen stattfinden und dass wir mehr Miteinander, Gemeinsinn und Gemeinschaft brauchen, um die Zukunft konstruktiv und positiv gestalten zu können. Wir bemerken immer deutlicher, dass der Weg ins Auseinander und in die Spaltung nicht zukunftsfähig ist, sondern nur Zwietracht und Misstrauen hervorbringt.
Von welcher Seite man es auch betrachten mag, es lohnt sich jede Bemühung, die Nähe und Vertrauen fördert, ein allgemeines Gefühl von Selbstwirksamkeit vermittelt und Zuversicht stärkt.
Aber wie geht das? Worauf ist zu achten? Und was braucht man, damit eine solche Entwicklung sich entfalten kann, Kraft bekommt und schließlich die Grundstimmung in der Gemeinde ausmacht?
Der Bürgermeister von Tulln an der Donau, der Stadt, in der ich lebe, wollte sich auf das Wagnis einlassen, diesen Weg zu beschreiten. In seiner Neujahrsansprache 2018 rief er eine Initiative zur Förderung von Miteinander in der Gemeinde aus.
Diese Initiative wurde von einer Journalistin als »Mission Impossible« bezeichnet. Sie hielt es für unmöglich, das Lebensgefühl und die Ausstrahlung einer ganzen Stadt positiv verändern zu können.
Mir hingegen erschien es durchaus möglich. Seit über drei Jahrzehnten beschäftige ich mich in Unternehmen jeder Größenordnung – darunter Großunternehmen, soziale Organisationen und NGOs – mit der Veränderung der Organisationskultur. Viele derartige Projekte habe ich selbst geleitet. Die Erfahrung sagte mir, dass dieses städtische Unterfangen sehr wohl Aussicht auf Erfolg hat, sofern es richtig aufgesetzt wird. So wurde ich Teil der Projektleitung und begleitete diesen Prozess sechs Jahre lang.
Dieselbe Erfahrung sagte mir aber auch, dass ein solches Projekt nicht mit Ankündigungen allein gelingen würde. Die Auffassung von politischer Arbeit und ihren Aufgaben muss dafür erweitert werden. In der Gemeinde wie im Unternehmen muss man sich für den Erfolg solcher Projekte zunächst mit dem Managementstil beschäftigen. Der Verwaltungsapparat muss dafür an manchen Ecken seine standardisierten Vorgehensweisen anders gestalten.
Projekte dieser Art spielen sich auf der Beziehungsebene ab. Verbesserungen kann man sich wünschen. Man kann Angebote machen, wo Leute einander begegnen können. Die Entscheidungshoheit, ob sie sich auf ein besseres Miteinander einlassen, liegt aber bei den Menschen selbst. Das Erfolgsgeheimnis ist, sie auf eine Reise mitzunehmen und selbst gestalten zu lassen.
Freiwilligkeit braucht Freiheit. Aber sie braucht zugleich einen Führungsstil, der Partizipation erlaubt, fördert und koordiniert, damit ein sozialer Prozess seine Richtung behält. Und sie braucht konkrete Gesichter, die für Richtung und Kontinuität stehen.
Wenn eine Gemeinde ein Klima von Gemeinsamkeit und Miteinander entwickeln oder bestehende Grundhaltungen verbessern will, dann bedeutet das, dass diese Gemeinde als Ganzes lernt. Solches »Lernen« funktioniert nicht wie im Schulunterricht, wo der Lehrer etwas erzählt und die Schüler fleißig mitschreiben. Eine soziale Gemeinschaft ist ein Organismus, in dem alle mitdenken und Ideen oder auch Widerstände entwickeln. Ein vielstimmiges Hintergrundsummen aus verschiedenen Meinungen und Haltungen durchzieht die Gemeinschaft.
Ein solcher Prozess braucht Zeit. Er braucht langfristiges Denken, um Erfolg generieren zu können. Deshalb wird jemand, der gewohnt ist, kurzfristig zu denken, dieses Summen als Störung empfinden, die ihn nur aufhält. Aber dieses Summen ist die Basis, auf der gearbeitet werden muss, wenn Bemühungen akzeptiert werden sollen, damit sich schließlich das notwendige Engagement herausbilden kann. In der Realität gelingender Umsetzung ist dieses Summen und Brummen der wichtigste Spielpartner.
Wenn nach einer gewissen Zeit auf Plätzen und in den Gassen mehr über die Qualitäten von anderen und weniger über deren Schwächen und Defizite gesprochen wird, ist der erste Schritt in Richtung Gemeinschaft und Miteinander getan und die Begleitphase kann beginnen.
Das klingt utopisch?
Dass das keine Utopie ist, sondern gar nicht so selten erfolgreich umgesetzt wurde, beweisen die vielen Beispiele, die in diesem Buch erläutert werden. Bei den Recherchen sprach ich mit den Bürgermeistern, Verantwortlichen und Aktiven aus einer Reihe von Städten und Gemeinden, aber auch mit privaten Initiatoren von Miteinander-Initiativen.
Sie alle folgen der Überzeugung, dass Miteinander, Gemeinsinn oder Wir-Gefühl die absolute Trumpfkarte für die Zukunftsfähigkeit ihrer Gemeinde oder ihrer Stadt sind. Ihre Geschichten werde ich in diesem Buch erzählen. Hier vorab einige ihrer Aussagen:
·
»Wenn man aus einer zerstrittenen Ortschaft und nebeneinanderher lebenden Einwohnern eine lebendige Gemeinde machen will, dann muss man etwas tun. Man muss zusammenhalten und immer reden. Wenn Bürger und Bürgerinnen sich gesehen fühlen, dann entsteht Gemeinsamkeit.« (Clemens Götz, Bürgermeister von Althengstett im Schwarzwald)
·
»In einer unsicheren Stadt sind Politiker und Ausländer immer die ersten Sündenböcke. Davon profitieren nur rechtsextreme Parteien. Aber wenn sich jemand als Bürgerin oder Bürger sieht und als Teil der Gesellschaft fühlt, dann wird er vielleicht manchmal wütend werden, aber er wird nicht die eigene Gesellschaft angreifen.« (Bart Somers, Bürgermeister von Mechelen in Belgien)
·
»Jeder, der Bock auf Optimismus hat, kann bei uns mitmachen!« (Susann Seifert, Preisträgerin des Wettbewerbs »Stadt gemeinsam gestalten«, Initiatorin der Initiative »Stadtmensch« in Altenburg/Thüringen.)
·
»In der ganzen Diskussion wird immer der Mensch vernachlässigt. Es genügt nicht, einfach nur zu verlangen, dass sich ein Wir-Gefühl etabliert. Wir müssen lernen, den Bürgern etwas zuzutrauen. Wenn Menschen darin bestärkt werden, können gute Ideen Flügel bekommen und ein Feuerwerk aus Kreativität und Engagement kann sich entfalten.« (Wolfgang Picken, Gründer der »Bürgerstiftung Rheinviertel«/Nordrhein-Westfalen)
Sie alle haben eine starke Vorstellung davon, wohin sie wollen. Sie haben ein Gefühl dafür, was Menschen brauchen und – auch das ist ein interessantes Detail – sie stellen sich nicht selbst in den Mittelpunkt, sondern sie anerkennen die Leistungen anderer und sprechen von der gemeinsamen Arbeit.
Viele von ihnen berichten davon, dass ihnen die Arbeit manchmal wie ein Kampf gegen Windmühlen erschienen ist. Die meisten haben Phasen durchlaufen, die Mahatma Gandhi sehr treffend beschrieben haben soll: »Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.« Tatsächlich stammt der Ausspruch von einem US-Gewerkschafter, der ihn 1918 auf einem Gewerkschaftstag formulierte.
Auf der persönlichen Seite ist der Gewinn solcher Anstrengungen nicht weniger als ein erfülltes Leben. Davon spricht beispielsweise Josu Ortuondo Larrea, der Altbürgermeister der spanischen Großstadt Bilbao (von 1991–1999). Ihm ist es gelungen, einen Weg zu eröffnen, der eine wirtschaftlich und sozial darniederliegende Stadt wieder aufgerichtet hat. Dass Bilbao heute eine blühende Stadt voll pulsierendem Leben ist, ist sein Verdienst und das seiner Nachfolger.
GETEILTE EMOTIONEN SIND DER KITT DER GESELLSCHAFT
Aber wie kommt man da hin? Oder anders ausgedrückt, worauf ist zu achten, wenn Menschen nicht nur zusammen herumsitzen sollen, sondern gute nachbarschaftliche Beziehungen entwickeln, die von wechselseitiger Unterstützung und Aufmerksamkeit getragen sind?
Auf der Suche nach dem Kern allen guten Zusammenlebens traf ich mich vor einigen Jahren mit zwei Kollegen in einem jener Kaffeehäuser, für die Wien so berühmt ist. Es war Frühling.
Auf einem runden Tisch dampfen drei frische Tassen Kaffee. Alle drei sind wir Organisationsberater. Jeder hat mehrere Jahrzehnte Berufspraxis. Das Gespräch kreist um Erfahrungen und Erlebnisse, bis es sich schließlich der Frage zuwendet, was Menschen dazu bringt, zusammenzuhalten, einander zu vertrauen und Gemeinsamkeit zu entwickeln.
Was, so fragen wir uns, macht Teams überhaupt möglich und bewirkt, dass Menschen freiwillig voneinander lernen und füreinander eintreten?
Franz genießt seit Kurzem seine Pension. »Es sind geteilte Geschichten«, meint er, »die die soziale Welt zusammenhalten. Menschen erzählen einander ständig Geschichten über sich selbst und die Welt, die sie umgibt. In solchen Erzählungen verbergen sich Werthaltungen. Sie enthalten auch Urteile über alles und jedes, markieren alles, was wir schätzen und was wir ablehnen. Man könnte sogar sagen, dass diese Erzählungen alles enthalten, was einer Gruppe oder einer Gesellschaft Existenzberechtigung und Legitimation verleiht. Teilen andere diese Ansichten, entsteht Vertrauen.« Und er schließt: »Es ist die allen gemeinsame Erzählung, die uns zusammenhält!«
Wir anderen sind teilweise einverstanden, aber noch nicht zufrieden. Sind es wirklich nur die Geschichten? Es wäre doch zu einfach, wenn man glaubte, es wäre genug, einfach nur ein paar gute Geschichten zu erzählen und – Hokuspokus – wie durch Zauberhand würde sich eine Gemeinschaft entwickeln. Wäre es so, würde ordentliches Marketing ausreichen, damit Menschen einander näherkommen und vertrauen. Dass das so nicht funktioniert, ist offensichtlich.
Neben mir sitzt Claudia. Sie hat Soziologie studiert und meint: »Gemeinsame Interessen sind doch viel stärker als geteilte Ansichten. Dort, wo sich Interessen und Meinungen treffen, entsteht Gemeinsamkeit, und das hält eine Gesellschaft zusammen.«
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber reicht das aus?
Beispielsweise haben Menschen, die gerne Fußball spielen, durchaus ein gemeinsames Interesse. Sie freuen sich, wenn sie zusammen über das Spielfeld laufen und kicken können. Aber halten solche gemeinsamen Interessen wirklich eine Gesellschaft zusammen? Geht ihr Teamgeist über das konkrete Spiel hinaus und bewirkt er eine allgemein gemeinschaftsfördernde Haltung? Was ist denn mit den anderen? Mit denen, die lieber Handball spielen, fischen oder Briefmarken sammeln?
Vertrauen, das man anderen bei der Ausübung eines Sports oder während einer anderen Tätigkeit entgegenbringt, ist nicht gleichbedeutend mit einem allgemeinen Klima des Vertrauens. Das aber wäre notwendig, um den Kitt einer Gesellschaft zu bilden.
»Vielleicht ereignet sich Gemeinschaft einfach dann, wenn wir im anderen ein Stück von uns selbst entdecken. Es verbindet, wenn man in aller Offenheit miteinander spricht und dabei im anderen Bestätigung findet, oder?«, ergänzt Claudia.
Wir stimmen zu, haben aber nach wie vor das Gefühl, den entscheidenden Punkt noch nicht erreicht zu haben. Wenn die Chemie zwischen Menschen stimmt, dann sind sie einander sympathisch, kein Zweifel. Aber woraus besteht diese »Chemie«? Und was genau bewirkt, dass sie überhaupt entstehen kann?
Was bildet wirklich die Brücke zwischen Menschen, sodass eine Gemeinschaft wachsen kann, die zusammenhält und in der man einander vertraut? Das ist die entscheidende Frage.
Wir wenden den Blick auf uns selbst und auf unsere Gespräche. Warum sitzen wir hier und was macht uns eigentlich zu Freunden, die füreinander einstehen, sich wechselseitig unterstützen und einander wie selbstverständlich Rückhalt geben?
Was ist der Faktor, der uns zusammenhält?
Da ist die Antwort bald gefunden: Es sind Emotionen wie Neugier, Sympathie, Nähe und Vertrauen. Hinter den Geschichten, die wir teilen, verbergen sich Gefühle! Geteilte Emotionen sind der Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält!
Wir drei freuen uns zum Beispiel, wenn wir einander treffen. Wir lieben es, schwierigen Fragen auf den Grund zu gehen, sie zu erforschen und in ihrer Tiefe zu verstehen. Wenn wir eine Antwort gefunden haben, haben wir ein Gefühl, als hätten wir einen Berg erklommen und stünden nun gemeinsam auf dem Gipfel.
Genauso wie jetzt, als wir in gemeinsamer Anstrengung die Bedeutung der Emotionen entdecken. Es ist ein Gipfelerlebnis, das wir miteinander teilen.
Uns wird klar, dass jedes dieser Erlebnisse uns einander näherbringt. Wir empfinden viel füreinander und begegnen uns auf Augenhöhe. Wir sind neugierig auf die Gedanken der anderen. Wir unterstützen uns gegenseitig und vertrauen einander blind.
Das entstand nicht einfach aus dem Nichts. Es hat auch nichts mit der viel beschworenen »Chemie« zu tun. Es ist vielmehr das Ergebnis einer langen Reihe von großen Gipfelerlebnissen und kleinen Freuden, aber auch von gemeinsam durchlebten und überstandenen Enttäuschungen. All das ist mit Emotionen, genauer: mit positiven Emotionen und Glücksgefühlen verbunden. Das ist es, was uns zu Freunden macht!
Ähnliches gilt auch für Teams und größere Gemeinschaften. Überall kommen Menschen zusammen, weil sie Emotionen teilen und diese weitergeben. So entstehen kleine und große Erzählungen, die gemeinsame Gefühle nicht nur beschreiben, sondern immer wieder auslösen und verstärken.
Damit Menschen zusammenhalten, ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit unerlässlich. Geteilte positive Bewertungen sind mit positiven Emotionen verbunden, negative Dinge mit Gefühlen wie Abscheu oder gar Ekel. Teams, Gesellschaften und ganze Kulturen zeichnen sich dadurch aus, dass sie emotional in einem gewissen Gleichklang schwingen. Und zwar so sehr, dass jemand, der Dinge anders bewertet und einen anderen Kanon aus Gefühlen hegt, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden kann.
Die Unterhaltung ist so intensiv, dass der Kaffee inzwischen kalt geworden ist. Mein ganzes Berufsleben war charakterisiert durch die Suche nach den verbindenden Elementen in der Kultur von Organisationen. Dabei hat mir die Erfahrung gezeigt, dass jede Kultur ihre eigenen Werthaltungen und Muster hervorbringt, die sich in allen Lebensäußerungen zeigen und durch ständiges Weitererzählen, durch Belohnung und Ahndung von Abweichung am Leben erhalten werden. So entstehen nicht nur in dieser Gruppe geteilte Werthaltungen, sondern ein dichtes Gewebe von Normalität.
In jedem Gespräch verstärken die Mitglieder einer Gruppe, einer Abteilung oder auch einer ganzen Gesellschaft jene Werthaltungen, die ihnen aus ihrer Innensicht als »normal« erscheinen. Andere werden kritisiert und über sie wird gelästert. In Wahrheit stellt dieser »moralische Wetterbericht«1 in allen Gesellschaften, ob groß oder klein, das zentrale Element in Gesprächen dar.
Diese Beobachtung führte mich schon früh zu der Überzeugung, dass eine Kultur nur verändert werden kann, wenn es gelingt, die Ausrichtung dieses »Wetterberichts« zu verändern. Viele Unternehmen versuchten das noch in den neunziger Jahren mithilfe von Verordnungen. Da wurde beispielsweise das Wort »Problem« verboten und der Begriff »Chancen« an dessen Stelle gesetzt.
Verordneter oder erzwungener »Neusprech« hat aber noch nie funktioniert. Im Gegenteil. Gewohnte und in der Tradition verankerte Sprechformen wandern dann in den Untergrund, sie werden zum Erkennungszeichen des Widerstands und tragen einen latenten Keim des Aufstands in sich. Diktaturen reagieren darauf häufig mit drakonischer Gewalt, bis hin zu Todesstrafen. Ein Blick in die Geschichte beweist jedoch die Erfolglosigkeit solcher Exzesse.
Verankerte Ausdrucksweisen und Erzählungen halten sich deshalb so hartnäckig, weil die Identität von Menschen eng an die Werthaltungen gekoppelt ist, die sie mit anderen teilen. Aufgezwungener »Neusprech« wird daher stets als Angriff auf die eigene Identität verstanden, also als Anschlag auf den Kern der Persönlichkeit. Man erreicht nichts, indem man andere nervt. Will man etwas bewirken, muss man sie gewinnen.
Destruktive Nebeneffekte sind nur durch gemeinsame Gestaltung zu umgehen. Was gemeinsam gestaltet wurde, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, zu einem Bestandteil der Gruppenidentität zu werden. Denn es ist dann eine Art kollektiver Besitz.
Unser Gespräch wird schnell konkreter. Welche Emotionen begegnen uns in der Arbeit mit Menschen und Gruppen? Am häufigsten stoßen wir auf Ängste und Befürchtungen, die sich schnell in destruktiven Handlungen äußern können. Oft ist aber auch Begeisterung im Spiel. Wo sie herrscht, schaut man positiv in die Zukunft und macht sich aktiv daran, das eigene Umfeld zu gestalten.
Menschen können ebenso durch miteinander geteilte Ängste zusammenfinden wie durch Gefühle der Begeisterung und Freude. Gefühle können sowohl gemeinschaftsfördernd sein als auch toxisch. Sie können konstruktiv sein und Mut machen, oder sie können Menschen schwächen und aufeinanderhetzen. Dies geschieht dort, wo Gefühle wie Ohnmacht, Misstrauen, Angst oder Feindschaft vorherrschen.
Gefühle sind sehr ansteckend. Begeisterung und Freude springen schnell über. Etwa wenn die eigene Fußballmannschaft ein Tor geschossen hat. Die Begeisterung erfasst nicht nur die Spieler und das Publikum im Stadion. Sie wandert auch durch TV- und Radioübertragungen und kann eine ganze Stadt, eine ganze Nation in Taumel versetzen.
Die moderne Neurophysiologie hat gezeigt, dass die virale Ausbreitung von Gefühlen etwas mit der Funktionsweise des Gehirns zu tun hat. Negative wie positive Gefühle sitzen im limbischen System des Gehirns. Dieser Teil des Gehirns versteht keine gesprochenen oder geschriebenen Worte. Sein Medium sind einzig Gefühle. Es ist erstaunlich, wie effektiv das Gehirn Dinge zunächst emotional markiert und dabei zwischen Gefahr oder Wohltat unterscheidet. Zwischen der Markierung und dem folgenden bewussten Wahrnehmen liegen bis zu sieben Sekunden! – Eine wahre Ewigkeit für ein superschnelles System wie unser Gehirn.2
Geschichten und Erzählungen erzeugen Gefühle. Sie »sprechen« sozusagen mit den uralten Teilen unseres Gehirns und markieren mit Emotionen, was erstrebenswert ist und was nicht. Diese Markierung bewirkt, dass nicht nur ein Bild, sondern auch eine gut erzählte Geschichte mehr sagt als tausend erklärende Worte.
Wenn es am Stammtisch oder im Dorftratsch in immer wiederkehrenden Schleifen um Gott, die Welt und die Nachbarn geht, dann werden keine echten Informationen ausgetauscht, denn alle kennen die ständig wiederholten Themen und Sätze. Der Informationswert solcher Gespräche ist nahezu null.
Dennoch ist dieses Gerede sehr wichtig. Denn während des Redens koordinieren alle Beteiligten ihre Gefühle und bestätigen sich damit gegenseitig. Sie zeigen sich selbst, dass sie zusammengehören und eine Gemeinschaft sind.
Daher gilt: Wenn eine Gemeinschaft entwickelt werden soll, in der Miteinander, Gelassenheit, Freude, Begeisterung und wechselseitige Unterstützung zur Normalität werden, dann sind zuallererst jene Gefühle zu fördern, die das begünstigen.
Bei der Entwicklung einer Stadt besteht die Kunst also darin, die emotionale Welt zu gestalten. Es sind Gefühle, die Menschen dazu veranlassen, Beziehungen aufzubauen. Miteinander geteilte Emotionen ermöglichen Bindungen. Wer das fördern will, der muss Menschen ermutigen, ihnen Zuversicht vermitteln, ihnen ein Gefühl für ihre Bedeutung in der Gemeinschaft geben, ihre Stärken stärken und vor allem gemeinschaftsfördernde Gefühle vermehren.
Weil Gefühle so ansteckend sind, muss jeder, der dazu etwas beitragen möchte, selbst vom Miteinander begeistert sein. Nur wer selbst begeistert ist, kann die Flamme der Begeisterung weitertragen und andere anstecken. Nur wer selbst begeistert ist, kann bewirken, dass bloße Konsumenten von Informationen, Anregungen, Wünschen und Events sich nach und nach in Beteiligte und verantwortungsvolle Mitgestalter verwandeln. Nur so kann das angestrebte Ergebnis erreicht werden: eine Gemeinschaft, die zusammenhält, füreinander da ist und fähig, vertrauensvoll voneinander zu lernen.
DER ORIENTIERUNGSVERLUST SCHAFFT RAUM FÜR NEUES MITEINANDER
Seit einigen Jahrzehnten leben wir in einer seltsamen und verwirrenden Welt, in der sich der althergebrachte und scheinbar gut gefügte Wertekanon unserer Gesellschaft aufzulösen scheint. »Ein jahrhundertelang gültiges Wertesystem wurde grundlegend uminterpretiert, oder genauer: in sein Gegenteil verkehrt. Waren Habsucht, Gier und Maßlosigkeit zuvor Laster, so wurden sie zu wohlstandsfördernden Tugenden erhoben«, schreibt etwa Meinhard Miegel.3
Tief verankerte Glaubenssätze, die der Gesellschaft Stabilität verliehen, werden immer schwächer oder laufen Gefahr, sich ganz aufzulösen. Dazu gehört der Glaube daran, dass sich Vernunft immer durchsetzen würde, ebenso wie die Überzeugung, dass auch die Demokratie nicht mehr zerstörbar sei oder dass sich der Wohlstand immer weiter mehren werde. Dasselbe gilt für den Glauben an die grundsätzliche Universalität von Menschenrechten, Bildung, Humanität.
Für manche Ältere, deren Schulzeit noch vom alten Wertesystem geprägt war, fühlt sich das an, als ob die Fundamente jener geistigen Wohnung, in der sie ihr ganzes Leben verbracht haben, auf einmal wegbrechen würden. Jüngere wiederum tun sich schwer, Perspektiven zu entwickeln in einer Welt, die ihnen kaum mentalen Halt bietet.
Diese Situation führt den Philosophen Michael Andrick zu dem Befund, dass es immer schwieriger wird, Erfolge nicht nur zu feiern, sondern sie auch zu empfinden. Denn um einen Erfolg auch als solchen erleben zu können, braucht es ein halbwegs stabiles Rahmensystem. Wenn der Sinn dessen, was man tut, verloren geht, dann verschwindet auch der Maßstab, an dem er gemessen werden kann. »Erfolgsleere«4 nennt Andrick das.
Der österreichische Theologe Paul Michael Zulehner sieht das grundsätzlich ähnlich. »Der Welt geht die Hoffnung aus (…) Wenn die Hoffnung weg ist, fällt auch das Engagement weg«, meinte er in einem Radiointerview.5
Aber er deutet auch einen Ausweg an.
Zunächst müsse man die Situation akzeptieren, wie sie nun einmal ist, auch wenn das schmerzlich sei. Den Herausforderungen der Zeit gegenüber dürfe man die Augen nicht verschließen. Die viel zu einfachen Auswege, die von allen Seiten angeboten werden, führen abwärts in Sektiererei und Spaltung.
Wolle man etwas ändern und den Weg in eine konstruktive Zukunft ebnen, dann müsse man alle erreichbaren Hoffnungsreserven aktivieren. Alle Menschen sehnen sich nach Frieden, Gerechtigkeit und Stabilität, meint er. Deshalb brauchen wir »Agenten der Hoffnung«, Menschen, die die Situation klar erkennen, aber dennoch nicht aufgeben, die Verantwortung übernehmen, Fenster öffnen und das Licht einer guten Zukunft hereinströmen lassen.
Eine jüngst veröffentlichte Langzeitstudie erweitert die Diagnose Zulehners um die wichtigste Eigenschaft, die solche »Agenten der Hoffnung« mitbringen müssen. Zehn Jahre untersuchte ein Team von Forschern die Frage, welche menschliche Eigenschaft die wichtigste ist, wenn trotz Unsicherheit etwas Positives erreicht werden soll. 3698 Individuen, 593 Teams und die Befolgung von 5000 Gruppenaufgaben wurden beobachtet und untersucht. Als Ergebnis stellte sich ein bisher von der Theorie kaum beachteter Faktor als besonders bedeutend heraus.
Die Wissenschaftler veröffentlichten ihre Ergebnisse folgerichtig unter dem Titel »Kill Chaos with Kindness«.6 Die entscheidenden Faktoren für die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft sind Freundlichkeit, Herzlichkeit, Liebenswürdigkeit, Güte und Wohlwollen!
Das ist ein Lichtstreif am Horizont für alle, denen der Verlust an Orientierung und Perspektive, die wachsende Instabilität und das oft planlose Tasten nach Strohhalmen zunehmend Sorgen bereiten. Das vorliegende Ergebnis sagt, wo der Weg aus dieser Situation zu finden ist: in freundlichem Miteinander, im Respekt vor den Fähigkeiten anderer und in der Wahrung der Würde des Gegenübers.
Miteinander entsteht, wenn gemeinsam gehandelt, gemeinsam entwickelt und gemeinsam gestaltet wird.
URBANES MITEINANDER ALS ANTITHESE ZUR VEREINZELUNG
Fest steht, dass sich ein Gefühl von Gemeinsamkeit nur durch freiwillige Beteiligung einstellt. Die Kunst besteht darin, aus Betroffenen nicht nur Beteiligte zu machen, sondern vor allem Mitgestalter. In einer Stadt kann das nur funktionieren, wenn aus Ideen und Angeboten individueller Nutzen entsteht, der persönlich empfunden und direkt erlebt werden kann.
Ludwig Wittgenstein hat einmal gesagt, dass es die Aufgabe der Philosophie sei, der Fliege den Weg aus dem Fliegenglas zu weisen. Das »Fliegenglas« ist die Falle, in der wir alle sitzen. Sie besteht aus den vielen negativen Emotionen, die unsere Gesellschaft durchziehen und die wie ein schlechter Geruch durch alle Ritzen kriechen. Negative Emotionen fördern Angst, Misstrauen und Neid, treiben Menschen auseinander und nagen an ihrem Selbstvertrauen. Dadurch lähmen sie gemeinschaftliche Initiativen.
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er braucht Gemeinschaft, sowohl psychisch als auch physisch. Auf uns allein gestellt können wir nicht überleben. Das uns innewohnende fundamentale Bedürfnis nach Miteinander und Aufgehobenheit in einer Gruppe erzeugt die Sehnsucht nach vertrauensvoller Gemeinschaft.
Wie wäre es also, wenn das Leben in der Stadt eine gelebte Antithese zum Trend der Vereinzelung und Isolation böte? Wenn Teilinitiativen, Formate und Aktionen gesucht und entwickelt würden, die sich dazu eignen, Menschen nachhaltig zu verbinden? Wenn sich nach und nach Türen öffneten, die ein dem Leben förderliches Gefühl der Zugehörigkeit hereinlassen?
In meiner Stadt begann es mit kleinen Schritten, einer nach dem anderen. Schließlich verbanden sich immer mehr kleine Schritte und fügten sich zu einem größeren Ganzen zusammen.
In der gemeinsamen Arbeit bildeten sich Prinzipien heraus, die sich als grundlegend für den Erfolg erwiesen. Eines der wichtigsten Prinzipien ist: Stärken stärken! Bestätigung und Anerkennung sind die Mittel dazu.
Stärken zu stärken bedeutet, den inneren Radar auf das Potenzial zu richten, das in Gedanken und Vorschlägen anderer zu finden ist, und diese Qualität anzuerkennen.
Dabei entstehen Geschichten, die für sich alleine genommen überall vorkommen können. Häufen sich diese, dann sind sie ein Indikator dafür, dass sich etwas verändert hat. So bat einmal ein junger Mann, die Gemeinde möge ihn bei der Suche nach vier jungen Leuten aus Tulln unterstützen. Die vier hätten, so berichtete er, seiner dementen Cousine geholfen, als sie ohne Schuhe in Socken durch die Gassen geirrt war, und sie zurückgebracht. Der Mann nahm seine Cousine erleichtert in Empfang. Als er sich aber umdrehte und sich bei den vier Helfern bedanken wollte, waren diese schon verschwunden.
In seinem Brief an die Gemeinde schrieb er: »Die jungen Leute waren ein Glücks- und Segensfall für meine Cousine. Dass sie sich so um sie gekümmert haben und alles Erdenkliche taten, damit sie wieder gut heimkommt, ist bewundernswert und lobenswert.« Er wollte die Helfer finden, um ihnen eine Belohnung zu übergeben.
Von einem anderen Ereignis berichtete ein älterer, noch rüstiger Mann. Er wechselte vor seinem Haus die Winterreifen und kniete mit einem Schraubenschlüssel auf dem Boden. Da sprach ihn eine junge Frau an. »Zuerst«, so erzählte er, »verstand ich nicht, was sie wollte, und fragte nach. Da bot sie mir ihre Hilfe beim Reifenwechseln an. Ich war vollkommen perplex über dieses Ausmaß an Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft.«
Ein noch stärkeres Indiz für das Funktionieren einer Miteinander-Strategie ist die Entstehung von Initiativen, die von ihren Mitgliedern getragen und gestaltet werden. Dazu gehören beispielsweise die »Spirituellen Brückenbauer«, ein freundschaftlicher Zusammenschluss der Vertreter aller großen Religionen in Tulln. Die Kleriker der katholischen und der evangelischen Kirche sind hier ebenso vertreten wie der orthodoxe Pfarrer und der hiesige Imam. Sie entwickeln miteinander gemeinschaftsfördernde Projekte über die Grenzen der einzelnen Religionen hinweg. Der Name der Gruppe ist Programm. Im Zentrum ihrer Arbeit steht die Gemeinsamkeit aller Religionen und sie lebt vor, dass Unterschiede kein Problem, sondern eine Chance sind, voneinander zu lernen.
Eine weitere Initiative in dieser Reihe bildet eine Gruppe, die sich »Alte Elefanten« nennt und vornehmlich aus junggebliebenen Pensionisten besteht. Ihr Anliegen ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen der Gesellschaft: das Verhältnis der Generationen zueinander. Sie verstehen sich als »Agenten der Zuversicht« und haben sich zum Ziel gesetzt, Jüngere zu unterstützen. Untersuchungen zeigen, dass etwa zwei Drittel aller Jugendlichen von Befürchtungen und Ängsten geplagt werden. Wie, so die »Alten Elefanten«, soll man mit Angst eine Zukunft bauen können? Deshalb entwickeln sie Programme auf eine Weise, die Jugendlichen Mut macht und ihnen hilft, gerade in Zeiten erhöhter Unsicherheit ihre eigenen Perspektiven entwickeln zu können.
Auch ein wunderbar funktionierendes »Reparaturcafé« gehört zu den gemeinschaftlichen Entwicklungsprojekten. Dort fand sich eine Gruppe von Technikern, Handwerkern und erfahrenen Heimwerkern, die allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ihr Wissen und ihr Können einmal im Monat kostenfrei zur Verfügung stellen. In Gesprächen und bei Kaffee und Kuchen lernt man einander kennen. Gegründet wurde diese Initiative von einem Mitglied der »Alten Elefanten«.
Eine weitere Gruppe in dieser Kategorie ist das »Erzählcafé«. Jeweils einem anderen Thema folgend, tauschen die Teilnehmer dort Erfahrungen und Lebensgeschichten aus. Nicht selten stellen sie dabei fest, wie sehr ihre Geschichten einander ähneln. Das ist nicht nur in vielen Fällen hilfreich, es fördert auch Nähe und Zusammengehörigkeit.
Ein besonderer Spross ist die »Sprechstunde für Nachbarschaftskonflikte«, an der sich alle Tullner Anwaltskanzleien ehrenamtlich beteiligen. Die Idee dazu hatte einer der Anwälte und auch alle anderen machten ehrenamtlich mit. Das Ziel dieser Sprechstunden ist es, auftauchende Konflikte möglichst einvernehmlich zu lösen.
Neben diesen selbsttragenden Gruppen gibt es noch eine Reihe von Events und Formaten, die es ermöglichen, dass die Bürger und Bürgerinnen sich treffen und sich jenseits ihrer persönlichen Bekanntenkreise kennenlernen können. Dazu gehören Nachbarschafts- und Gassenfeste, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst organisiert wurden.
In all der Zeit war es überraschend zu erleben, wie viele Bürger und Bürgerinnen von sich aus Engagement anboten und konstruktive Ideen mitbrachten. Immer wieder zeigte sich, wie viel verborgene Kraft und Bereitschaft in der Bürgerschaft schlummert und wie diese Energie zum Vorschein kommt, sobald der Rahmen passt, Stärken gestärkt werden und ihre Bemühungen Anerkennung und Bestätigung finden. Der Energie der Bürgerschaft ist es auch zu verdanken, dass während der Corona-Lockdowns keine einzige Teilinitiative und kein einziges Format verloren ging. Im Gegenteil, in dieser Zeit wuchs die Bewegung noch!
ERFOLGREICHE MITEINANDER-INITIATIVEN HABEN GEMEINSAMKEITEN
Als ich mit den Recherchen für dieses Buch begann, entdeckte ich, dass die Initiativen meiner Stadt nicht die einzigen sind. Ich entdeckte, dass es viele bewundernswerte und erfolgreiche Initiativen in anderen Städten und Gemeinden gibt. Sie werden in diesem Buch zu Wort kommen.
Weil jede Gemeinde so wie auch jede andere Gemeinschaft ihren eigenen Charakter, ihre ureigenen Rahmenbedingungen und auch ihre eigene Geschichte hat, kann dieses Buch kein bloßer Handlungsleitfaden sein. Denn was sich an einem Ort als erfolgreich erwiesen hat, funktioniert vielleicht schon in der nächsten Ortschaft weniger gut oder gar nicht.
Vielmehr geht es darum, Hintergründe und Zusammenhänge zu verdeutlichen. Die vielen konkreten Beispiele und Geschichten haben eine unterstützende Funktion. Sie sollen erläutern und demonstrieren, wie und warum Initiativen und Maßnahmen wirken und Hinweise geben, worauf zu achten ist und mitunter auch darauf, was zu vermeiden ist.
Als eine der wichtigsten Gemeinsamkeiten aller erfolgreichen Projekte stellte sich die positive Einstellung der Akteure heraus. Fröhlichkeit, Lockerheit, Gelassenheit und Begeisterung waren bei ihnen überall geradezu greifbar. Solche Begeisterung überträgt sich. Sie ist sogar in der Lage, Grenzen festgefahrener Vorstellungen zu überwinden. Wie die Wellen, die ein in einen See geworfener Kieselstein erzeugt, weitet sich Begeisterung aus und erfasst im besten Fall eine ganze Stadt.
Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Art, wie man voneinander spricht. Wenn Menschen aus solchen Initiativen und Gemeinden erzählen, sprechen sie sehr viel von den Ideen, die andere in ihrer Umgebung hatten. Sie loben, bewundern und anerkennen die Leistung anderer und stellen diese ins Zentrum ihrer Berichte. »Wir« ist ein häufig zu vernehmendes Wort, während »ich« nur selten zu hören ist.
Wo es um Gemeinschaft, Gemeinsinn und Miteinander geht, müssen diese Qualitäten im Zentrum stehen. Ihre Bedeutung wurde lange Zeit nicht beachtet. Gemeinschaftliche Solidarität und Zusammengehörigkeit zu fördern, verlangt deshalb an manchen Stellen ein Umdenken.
1Michael Andrick: Erfolgsleere. Philosophie für die Arbeitswelt. Freiburg/München 2020, S. 186.
2Vgl. Dylan Haynes: Unbewusste Entscheidungen im Gehirn. Publ. der Max-Planck-Gesellschaft, 13.4.2008. https://www.mpg.de/562931/unbewusste-entscheidungen-im-gehirn
3Meinhard Miegel: Hybris. Die überforderte Gesellschaft. Berlin 2014, S. 15.
4Michael Andrick: Erfolgsleere.
5Ö1, Mittagsjournal, 3.8.23.
6Soo Ling Lim, Peter J. Bentley u. a.: Kill Chaos with Kindness. Agreeableness Improves Team Performance under Uncertainty. https://doi.org/10.1177/26339137231158584
2. MITEINANDER IST EIN WEG UND KEIN ZIEL
WIE EIN KÜRBIS DIE WELT VERÄNDERT
»Süßes oder Saures!« Wenn es in der Nacht zu Halloween vom 31. Oktober auf den 1. November an der Tür klingelt, stehen als Hexen oder Untote verkleidete Kinder vor dem Haus und verlangen Süßigkeiten.
Halloween ist ja ursprünglich ein keltisches Fest aus Irland, das sich dann in den USA verbreitete. In Retz, einer kleinen Stadt im nördlichen Österreich, ging es zunächst nur um die Entwicklung dieser abgelegenen Region. Dass sie sich mit dem Halloween-Fest verknüpfte, war anfangs gar nicht beabsichtigt.
Aber beginnen wir von vorne:
Retz ist eine Stadt in Randlage an der österreichisch-tschechischen Grenze. Nur wenige Jahre zuvor lag der Eiserne Vorhang noch in unmittelbarer Nachbarschaft. Dort war damals die westliche Welt sozusagen zu Ende und die Abwanderung war demzufolge größer als in anderen ländlichen Gebieten. Auch nach der Ostöffnung erholten sich diese Gebiete nur langsam.
Es musste etwas geschehen. Ein Regionalentwickler wurde angestellt. Seine Aufgabe war es, die Stadt und ihr Umfeld interessanter und attraktiver zu machen. Diesen Auftrag übernahm Fritz Seidl, ein Soziologe, der zuvor in Afrika als Entwicklungshelfer tätig gewesen war.
Er stellte fest, dass Bauern und Wirte der Region einander mit traditioneller Distanz begegneten. Das war ein gut etablierter Bestandteil der lokalen Folklore. Also eröffnete Seidl Gespräche mit Vertretern beider Seiten. Zunächst traf man sich zu Einzelgesprächen, dann auch zu gemeinsamen Versammlungen. Trotzdem gelang es nicht, Brücken über die Gräben des gewohnheitsmäßigen Misstrauens zu schlagen. Immerhin konnte Seidl das persönliche Vertrauen beider Gruppen erringen. Dies sollte sich bald als entscheidender Erfolgsfaktor herausstellen.
Eines Tages flog die Tür zum Büro des Regionalentwicklers auf und herein trat ein aufgeregter Landwirt. In seinem Gesicht standen sowohl Freude als auch Überraschung. Er ließ sich auf einen der Stühle fallen und begann zu erzählen:
Gerade sei er noch dabei gewesen, etwas im Stall zu erledigen, als ein Auto mit Wiener Kennzeichen vor seinem Haus anhielt. Ein freundlicher Mann stieg aus. Er hatte einen Kürbis unter dem Arm, den er sich zuvor von einem der Felder genommen hatte, und fragte, wie viel der Kürbis kosten würde.
Kürbisse wurden allein wegen ihrer Kerne angebaut, aus denen wertvolles Speiseöl gepresst wurde. Das Fruchtfleisch hingegen galt als wertlos. Es wurde nach der Ernte der Kerne einfach eingeackert.
Aber der Städter war zur Verblüffung des Landwirts gar nicht an den Kernen interessiert. Er wollte den ganzen Kürbis.
Der Bauer konnte ihm einfach keinen Preis für einen einzelnen Kürbis nennen. Also sah er den Städter nur ungläubig an und zuckte mit den Achseln. Da griff der Wiener zu seiner Börse und reichte ihm einen Geldschein.
»Weißt du, wie viel er mir gegeben hat?«, fragte er den nun ebenfalls überraschten Regionalentwickler. »Fünfzig Schilling!«
Seidl erkannte den Wert des Erlebnisses und bat den Bauern, seinen Nachbarn von diesem »Abenteuer« zu berichten. Er selbst rief einige Wirte zusammen und erzählte ihnen die Geschichte. Was, fragte er, könnte man daraus machen?
Da erinnerte sich ein Wirt an ein paar einfache Kürbisgerichte, an die bisher niemand gedacht hatte.
Plötzlich zeigte sich die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Projekt, das allen Seiten nützen würde. Der Regionalentwickler lud Bauern und Wirte zu einem Treffen und bald entstanden konkrete Pläne, wie man den neu entdeckten Wert der Kürbisse zur Entwicklung der Region nutzen konnte.
Die lang gesuchte Brücke zwischen scheinbar widerstreitenden Interessen war gefunden.
Eine der neuen Ideen war die Veranstaltung eine Kürbisfestes im Retzer Land. Bauern sollten dort Kürbisse anbieten und Wirte einige Kürbisgerichte zur Verkostung bereitstellen. Die Veranstaltung war medial sehr gut angekündigt und wurde ein voller Erfolg.