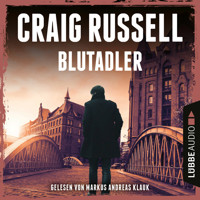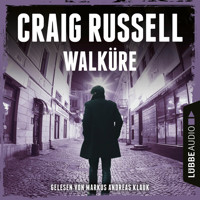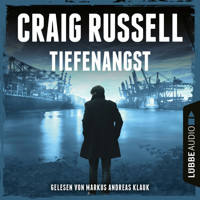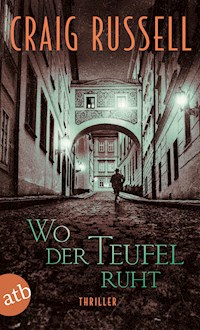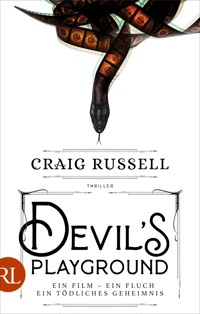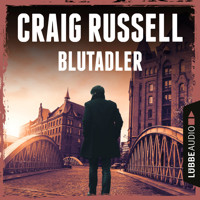8,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jan-Fabel-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die Schatten der Toten.
Jan Fabel, Chef der Mordkommission in Hamburg, hat sich verändert. Vor zwei Jahren ist er beinahe gestorben, als ein Mann ihn anschoss. Er hatte eine Nahtod-Erfahrung, die ihn noch mehr zu einem intuitiv arbeitenden Polizisten werden lässt. Als bei Bauarbeiten eine Leiche gefunden wird, ahnt er sofort, dass es sich um die sterblichen Überreste von Monika Krone handelt, die vor fünfzehn Jahren spurlos verschwand. Wenig später beginnt eine unheimliche Mordserie. Ein Maler, zu dessen frühen Motiven ein Bild von Monika gehört, wird tot aufgefunden, ein Autor, der sich auf moderne Edgar-Allan-Poe-Versionen verlegt hat, wird ermordet. Alle haben eine Verbindung zu Monika gehabt. Und dann taucht ein Mann aus Fabels Vergangenheit wieder auf – und er begreift, welche Dimension dieser Fall hat ...
Jan Fabel ist einer der ungewöhnlichsten Ermittler Deutschlands. Ein packender, vielschichtiger Thriller von einem international vielfach preisgekrönten Autor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Ähnliche
Informationen zum Buch
Die Schatten der Toten.
Jan Fabel, Chef der Mordkommission in Hamburg, hat sich verändert. Vor zwei Jahren ist er beinahe gestorben, als ein Mann ihn anschoss. Er hatte eine Nahtod-Erfahrung, die ihn noch mehr zu einem intuitiv arbeitenden Polizisten werden lässt. Als bei Bauarbeiten eine Leiche gefunden wird, ahnt er sofort, dass es sich um die sterblichen Überreste von Monika Krone handelt, die vor fünfzehn Jahren spurlos verschwand. Wenig später beginnt eine unheimliche Mordserie: Ein Maler, zu dessen frühen Motiven ein Bild von Monika gehört, wird tot aufgefunden, ein Autor, der sich auf moderne Edgar-Allan-Poe-Versionen verlegt hat, wird ermordet. Alle haben eine Verbindung zu Monika gehabt. Und dann taucht ein Mann aus Fabels Vergangenheit wieder auf – und er begreift, welche Dimension dieser Fall hat.
Jan Fabel ist einer der ungewöhnlichsten Ermittler Deutschlands.
Ein packender, vielschichtiger Thriller von einem international vielfach preisgekrönten Autor.
Craig Russell
Auferstehung
Thriller
Aus dem Englischen vonStefanie Schäfer
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Vorbemerkung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Teil Eins
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Teil Zwei
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Danksagung
Über Craig Russell
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Für Alan
Wie oft sind Menschen, schon des Todes Raub,
Noch fröhlich worden! Ihre Wärter nennen’s
Den letzten Lebensblitz.
William Shakespeare
Romeo und Julia
5. Akt, 3. Szene
Niemand, der nicht schon in der Nacht
Schreckliches gelitten, weiß,
wie süß und teuer für Herz und Augen
der Morgen sein kann.
Bram Stoker
Dracula
Die Existenz von Nahtoderfahrungen wird nicht bestritten; ihre Natur hingegen schon. Viele, die eine Nahtoderfahrung hatten, sind anschließend durchdrungen von einem überwältigenden Glauben an ein Leben nach dem Tod und verlieren jede Furcht vor dem Sterben. Die Wissenschaft betrachtet diese Erfahrungen als machtvolle, realistische Halluzinationen, die durch die kurz vor dem Tod ausgeschütteten, hochpotenten Neurotransmitter sowie ein Gewitter von Elektroimpulsen im Gehirn verursacht werden.
Wo immer sie herrühren, was auch immer ihre wahre Natur sein mag: Nahtoderfahrungen hinterlassen bei jenen, die sie erlebt haben, tiefgreifende Veränderungen.
Prolog
1
Der Himmel an jenem Tag, so würde er sich später erinnern, war von einem fahlen Bleigrau. Immer wenn er daran zurückdachte, kam ihm das Fehlen von Farbe am Himmel in den Sinn, das Fehlen von Farbe in allem. Und dass es ihm damals nicht aufgefallen war.
Der Winter war unentschlossen gewesen. An jenem Tag.
»Also, warum knöpfen wir uns ausgerechnet diesen Typen noch einmal vor? Welchen Unterschied siehst du zu den anderen Anwohnern?«, fragte Anna Wolff, als sie und Jan Fabel aus dem neutral lackierten Zivilfahrzeug ausstiegen, einem BMW. »Schalthoff ist nicht vorbestraft. Er ist überhaupt nie auffällig geworden und hat, soweit wir wissen, auch keine einschlägigen Kontakte. Ich kapiere nicht, warum du ihn so auf dem Kieker hast. Hast du eine Vorahnung, oder was?«
»Vorahnungen gibt es nicht, Anna«, erwiderte Fabel. »Es gibt nur unbewusste Verarbeitungsprozesse im Gehirn, die noch nicht zu bewussten Erkenntnissen geführt haben. Ich habe irgendetwas in dem Kerl erkannt … Ich weiß nur noch nicht genau, was es ist. Bisher jedenfalls.«
»Okay …«, entgegnete Anna gedehnt. »Alles klar.«
»Hab Geduld mit mir.«
Sie überquerten die Große Brunnenstraße in Richtung des Wohnhauses. Wie unsichtbare Finger, die Seiten umblätterten, wendete ein schneidender Wind das feuchte Laub um, das auf dem Asphalt haftete, und zerrte an den Flugblättern, die überall an den Alleebäumen hingen. Das Gesicht, das Fabel inzwischen so genau kannte – große Augen und unbändiges blondes Haar über einem entwaffnenden Grinsen –, lächelte ihn von dem Foto auf den Flugblättern an. Es war dieses Lächeln, diese Unschuld hinter dem Lächeln, die praktisch die gesamte Altonaer Bevölkerung dazu getrieben hatte, sich an der Suche nach dem vermissten Jungen zu beteiligen. Überall im Viertel fand man die Flugblätter: kleine Banner der Hoffnung, dass der kleine Timo Voss lebendig und unversehrt gefunden würde. Alle suchten nach dem lebendigen, gesunden Timo. Aber nicht Fabel. Sein Job war es seit jeher gewesen, die Toten und die Schuldigen zu finden, nicht die Lebenden und die Unschuldigen. Fabel wusste, dass er ein Gespenst vor sich sah.
»Wie willst du vorgehen?«, fragte Anna.
»Wir improvisieren. Ich will mal sehen, ob ich einen Nerv treffen kann. Er ist mir bei der letzten Vernehmung einfach ein bisschen zu berechnend vorgekommen.«
Als sie das Wohnhaus erreichten, trat eine kleine, mit Mantel und Schal gegen die Kälte geschützte Frau aus dem Haupteingang und drängte sich zwischen ihnen hindurch. Anna erwischte die Tür, bevor sie sich schloss, und ersparte es ihnen damit, klingeln zu müssen.
»Das wird eine nette Überraschung für ihn werden.« Sie lächelte.
»Zweiter Stock«, sagte Jan Fabel und ging ihr im Treppenhaus voraus, wo es schwach nach Desinfektionsmittel roch. Als sie die Wohnung erreicht hatten, bemerkte Fabel, dass auch der Treppenabsatz frisch geputzt sein musste. Wummernde Bässe wehten von einem der oberen Stockwerke herunter und waberten durch den Flur.
Als Fabel klingelte, ertönte ein giftiges Summen, wie von einer gefangenen Biene in einem Glas. Fabel wartete einen Moment, und als niemand reagierte, hämmerte er an die Tür und rief: »Herr Schalthoff?«
»Vielleicht ist er nicht zu Hause«, sagte Anna, als immer noch keine Reaktion kam. »Oder er arbeitet Schicht.«
Aber Fabel wartete, neigte sich zur Tür und lauschte.
»Ich höre Bewegungen«, sagte er leise. Gerade, als er erneut anklopfen wollte, ging die Tür auf, und ein Mann Ende dreißig erschien. Jost Schalthoff, der, wie Fabel wusste, seit der Schule als Techniker für die Stadt Hamburg arbeitete, trug noch immer seinen Arbeitsoverall. Er war mittelgroß und hatte ein offenes, angenehmes, freundliches Gesicht. Sympathisch. Die Art von Gesicht, der man instinktiv vertraute.
Du warst es, du krankes Mörderschwein.
Der Gedanke schoss Fabel in dem Moment durch den Kopf, als Schalthoff in die Tür trat. Der kleine Timo Voss hat deinem Gesicht vertraut, aber für dich war er nur etwas, was du benutzt und weggeworfen hast. Du hast ihn von der Straße geholt, getan, was du wolltest, und ihn dann getötet. Und im selben Augenblick der Hellsichtigkeit wusste Fabel, dass sie Timo finden würden, wenn sie Schalthoffs Wohnung durchsuchten.
Fabel konnte nicht genau ausmachen, was an Schalthoffs Gesichtsausdruck bei der ersten Befragung nicht zu sehen gewesen war. Doch was immer es war, es hatte unmittelbar diese absolute Gewissheit in ihm ausgelöst – irgendetwas in seiner Miene, etwas Vages, Flüchtiges, in diesem Moment, als Schalthoff, der sich aus der Schusslinie glaubte, die Polizei erneut vor seiner Tür stehen sah. Etwas Stärkeres als nur Schuldbewusstsein.
»Wir führen noch weitere Ermittlungen im Fall Timo Voss durch und hätten in diesem Zusammenhang auch noch ein paar Fragen an Sie, Herr Schalthoff, wenn es Ihnen nichts ausmacht.« Fabel zeigte seinen Ausweis, lächelte und sprach bewusst leichthin und sachlich. Schalthoff neigte den Kopf ein wenig schief und blickte angemessen ernsthaft. Und die ganze Zeit über wusste Fabel, dass Schalthoff der Mörder war und dass Schalthoff wusste, dass er es wusste.
»Aber natürlich.« Der städtische Angestellte hielt die Tür auf, und die beiden Beamten der Mordkommission traten ein. »Ich bin gerne behilflich. Eine schreckliche Sache … Wirklich tragisch.«
Als die Tür hinter ihnen zuklappte, wurde die Musik aus der oberen Wohnung zu einem dumpfen Pulsieren. Schalthoff führte die beiden Polizeibeamten durch einen kurzen Flur ins Wohnzimmer. Fabel registrierte blitzschnell: drei Türen. Zwei Türen geöffnet: kleines Badezimmer mit Toilette, Gästezimmer/Abstellraum und Schlafzimmer. Eine Tür geschlossen, wahrscheinlich das größere Schlafzimmer. Als er am Bad vorbeikam, glaubte Fabel, einen Hauch desselben Desinfektionsmittels zu riechen, den er im Hausflur gerochen hatte.
Zwei Türen offen. Eine Tür geschlossen.
Das Wohnzimmer war sauber und ordentlich. An einem Ende schloss sich eine offene Küche an. Ein Bild zog Fabels Aufmerksamkeit auf sich; es hing an der Dielenwand, dort, wo es ins Wohnzimmer ging. Der Druck eines Gemäldes, es sah wertvoll aus. Schwarz sowie dunkle Blau- und Rottöne dominierten, und die Darstellung war sowohl figürlich als auch abstrakt. Eine Gestalt, ob Frau oder Mann war nicht auszumachen, gekleidet in einen Kapuzenumhang, stand am Ufer eines Flusses. Im Hintergrund schien eine Feuersbrunst eine Stadt zu vernichten, und im Vordergrund spiegelten sich die Figur und die Flammen auf der dunklen, schimmernden Wasseroberfläche wider. Das Gemälde war signiert: Charon.
Das Bild wirkte ein wenig deplatziert in der Wohnung – das gesamte Mobiliar war modern und geschmackvoll, wenn auch nicht sehr hochwertig: ein gut gefülltes Bücherregal unter dem Fenster, ein niedriger Wohnzimmertisch, ein Sofa und zwei Armsessel. Alles nüchtern gestaltet. Auf den Küchenoberflächen stand nichts herum außer einem Kessel, einem Wasserkocher, einem Toaster und einer Mikrowelle. Alles war funktional. Peinlich sauber und ordentlich. Nur der düstere Kunstdruck in der Diele fiel aus dem Rahmen; ansonsten verriet Schalthoffs Wohnung eine kontrollierte Person; jemanden, dem Effizienz und Ordnung Halt boten. Jemanden, der nicht zu Schlampigkeit neigte. Oder zu Chaos.
Doch Jan Fabel, der seit fünfzehn Jahren die Hamburger Mordkommission leitete und sich als Ermittler gegen Serienmörder in der ganzen Bundesrepublik einen Namen gemacht hatte, wusste, dass das nur eine Fassade war: ein sorgfältig konstruierter Zaun, der das dunkle, unbeherrschbare Chaos umschloss, das tief im Inneren Schalthoffs schwelte und brodelte. Etwas, das unter Verschluss gehalten werden musste.
Eine Tür geschlossen.
»Kann ich Ihnen eine Tasse Kaffee oder etwas anderes anbieten?« Schalthoff begleitete die Frage mit einer offenen Geste der Gastfreundschaft.
»Nein, vielen Dank«, erwiderte Anna.
»Aber ich könnte eine Tasse Tee gebrauchen«, sagte Fabel. »Draußen ist es richtig kalt. Wenn es Ihnen nicht zu viel Mühe macht.« Er ließ den Blick über die Bücher im Regal schweifen: Horror, Übersinnliches, eine ganze Reihe Gruselklassiker. Eine Broschüre über den Jüdischen Friedhof in Altona, der zu den von Schalthoffs Behörde verwalteten Liegenschaften gehörte, lag oben auf dem Regal.
»Keineswegs«, antwortete Schalthoff lächelnd. »Tee, haben Sie gesagt?«
»Wenn Sie welchen da haben«, antwortete Fabel. Als ihr Gastgeber sich dem Küchenbereich zuwandte, warf Fabel Anna einen Blick zu. Sie begriff und nickte: Fabel versuchte, Schalthoff zu beschäftigen.
Eine Tür geschlossen.
Eine Tür geschlossen, aber nicht abgeschlossen: Fabel brauchte nur in die Diele zurückzukehren, den Griff hinunterzudrücken und die Tür zu öffnen. Doch er hatte keinen Durchsuchungsbeschluss und keine weiteren Anhaltspunkte außer seinem Instinkt und die Ansicht, dass Schalthoffs Kunst- und Literaturgeschmack im Widerspruch zum Interieur stand. Fabel hatte keine Beweise. Und das machte die lächerlich dünne Schlafzimmertür so effektiv wie einen Burggraben und eine Zugbrücke.
Fabel sah zu, wie der städtische Techniker in der Küche den Tee zubereitete. Unwillkürlich wischte sich Schalthoff die Hände an seinem Overall ab, bevor er eine blassblaue Teekanne aus einem der Schränke holte und sie mit heißem Wasser ausspülte. Dann nahm er eine Tasse aus einem der Hängeschränke. Die Pause war nur ein wenig zu lang: eine Mikrosekunde des Zögerns, als sich seine Hand an einer der Schubladen vorbeibewegte.
Was ist in der Schublade, Jost?, dachte Fabel. Was ist es, das wir nicht sehen sollen? Wieder verfluchte Fabel, dass sie keinen Durchsuchungsbeschluss hatten.
»Ich hoffe, wir halten Sie nicht auf«, sagte Anna, ging zur offenen Küche hinüber und stellte sich so hin, dass Schalthoff die Diele nicht unmittelbar einsehen konnte.
»Nein, keineswegs, ich …«
»Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich Ihre Toilette benutze?«, unterbrach ihn Fabel. Es funktionierte. Der städtische Angestellte wirkte für den Bruchteil einer Sekunde aus dem Gleichgewicht gebracht, runzelte die Stirn und glättete dann seinen Gesichtsausdruck mit einem höflichen Lächeln. Wieder lag so viel in diesem Bruchteil einer Sekunde.
»Nein … Bitte«, sagte er. »Sie ist hinten in der Diele, gleich neben der Tür. Auf der rechten Seite.«
Fabel nickte und kehrte in den Flur zurück. Der Pulsschlag der Musik von oben verstummte für einen Moment, bis er mit einem anderen Rhythmus wieder einsetzte. Hinter ihm hörte er, wie Anna einen Plauderton anschlug.
»Sie haben den kleinen Timo gekannt, soweit ich weiß?«, sagte sie.
»Nein … Wer hat das behauptet?« Schalthoffs Tonfall war neutral. »Vor seinem Verschwinden hatte ich noch nie von ihm gehört. Es ist wirklich traurig, wenn man bedenkt, wie nah er gewohnt hat – im Grunde um die Ecke. Aber so ist halt das Stadtleben, nehme ich an. Anonym.«
Fabel wusste, dass Anna ihn nicht lange aufhalten konnte. Er passierte das Badezimmer und blickte kurz über die Schulter, um sicherzugehen, dass Schalthoff noch in der Küche stand und er außerhalb seines Blickfelds war, bevor er die wenigen Schritte durch die Diele auf sein Ziel zuging.
Er stand vor der geschlossenen Tür. Wenn er sie öffnete und Timos Leiche fand, wäre es eine rechtsunwirksame Durchsuchung. Um seine Suche zu rechtfertigen, würde er lügen müssen und behaupten, er hätte ein Geräusch gehört und damit einen plausiblen Grund gehabt, anzunehmen, dass Timo noch lebte und hinter der Tür gefangen war. Nur, dass Fabel wusste, dass er nicht lügen würde.
Doch wenn ihn sein Bauchgefühl in Bezug auf Schalthoff nicht trog und er und Anna gehen würden, ohne hinter diese geschlossene Tür geblickt zu haben, würden sie das Risiko eingehen, einen noch lebenden Timo seinem Schicksal zu überlassen. Er lauschte. Keinerlei Geräusche drangen durch die Tür. Er hörte Schalthoff und Anna im Wohnzimmer: Smalltalk, doch jetzt mit einem kaum merklichen Hauch von Ungeduld in Schalthoffs Stimme.
Fabel legte die Hand auf den Türgriff.
Bitte, lass mich unrecht haben. Bitte, lass mich nicht derjenige sein, der ihn findet.
Er öffnete die Tür.
Es gab keine Anzeichen dafür, dass irgendetwas nicht stimmte. Kein gefangenes Kind, weder lebendig noch tot. Wie die übrige Wohnung war das Schlafzimmer sauber, ordentlich, ohne dass etwas herumlag, schon eher spartanisch als funktional. Nichtssagende Dekoration.
Doch ebenso wie der Druck, der in der Diele hing und die Bücher in den Regalen, gab es eine Dissonanz im Schlafzimmer: den Kleiderschrank. Er war zu groß für den Raum und hockte dunkel in jener Ecke, in die am wenigsten Licht fiel, als versuche er, seine wuchtige Gestalt im Schatten zu verbergen. Ein massiver, rustikaler, dunkler Holzschrank. In einer Wohnung mit ansonsten modernen, hellen Möbeln wirkte der schwere Schrank vollkommen deplatziert, wie ein Waldgeist, der sich verirrt hatte und sich im falschen Jahrhundert versteckte.
Fabel lauschte wieder und hörte Anna reden. Sie beherrschte die Unterhaltung und beschäftigte ihren widerstrebenden Gastgeber. Von Schalthoff hörte er nur tiefe Töne, überlagert von den Bässen aus einer unsichtbaren Wohnung.
Ein kleiner Raum. Die Durchsuchung würde nicht lange dauern. Fabel wusste, dass er den Kleiderschrank zuletzt durchsuchen würde.
Leise ging er in die Knie und sah unter dem Bett nach. Nichts. Sonst konnte man nirgendwo eine Leiche verstecken, außer in dem unpassenden Kleiderschrank, der dunkel in der Ecke lauerte.
Bitte, mach, dass ich mich irre. Lass mich nicht derjenige sein, der ihn findet.
Drei Schritte brachten ihn hinüber zum Schrank. Darin war das Chaos gefangen, Fabel wusste es. Dort hatte Schalthoff Timos Leiche versteckt.
Der Kleiderschrank hatte Doppeltüren, und Fabel legte die Hand auf den Messingknauf der rechten Tür. Drehte ihn.
Die Tür knarrte, und er überprüfte die Öffnung mit der anderen Hand, stand stocksteif da und horchte, ob ein wutentbrannter Schalthoff in die Diele stürmte. Doch stattdessen hörte er nur den kontinuierlichen Bass, der aus der oberen Wohnung dröhnte, ein ganzes Universum entfernt, und Annas Stimme, als sie weiterhin den Besitzer des Kleiderschranks im Wohnzimmer festhielt. Vorsichtig öffnete er die Tür ganz.
Bitte, lass mich nicht derjenige sein, der ihn findet!
Fabel seufzte und war nicht sicher, ob vor Erleichterung oder Enttäuschung: Es herrschte kein Chaos im Dunkel des Kleiderschranks. Dort gab es nur zwei Anzüge, einen Kurzmantel und drei Freizeitjacken, alles ordentlich auf Bügel gehängt. Vorsichtig öffnete er beide Türen und inspizierte den Boden des Schranks: drei Paar Schuhe, eines davon Arbeitsschuhe.
Er öffnete die andere Seite und sah zwei Paar Jeans, die ebenfalls unangemessen ordentlich an Bügeln hingen. Darunter stand noch ein Paar Stiefel. Sonst nichts. Kein Chaos, kein Horror. Kein Timo.
Fabel schloss die Schranktüren. Und dann sah er den Karton.
Es war ein unversiegelter Pappkarton – ein Umzugskarton –, der in den Raum zwischen Kleiderschrank und Eckwand geschoben war. Er beugte sich hinunter, hob eine Deckelklappe an und fasste hinein.
Oh, Gott, nein! Oh, großer Gott, nein …
Fabel richtete sich abrupt auf und taumelte rückwärts. Er stieß mit der Rückseite der Wade gegen eine Ecke des Bettes, stolperte und stürzte schwer zu Boden. Was er in dem Karton gefühlt hatte, blieb wie ein Phantom in seiner Handfläche zurück.
Du krankes Arschloch. Du krankes Mörderschwein!
Geschrei drang aus dem Wohnzimmer. Überwältigt von seinem Ekel, seiner Wut und seinem Abscheu, konnte Fabel nur raten, dass sein Stolpern gehört worden war und Anna den Kampf, Schalthoff zu beschäftigen, verloren hatte. Es war ihm egal. In diesem Moment war er nicht länger Fabel, der Polizist, sondern Fabel, der Vater. Er wollte nur noch eines: Schalthoff packen und ihm die Faust ins Gesicht rammen.
Er eilte aus dem Zimmer hinaus und die Diele entlang, seine Gedanken rasten, das Phantomgefühl weicher Locken auf dem Kopf eines toten Kindes brannte in seiner Handfläche.
Anna stritt nicht, sie schrie. Schalthoff brüllte.
Als er das Ende der Diele erreichte, knöpfte Fabel seine Jacke auf und griff nach der Dienstpistole auf seiner Hüfte.
Alles geschah in nur wenigen Sekunden, doch die Zeit verlangsamte und dehnte sich. Fabel erreichte das Ende der Diele, von wo aus es ins Wohnzimmer ging, und sein erster Gedanke war: Wo kommt die Waffe her? Dann erinnerte er sich an die Schublade. Die Waffe war in der Schublade gewesen. Keine Trophäe von einem ermordeten Kind, kein eilig versteckter, belastender Beweis: eine Waffe. Schalthoff war um Anna herumgegangen und stand ihr jetzt gegenüber, mit dem Rücken halb zu Fabel. Der Mörder hatte die Arme vor sich ausgestreckt und hielt einen Revolver mit eisernem Griff umklammert. Fabel konnte sein Profil sehen: aschfahl, die Gesichtszüge verzerrt in einem Widerstreit zwischen Schrecken und Wut. Anna hielt eine Hand zu ihm hin erhoben, als wolle sie den fließenden Verkehr aufhalten. Die andere Hand war im Griff nach ihrer Waffe erstarrt.
Sie schrien sich an: Schalthoff brüllte in existenzieller Wut, Anna rief professionell Befehle. Fabel blieb stehen, bisher unentdeckt, und griff nach seiner Waffe.
In dem Moment bemerkte Anna ihn.
Schalthoff folgte ihrem Blick und drehte sich um.
Fabel hörte drei Schüsse, ohrenbetäubend laut in der Enge der Wohnung. Zwei schnell hintereinander, dann einen dritten, der anders klang.
Die Welt geriet aus den Angeln. Kippte. Bebte.
Fabel lag auf dem Rücken.
Das Universum schnurrte zum Winkel zwischen Wand und Stuckdecke zusammen, wo die Diele ins Wohnzimmer überging. Er hörte Geschrei und einen weiteren Schuss. Er hatte keine Schmerzen. Alles, was er spürte, war das äußerst merkwürdige Gefühl, dass etwas Schweres wie ein Zementblock auf seine Brust gefallen war und seine Lungen daran hinderte, sich mit Luft zu füllen. Und er hatte Angst. Furchtbare Angst. Er hatte Angst, weil er nicht atmen konnte; er hatte Angst, weil er keinen Schmerz fühlen konnte; er hatte Angst vor dem Schmerz, der kommen musste.
Er hat mich erschossen. Dieser Gedanke und der Zorn, mit dem er brannte, durchdrangen seine Furcht. Ich habe alle enttäuscht, weil ich zugelassen habe, dass der Scheißkerl mich erschießt.
Das Schreien hatte aufgehört. Sogar die Bässe aus der oberen Wohnung waren abrupt verstummt. Sie müssen die Schüsse gehört haben.
Von dort, wo er lag, konnte Fabel das Bild an der Wand sehen. Durch seine Angst und Wut hindurch dämmerte es ihm: Charon ist nicht der Künstler, sondern die Gestalt.
Anna beugte sich über ihn, blickte auf ihn hinunter, nahm ihm die Sicht auf sein Universum aus Wand und Stuckdecke. Ihr Gesicht war voller Angst und Panik, und das machte Fabel traurig. Er erinnerte sich daran, wie sie zur Mordkommission gekommen war, wie spröde und schwierig im Umgang sie gewesen war. So jung. Er erinnerte sich daran, wie sie mit Paul Lindemanns Tod im Dienst umgegangen war, vor so vielen Jahren, und es erfüllte Fabel mit tiefem Kummer und Zorn über seine eigene Ungeschicklichkeit, als er erkannte, dass sie jetzt mit seinem Tod würde umgehen müssen. Sie redete laut und eindringlich auf Fabel ein, zerrte an seinem Hemd, drückte auf seine Brust und verstärkte damit noch das erstickende Gewicht.
Sie weinte. Fabel hatte Anna Wolff noch nie zuvor weinen sehen.
Er dachte an Gabi, seine Tochter. Und an Susanne. Er hätte Susanne heiraten sollen. Hätte sie fragen sollen.
Er versuchte zu reden. Er versuchte zu sagen: Der kleine Timo ist im Schlafzimmer. Vergiss den kleinen Timo nicht. Aber er hatte keine Worte. Keinen Atem.
Dann kam er: der Schmerz, den Fabel befürchtet hatte. Er verzehrte ihn, schoss durch jeden Nerv in seinem Körper wie elektrischer Strom: glühend heiß, stechend. Er sah Anna flehend an, unfähig, zu sprechen, unfähig, irgendetwas außer seinen Augen zu bewegen. Sie benutzte ihre freie Hand, um mit ihrem Handy zu telefonieren. Sie sprach drängend, verzweifelt, erstickt vor Kummer und Panik. Doch Fabel konnte nicht hören, was sie sagte, denn jetzt schrillte der Schmerz in seinen Ohren, durchbohrte seinen Kopf, verbrannte jeden Millimeter seines Körpers und steigerte sich über das Unerträgliche hinaus. Es war sowieso zu spät.
Jan Fabel lag bereits im Sterben.
2
Während Jan Fabel seinen Verletzungen erlag, erfüllten zwei Dinge – und nur diese zwei Dinge allein – sein ganzes Wesen. Schmerz und Angst. Der Schmerz versicherte ihm, dass er am Leben sei, die Angst schrie ihm zu, dass der Tod bevorstand.
Dann ließ der Schmerz nach. Es folgte ein Moment eisiger Kälte, als wären alle Fenster und Türen aufgerissen worden und der Winter hätte von der gesamten Wohnung Besitz ergriffen. Dann spürte er nichts mehr.
Fabel wusste, dass die Schäden an seinem Körper noch da waren, dass jede Faser vor Qual glühte, doch die Verbindung war unterbrochen: noch nicht abgerissen, nur unterbrochen. Die Angst blieb, aber nur für einen Augenblick; dann war auch sie verschwunden. Er war den Vorgängen der Angst und des Schmerzes enthoben worden, die, wie er jetzt erkannte, rein körperlich waren, nicht geistig. Fabel wusste, dass seine Verbindung zu seinem Körper mit jedem Augenblick schwächer wurde, dünner, unwichtiger. Er wurde nicht länger über seine physische Gestalt definiert.
Ich sterbe, dachte er, ohne Angst oder Traurigkeit, Verbitterung oder Sorge. Und in diesem Moment wurde er sich der langsamen, mahlenden Rotation der Erde unter ihm bewusst.
Er ging jetzt fort.
Er sah, wie Annas trauriges, ängstliches Gesicht allmählich verblasste; das Bild und die Stuckdecke hinter ihr sich verschatteten. Alles wurde dunkel, aber anders als jede Dunkelheit, die er je gekannt hatte, war es kein farbloses Dunkel. Das gesamte Farbspektrum tanzte in sanftem Glühen und lebhaftem Flackern durch sein Blickfeld.
Die Welt war verschwunden. Die Welt, so erkannte er nun, war niemals wirklich da, niemals wirklich real gewesen. Dies hier war real, was immer es sein mochte. Alles, was er je im Leben erfahren hatte, war verblasst, gedämpft, verschwommen. Jetzt erlebte er wahre Realität, in der alles schärfer, klarer, heller war. Er war körperlos, von jeder Form befreit; überall um ihn, in ihm, durch ihn wurden die Farben intensiver, variationsreicher: Er sah jetzt Farben jenseits des bekannten Spektrums, Farben, von deren Existenz er nichts gewusst hatte. Er blickte tief in sich selbst hinein; er sah mit augenloser Klarheit die unfassbare Schönheit seiner eigenen Existenz – Spiralen von Licht und Energie, aus denen er gemacht war, eine endlose Spule, die nicht nur ihn, sondern alle Generationen umfasste, die vor ihm dagewesen waren. Er hatte Erinnerungen, die nicht seine eigenen waren, aber in seine Erschaffung eingeflossen waren. Er versank im warmen, bodenlosen Ozean seines eigenen Bewusstseins und fand Antworten auf alles, was ihm je rätselhaft geblieben war.
Dinge geschahen, Gedanken kamen, Visionen entwickelten sich simultan und dennoch nicht wirr durcheinander. Es gab keine Reihenfolge, denn Fabel war, so erkannte er, jenseits der Chronologie, außerhalb der Zeit, und alles, was er erfuhr, existierte gleichzeitig.
Irgendwie spürte Fabel, ohne dass es ein körperliches Gefühl war, da ihm ein Körper jetzt als unnatürliches, fernes Konzept erschien, dass er sich in Bewegung gesetzt hatte und eine ungeheure Geschwindigkeit aufnahm. Das Licht und die Farben um ihn verzerrten und dehnten sich, und er erkannte, dass er durch einen Tunnel ohne feste Form reiste. Ein helles Licht, das ihn geblendet hätte, hätte er noch Augen gehabt, schien alles zu erfüllen. Jan Fabel empfand eine Euphorie, wie er sie noch nie zuvor erlebt hatte. Eine tiefe, intensive, vollkommene, unbeschreibliche Freude.
Im selben Moment, und ohne ein Gefühl der Bewegung, schwebte er hoch und blickte hinunter auf die Große Brunnenstraße. Der regennasse Asphalt glänzte und reflektierte einander überlappende Blaulichter von den Streifenwagen und dem Rettungswagen, die draußen vor dem Wohnhaus standen. Plötzlich wurde es hektisch, als mehrere Sanitäter und Polizisten aus dem Haupteingang stürzten und eine fahrbare Trage hinüber zu den offenen Türen des Rettungswagens schoben. Ein Notarzt rannte neben der Trage her, beugte sich darüber und arbeitete am Körper eines blonden Mannes Ende vierzig. Eine Sauerstoffmaske verbarg das Gesicht des Patienten, sein Hemd war aufgerissen, und auf dem leuchtenden Weiß der Wundverbände blühte rot das austretende Blut. Fabel beobachtete die Szene leidenschaftslos und desinteressiert: Der Körper auf der Trage war seiner gewesen, doch jetzt hatte er nichts mehr damit zu tun und keine Verwendung mehr für ihn. Er sah zu, wie die Trage in den Rettungswagen geschoben wurde und Anna Wolff, die hinterhergerannt war, zu ihm hineinkletterte.
Er erinnerte sich daran, als erinnere er sich an eine Geschichte, dass er einstmals beruflich Todesfälle untersucht und zahllose Leichenfundorte inspiziert hatte, und er fragte sich jetzt vage, wie viele der Toten mit derselben leidenschaftslosen Neugier auf ihn hinuntergeblickt hatten, während er sich über ihre sterblichen Überreste gebeugt hatte.
Fabel schwebte weiter nach oben, höher über der Szenerie. Er war jetzt hoch über Altona und stellte überrascht fest, wie nahe Schalthoffs Wohnung bei seiner eigenen in Ottensen gelegen hatte. Jetzt sah er ganz Altona und weit darüber hinaus. Sein Sehsinn war schärfer, umfassender und klarer als im früheren Leben. Er nahm alles rings um sich wahr, in jede Richtung. Er befand sich jetzt über der Palmaille und konnte ganz Hamburg sehen. So viel Wasser. Hamburgs Element schimmerte in der Nacht: die Seen der Binnen- und Außenalster, die Bögen der Elbe durch die Stadt, die tiefen Häfen von Finkenwerder. Er sah die Lichter entlang der Reeperbahn jenseits von St. Pauli funkeln. Er konnte in alle Richtungen gleichzeitig sehen, und die ganze dunkle Stadt – von Blankenese bis Altengamme, von Sinstorf bis Wohldorf – glitzerte mit harter, obsidianscharfer Klarheit.
Fabel begriff, warum er hier war, vorübergehend zurück von diesem anderen Ort, der weder ein Ort noch eine Zeit war. Er hatte diese Stadt so sehr geliebt. Er war gekommen, um sich zu verabschieden.
Plötzlich dehnte sich seine Sicht noch weiter aus und reichte über das flache, dunkle, samtige Land jenseits der Stadt bis hin zu den verstreuten, kleinen Agglomerationen der erleuchteten Städte und Dörfer.
Wieder empfand er ein Gefühl der Beschleunigung, von Farbe und Licht. Hamburg lag nicht länger unter ihm. Wieder war nichts von der Welt, die er gekannt hatte, übrig geblieben. Er wusste, dass er zurück an jenem Ort war, wo die Gesetze der Physik vollkommen verändert waren, und wieder raste die Zeit vorbei und stand die Zeit still. Der Moment, den er einnahm, war sowohl fließend als auch ewig.
Er bewegte sich immer schneller auf das Licht zu, das mehr als ein Licht war. Es war vom reinsten Weiß; dennoch konnte er darin jede Farbe unterscheiden, aus dem es zusammengesetzt war. Er wurde immer schneller, und während seiner Reise spielte sich sein ganzes Leben vor ihm ab. Alles, jede Begegnung, jeder Anblick, jedes Geräusch, jeder Geruch, jede Berührung. Er durchlebte alles noch einmal, was er je getan hatte, jeden, den er je gekannt hatte, alles Unrecht und alles Recht.
Als das Licht näher kam, empfand Jan Fabel wieder diese innigste Freude. Sie durchflutete ihn, erfüllte sein Wesen. Sterben war wunderschön. Der schönste Teil des Lebens, erkannte er, war sein Ende.
Sein Vater erwartete ihn. Seine Großeltern.
Paul Lindemann, der junge Offizier, den er bei einer Schießerei verloren hatte und der seitdem seine Träume heimsuchte, war auch da, doch anders als in den Träumen war Pauls Stirn nicht von einer Einschusswunde entstellt. Fabel sah den kleinen Timo Voss, dessen wissendes Lächeln ihn spüren ließ, dass er das Kind war und Timo der Träger großer Weisheit. Zahllose andere, längst Verstorbene waren dort, und Fabel erkannte einige von ihnen als diejenigen wieder, die er erst nach ihrem Tod gut kennengelernt hatte: die Opfer der Morde, die er untersucht hatte. Sie hießen ihn alle willkommen, und ohne zu sprechen – ohne die Fähigkeit zu sprechen –, erzählte ihnen Fabel, wie glücklich er war, bei ihnen zu sein. Und die ganze Zeit wurde das Licht, das mehr als ein Licht war, heller, wärmer, beglückender.
Etwas zerbarst tief in ihm: eine heiße, brennende, intensive Explosion. Ein riesiger Schatten, wie der Schlag einer breiten dunklen Schwinge, trübte flackernd das Licht.
»Was geschieht da?«, fragte er seinen Vater.
»Es ist noch nicht soweit. Keine Sorge, Sohn. Deine Zeit ist einfach noch nicht gekommen.«
Noch eine Explosion. Diesmal begleitet von einer Welle intensiver, brennender Schmerzen. Das Licht um ihn verdunkelte sich erneut. Diejenigen, die auf ihn warteten, wurden zu Schatten.
Wieder. Noch ein unerträglicher Schmerz.
Alles um ihn war verschwunden. Ein dunkles Rauschen. Ein Zurückfallen in die Welt.
Er war wieder in Hamburg.
Noch einmal blickte Jan Fabel hinunter auf seinen Körper. Er wusste, wo er war: in der Notaufnahme des Asklepios-Krankenhauses in Altona. Von irgendwo dicht unter der Decke sah er zu, wie ein Team von vier Ärzten an seinem Körper arbeitete. Drei traten zurück, während der vierte die Defibrillator-Paddles auf seine Brust drückte.
Die Szene, auf die er hinunterblickte, verschwamm. Es folgte eine neue Eruption dunkler Energie und Schmerzen, als der Impuls ihn durchzuckte und ihn wieder mit seinem Körper vereinte.
Die übermenschliche Klarheit und Hellsichtigkeit waren verschwunden. Der Frieden und die Freude, die er empfunden hatte, verloschen.
Jan Fabel sank zurück in die Dunkelheit des Lebens.
Teil Eins
Zwei Jahre später
3
Als er erwachte, war sein erster Gedanke, dass seine Frau die Gardinen offen gelassen hatte, wie sie es gerne tat. Sein zweiter Gedanke war, dass der Nachthimmel jenseits des Fensters wolkenlos sein musste, da eine umgekehrte Scheibe von grauweißem Mondlicht auf dem Teppich vor seinem Bett zu liegen schien. Er war verwirrt, stützte sich auf den Ellbogen und blickte sich im mondlichtbeschienenen Zimmer um, analysierte eine ihm fremde Geometrie von Schatten und versuchte, sich daran zu erinnern, ob er dieses Zimmer kannte, wo es war und was er hier tat.
Er bemühte sich, das dunkle Rechteck in den Schatten der hinteren Wand einzuordnen. Ein Gemälde? Und aus der Dunkelheit neben seinem Bett glühten Zahlen in bösartigem Rot: 01:44 Uhr. Was war das für ein Ort?
Die Panik ließ nach. Es fiel ihm wieder ein. Ich erinnere mich an alles. Ich weiß wieder alles und weiß, dass ich es bald vergessen werde.
Die glühenden Zahlen stammten von einem Wecker. So waren die heutzutage gemacht. Das Rechteck an der Wand war kein Bild, sondern ein Fernseher. Heutzutage machten sie sie so dünn wie einen Bilderrahmen.
Heutzutage.
Er erinnerte sich an alles. Er wusste wieder, dass seine Frau die Gardinen nicht offen gelassen haben konnte, weil sie vor zwanzig Jahren gestorben war. Ihr Gesicht im Alter von dreißig, fünfzig, siebzig stand ihm wieder klar vor Augen.
Er wusste wieder, wer er war, Georg Schmidt, pensionierter Buchhändler aus Ottensen.
Er wusste wieder, dass er schon vor langer Zeit hätte sterben sollen, dass er alt war, sehr alt, und das schwere Gewicht der Jahre zog an ihm, als er sich zum Sitzen aufrichtete. Er hatte geträumt. Er hatte geträumt, er wäre wieder jung und bewohnte eine Welt mit schwächerer Gravitation, wo die Bewegungen unbeschwert, automatisch und gedankenlos abliefen. Dann erkannte er, dass er das gar nicht geträumt hatte. Das war erst gestern gewesen und er war wach. Sein nachlassendes Gedächtnis hatte ihm vorgespielt, er wäre wieder jung, es nahm Fragmente von Erinnerungen und drehte sie von innen nach außen, machte ihn glauben, die Vergangenheit sei die Gegenwart. Das wusste er jetzt auch wieder: dass der Palast der Erinnerungen, den er im Laufe eines fast hundertjährigen Lebens aufgebaut hatte, im Begriff war, zu zerfallen und einzustürzen.
Und er wusste wieder, dass Momente wie dieser, Augenblicke im Hier und Jetzt, seltener wurden, weniger häufig, weniger zuverlässig. Er musste sich an solche Momente klammern. Er musste sie festhalten, weil er eine wichtige Aufgabe zu erfüllen hatte, bevor die letzten Stränge seiner Erinnerungen endgültig zerfaserten.
Er nahm sich zusammen. Er richtete seine ganze Konzentration auf diesen einzigen Moment, stürzte sich auf die Klarheit seiner Gedanken und klammerte sich daran. Er wusste, wo er war: im Altenheim Alte Mühle in Altona. Wo sie die Alten vor den Jungen verborgen hielten und das Heute vor dem Gestern.
Ich bin Georg Schmidt, sagte er sich. Ich bin Georg Schmidt und war 1932 dabei. Ich habe alles mit angesehen, aber keiner hat mir geglaubt. Ich bin Georg Schmidt, ich lebe im Altenheim Alte Mühle, und mein einziger Freund hier ist Helmut Wohlmann. Ich bin Georg Schmidt, spiele jeden Abend Dame mit meinem Freund Helmut Wohlmann, und wir reden über die alten Zeiten.
Ich bin Georg Schmidt, und ich werde bald tot sein. Doch bevor ich sterbe, muss ich Helmut Wohlmann töten.
4
Frankenstein saß in der Zelle, im Dunkeln, und die rituellen Abendgeräusche gefangener Männer und ihrer Wächter hallten zwischen dem Beton, Stahl und Backstein des Gefängnisses wider. Reglos saß er da, ein massiver, unheilvoller Schatten, etwas noch Dunkleres in der Dunkelheit. Er hatte die Zelle für sich allein, isoliert sowohl von jenen, die ihn verletzen würden, als auch von jenen, die er verletzen würde.
Jochen Hübner wusste, dass er ein Monster war. Er sah seine Monstrosität im Spiegel und in den Gesichtsausdrücken jener, die einen Blick auf ihn erhaschten, ein angstvolles oder unbehagliches Zucken in rasch abgewandten Augen. Er war ein wandelnder Albtraum. Stoff für Schauermärchen.
Und wie die meisten Ungeheuer in Horrorgeschichten war er von Menschen erschaffen worden. Jedenfalls teilweise. Er hatte gelernt, dass man zu dem wird, was andere in einem sehen und was andere einem weismachen, dass man sei. Die Natur mochte ihn geformt haben, die Menschen aber hatten ihn definiert. Eine winzige Abnormität in seinem Inneren – eine winzige Wucherung auf einer winzigen Drüse – hatte zur unübersehbaren Abnormität seines Äußeren geführt. Sie hatte ihn für andere zum Ungeheuer gemacht, zu etwas Angsteinjagendem. Die Menschheit hatte ihn geformt: indirekt durch ihre Angst und Abscheu vor seinem Aussehen, unmittelbar durch die stümperhafte medizinische Wissenschaft, die durch den Versuch, ein Problem zu lösen, ein weiteres hervorgerufen hatte.
Sie nannten ihn Frankenstein. Alle nannten ihn hinter seinem Rücken so; nur wenige waren dämlich genug gewesen, es ihm ins Gesicht zu sagen. Hübner wusste, dass Frankenstein im Buch und in den Filmen der Erschaffer war, nicht die Kreatur, aber die Leute waren dumm. In jedem Fall hatte die Beleidigung keinen Stachel: Er war Frankensteins Monster. Er genoss die Angst in den Augen der anderen, wenn sie ihn sahen. Besonders die Angst in den Augen der Frauen. Er würde nie die Liebe der Frauen gewinnen, würde auch nie die Liebe der Frauen begehren, aber er konnte ihre Angst und ihren Schmerz bekommen. Sich daran laben. Und dieses Verlangen hatte ihn an diesen Ort geführt. Doch schon bald würde er draußen sein; er würde frei und unter den Frauen sein. Unter ihrer süßen, süßen Angst und ihrem Schmerz. Er würde ihn trinken wie Wein.
Er war von der Flucht wie besessen gewesen, nachdem man ihn hier nach Hamburg-Fuhlsbüttel gebracht hatte. Der Gedanke hatte ihn verzehrt, und er hatte jede wache Stunde damit verbracht, nach Schwächen und Fehlern im Sicherheitssystem des Gefängnisses zu suchen und Fluchtpläne zu ersinnen. Doch im Laufe der Zeit hatte er erkannt, dass eine Flucht unmöglich war, und die Besessenheit war einem Konzept gewichen, das er mit sich herumtrug wie eine verborgene Strickleiter, bereit, sie herauszuziehen und auszurollen, wenn sich die Gelegenheit bot.
Doch das tat sie nie.
Sogar das Konzept, die Vorstellung der Flucht, war nach und nach verblasst, und er hatte sich darauf konzentriert, seine neue und unvermeidliche Realität zu meistern. Frankenstein hatte begonnen, die anderen Insassen einzuschüchtern und zu dominieren, sogar manche der Schließer. Seine Größe und sein brutales Aussehen reichten oft schon, um seinen Status aufrechtzuerhalten. Und wenn mehr als Psychologie nötig war, hatte er sich als zu solch teuflischen Dingen fähig erwiesen, dass sie sogar diese hartgesottenen, gewalttätigen Männer schockiert hatten. Er passte sich an, fand sich aber niemals mit seiner Situation ab.
Er hatte sich stärker an Aktivitäten beteiligt, las mehrere Stunden pro Tag, nahm sogar an den Sozialtherapiesitzungen teil, in der schwachen Hoffnung, dass vorgeschützte Besserung eine Verkürzung seiner Gefängnisstrafe bedeuten würde. Und es war während der Sozialtherapiesitzungen gewesen, in der unwahrscheinlichsten Situation und in der unwahrscheinlichsten Form, dass er sein Mittel zur Flucht fand. Seinen Beschützer.
Bei jeder Sitzung wurde ihm ein wenig mehr erklärt, ein unauffälliger Puzzlestein nach dem anderen. Die Gelegenheit, die Mittel, das Risiko. Und das Risiko war gewaltig: Bevor er seine Freiheit erlangte, würde er durch ein Portal gehen müssen, das sicherer war als jedes Gefängnistor. Er würde sterben oder jedenfalls an den äußersten Rand des Todes geholt werden müssen. Dort angekommen, würde er zurück ins Leben und ins Bewusstsein gebracht werden müssen. Alles musste präzise getimt werden, auf die Sekunde genau; jede Verzögerung bedeutete, dass er möglicherweise nicht wiederbelebt werden könnte, oder wenn, dann nur mit schwerem Hirnschaden.
Es war ein akzeptables Risiko: Tod oder Verblödung waren immer noch besser, als den Rest seines Lebens hier zu verbringen; beides würde ihn seiner Umgebung gegenüber abstumpfen. Er wusste, wenn er noch länger hierbliebe, würde er mit Sicherheit einen der anderen töten und die letzte Hoffnung einer vorzeitigen Entlassung damit zerstören. Oder aber einer der anderen oder eine Gruppe der anderen würde den Mut finden, ihn zu töten.
Er saß da, dachte über all diese Dinge nach und stellte sich vor, wie es sein würde, wenn er tot wäre. Wenn der Plan nicht funktionierte und er starb, würde er wenigstens Frieden finden.
Die abendlichen Gefängnisgeräusche verstummten, und er richtete seine Konzentration nach innen, auf seine Empfindungen, sein Wesen. Konzentrierte sich auf seine Atmung, zählte jeden Atemzug, richtete seinen Geist auf die einfachsten Mechanismen des Lebens. Einer aus dem Sozialtherapieteam hatte ihm Meditationstechniken beigebracht: eine Strategie, sich von der Wut zu distanzieren. Doch dafür benutzte er sie nicht: stattdessen verwendete er die Meditation darauf, seine Gedanken auf sein ganzes Sein zu fokussieren, die Dunkelheit zu komprimieren und die Bosheit in ihm zu verdichten. Und hauptsächlich übte er zu erwachen; nicht langsam, wie aus dem Schlaf, sondern abrupt, im Bruchteil einer Sekunde.
Er zählte seine Atemzüge.
Wenn er seine Chance erhielt, würde er in einem Augenblick hellwach werden müssen. Er würde in dem Moment, wo man ihn wiederbelebte, fähig sein müssen, schnell und präzise zu reagieren; der Erfolg hing davon ab, dass er sie kalt erwischte.
Dann, und nur dann, würde er imstande sein, von der Angst der Frauen zu zehren – und sich an dem Mann zu rächen, der ihn hier reingebracht hatte. Sie würden alle erfahren, was es bedeutete zu leiden.
5
Jan Fabel saß bei laufendem Motor im Wagen und starrte auf den Rücken des schwarzen Einsatzanzugs mit der breiten Aufschrift BEREITSCHAFTSPOLIZEI. Die junge Polizistin, die den Verkehr angehalten hatte, blickte hin und wieder über die Schulter und überprüfte, wie weit der Stau reichte. Sie war klein, vielleicht nur einen Meter sechzig groß, aber unförmig und geschlechtslos in der aufgeplusterten, geborgten Autorität von Anzug und zusätzlicher Schutzbekleidung. Den Helm trug sie eingehakt am Gürtel, auf dem Kopf die normale Uniformmütze. Ihr Haar war zurückgekämmt und im Nacken zu ordentlichen Zöpfen geflochten. Doch darin verwoben war ein schmales, knallrotes Band: ein diskretes Zeichen der Individualität, das Fabel aus irgendeinem Grund aufheiterte. Seit jeher fielen ihm solche kleinen Dinge auf, doch inzwischen bemerkte er sie um ihrer selbst willen, nicht nur als Fragmente einer verborgenen Geschichte oder Kennzeichen einer verheimlichten Persönlichkeit. Nicht mehr nur als Indizien.
»Möchtest du, dass ich ihr sage, sie soll uns durchlassen?«, fragte Anna Wolff ruhig. Auch jetzt noch, zwei Jahre nach der Schießerei, verhielt sie sich ihm gegenüber anders: gelassener, vorsichtiger, weniger ungeduldig; jede Interaktion war in ein Geflecht unausgesprochener Gedanken gehüllt. Er wusste, ohne je mit ihr darüber geredet zu haben, dass sie sich für das Geschehene verantwortlich fühlte, ja, dass sie sogar Schuldgefühle deswegen hatte. Er hätte ihr gern gesagt, dass das nicht nötig sei, und würde es irgendwann tun. Seit der Schießerei ließ er nichts mehr unausgesprochen. Zunächst hatte dies sein Umfeld befremdet, man fand, er habe sich verändert. Die Leute waren geduldig mit ihm, nachgiebig, verständnisvoll und mitfühlend. Doch mit der gleichen Aufrichtigkeit hatte er ihnen gesagt, er brauche ihr Mitleid nicht.
Er hatte eine posttraumatische Therapie erhalten. Psychiatrische Gutachten waren angefertigt worden. Er hatte zu verstehen gegeben, dass er all das ebenfalls nicht brauchte. Auch Physiotherapie hatte er bekommen, monatelange schmerzhafte Behandlungen, und diese hatte er gebraucht. Dringend gebraucht.
Bei seiner Rückkehr hatte es sogar ein langes Gespräch mit dem Polizeipräsidenten Hugo Steinbach gegeben. Steinbach, der inzwischen pensioniert war, hatte offen seine Sorge um seinen jüngeren Beamten geäußert. Es war die Rede von einer Versetzung in eine andere Dienststelle gewesen, und wieder hatte Fabel mit seiner Offenheit brüskiert: Er hatte Steinbach auf den Kopf zugesagt, dass er seine Versetzung aus der Mordkommission nicht wirklich wollte und er ihn dort auch gar nicht entbehren konnte. Er könne verstehen, dass Steinbach sich ernsthafte Sorgen mache, wisse aber auch, dass er vorgegebenen Richtlinien im Umgang mit Mitarbeitern folgte. Er hatte ihm erklärt, er sei keine gequälte Seele, was man offenbar annahm, nur weil er angeschossen worden war oder weil er sich anderthalb Jahrzehnte lang mit dem Tod beschäftigt hatte. Vielmehr sei er zufrieden. Er erklärte, er sei mehr als fähig, zurückzukehren und sich weiterhin um die Toten zu kümmern.
Die Angelegenheit wurde nie wieder erwähnt. Weder von Steinbach noch von seinem Nachfolger.
Fabel nahm sich vor, Anna zu sagen, sie solle sich keine Vorwürfe mehr wegen damals machen. Aber erst später. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen war.
Er schüttelte den Kopf. »Wir haben es nicht eilig, Anna. Auf eines kann man sich bei den Toten verlassen: Sie laufen nicht weg. Und es hätte wahrscheinlich sowieso keinen Sinn …« Er nickte in Richtung der Ursache für die Verspätung, die sich mit hohem Tempo näherte: Eine Kolonne schwer gepanzerter Polizeifahrzeuge donnerte auf sie zu und über die Kreuzung hinweg wie ein Güterzug über einen Bahnübergang, so dass die kleine, uniformierte Polizistin unwillkürlich einen Schritt zurückwich. Mehrere Busse mit SEK, drei gepanzerte Autos und ein Wasserwerfer bildeten die Kolonne, angeführt und gefolgt von je einem Streifenwagen mit Blaulicht. Es sah mehr nach militärischem Eingreifen als nach Polizeieinsatz aus.
»Ist das die gute oder die schlechte Nachricht?«, fragte Anna. »Es scheint, die Lage gerät außer Kontrolle. Hast du gestern Abend im Fernsehen die Berichte über die Krawalle von Wandsbek gesehen?«
»Ja.« Fabel hatte brennende Autos, fliegende Molotowcocktails und geschwungene Polizeiknüppel vor dem abendlichen Frühlingshimmel gesehen.
»Kriegsgebiet. Und wir sitzen mittendrin. Aber wenn es heute zur Sache geht, werden die Krawalle am Ersten Mai, das Schanzenfest, die Rote Flora und Wandsbek zusammen nichts dagegen sein.«
»Hoffen wir einfach, dass es nicht zu sehr eskaliert. Ich wohne hier. Ich habe keine Lust, mit anzusehen, wie Altona zum Kriegsgebiet wird.« Doch genau das würde geschehen, das wusste Fabel. Nach neuesten Schätzungen würden dreitausend Rechtsextreme durch das Herz des traditionell linken Altona marschieren und dabei auf eine Gegendemonstration von achttausend Antifaschisten treffen. Wie Anna richtig bemerkt hatte, würde dabei mal wieder die Bereitschaftspolizei ins Kreuzfeuer und ins Rampenlicht geraten. Das Image der Polizei Hamburg war immer das erste Opfer.
Die Demonstrationen riefen hier in Altona ferne Erinnerungen hervor. Fern, aber nicht verblasst: Erinnerungen, die nie vergessen werden durften.
Die Kolonne zog vorüber, und als sie endgültig außer Sichtweite war, winkte die kleine Polizistin sie durch.
Eines hatte Jan Fabel im Laufe der Jahre gelernt: Die Toten harrten an milden Spätfrühlingstagen ebenso ihrer Entdeckung wie in Kälte und Regen. Er hatte Blut im Sommersonnenlicht glänzen und dunkle Flecken im Winterschnee bilden sehen. Für Gewalt, so wusste er, gab es keine bestimmte Wetterlage. Mörder kannten keine Jahreszeiten.
Er hatte aufgehört, die Leichen zu zählen, die er im Laufe der Jahre zu Gesicht bekommen hatte. Manche sahen täuschend lebendig aus: als schliefen sie nur und seien gar nicht tot. Andere waren traurig und mitleiderregend, in Angst und Qual wie Föten zusammengerollt. Dann gab es die Toten, die nach einer Woche im Wasser aus der Elbe gefischt wurden, mit faulig riechendem, weichem und glitschigem Fleisch wie verdorbene Hühnchen. Und dann gab es sterbliche Überreste wie die, auf die er jetzt blickte: die fleischlosen, das Durcheinander von Knochen und das nackte Grinsen von Schädeln. Obwohl Skelett und Schädel die universellen Symbole des Todes waren, konnte Fabel diese Überreste aus unerfindlichen Gründen nur selten mit etwas Menschlichem, ob tot oder lebendig, assoziieren, als seien ihre Identitäten mit ihrem Fleisch von ihnen abgefallen. Sie erschienen ihm mehr als Objekte denn als etwas einst Belebtes, alles andere als eine ehemalige Person.
»Sie stammen von einer Frau, einer Erwachsenen.« Holger Brauner schnaufte, als er aus der ausgehobenen Grube herauskletterte. »Alter zwischen sechzehn und dreißig.«
»Irgendeine Ahnung, wie lange das Skelett hier gelegen hat?«, fragte Fabel. Brauner streifte schnalzend einen Latexhandschuh ab und schüttelte Fabel die Hand. Der Leiter der Mordkommission und der Rechtsmediziner waren schon so lange befreundet, wie sie Kollegen waren. Brauner hatte sich die Zeit genommen, Fabel in den ersten entscheidenden Wochen nach der Schießerei jeden Tag im Krankenhaus zu besuchen.
Er wies mit dem Kinn in Richtung einer Baustelle auf der anderen Straßenseite. »Da drüben wird neu gebaut, und sie mussten diesen Graben hier ausheben, weil sie die Wasserleitungen verlegen müssen. Nur ein halber Meter weiter rechts oder links, und sie wäre vielleicht nie gefunden worden.«
Fabel nickte. Die Knochen lagen in einem schmalen Graben, der winkelförmig in einer Ecke des Parkplatzes ausgehoben worden war.
»Ich kann sehr genau sagen, wann die Leiche hier vergraben wurde.« Brauner grinste breit, wie es typisch für ihn war. Früher, bevor er angeschossen worden war, hatte sich Fabel immer gefragt, wie jemand, der jeden Tag mit der physischen Realität des Todes zu tun hatte, so fröhlich sein konnte. Nach der Schießerei verstand er es vollkommen. »Der Parkplatz wurde vor fünfzehn Jahren angelegt, und dieser Boden ist als Untergrund aufgeschüttet worden. Ich nehme an, dass der Mörder von der Baustelle wusste, die Leiche hier vergraben und die Stelle anschließend so geglättet hat, dass niemand etwas merkte. Die Bauarbeiter erledigten die restliche Arbeit für ihn, als sie die Fläche asphaltierten. Also haben wir ein sehr genaues Zeitfenster: zwischen März und Mai zweitausend.«
»Was ist los?« Anna Wolff hatte offenbar Fabels Gesichtsausdruck bemerkt.
»Sie war fünfundzwanzig«, sagte Fabel. »Gerade geworden.«
»Ich habe das Alter nur ungefähr bestimmt, sie könnte auch jünger gewesen sein«, erwiderte Brauner. »Aus den Beinknochen würde ich schließen, dass sie etwa eins siebzig bis eins fünfundsiebzig war.«
»Eins vierundsiebzig.«
Jetzt sah Brauner Fabel genauso erstaunt an wie Anna. »Du weißt, wer das ist?«
Fabel nickte. »War das die Todesursache?« Er wies mit dem Kinn auf die Stelle links am Schädel, wo er eingedrückt war.
»Nein«, sagte Brauner. »Das ist frisch, von der Baggerschaufel. Ohne Weichgewebe wird es kaum möglich sein, die genaue Todesursache festzustellen, es sei denn, wir finden Brüche oder Messerspuren an den Knochen.«
»Wer ist sie, Jan?«, fragte Anna.
»Monika Krone. Der erste Fall, an dem ich bei der Mordkommission gearbeitet habe. Sie hatte gerade ihr Literaturstudium abgeschlossen. Eine hervorragende Studentin … fünfundzwanzig Jahre, schön – außergewöhnlich schön – und hochintelligent. Vor ihr lag eine glänzende Zukunft, doch eines Abends nach dem Verlassen einer Uniparty verschwand sie von der Bildfläche. Ihren Mörder haben wir nie gefunden. Ihre Leiche auch nicht, bis jetzt.«
»Es ist ein bisschen früh …«, warf Anna ein.
»Sie ist es«, unterbrach Fabel seine Kollegin. »In einer Samstagnacht im März 2000 ist sie nach der Party verschwunden. Am achtzehnten März. Wie ich gerade sagte, sie war einfach weg, man hat nie wieder etwas von ihr gehört.«
»Verdächtige?«
»Jede Menge – praktisch alle, die auf der Party waren. Aber nachdem wir eine Chronologie der Ereignisse erarbeitet hatten, gingen wir davon aus, dass sie ein willkürliches Opfer geworden war. Unser einziger wirklicher Verdächtiger war ein Serienvergewaltiger, der damals sein Unwesen trieb – Jochen Hübner. Nachdem wir ihn gefasst hatten, haben wir ihm ordentlich die Hölle heiß gemacht, aber es gab nichts Konkretes, ja, nicht mal einen vagen Hinweis, der ihn mit ihrem Verschwinden in Verbindung gebracht hätte. Und es gab keine Beweise, dass er jemals ein Opfer getötet hatte.«
»Warum stand er dann ganz oben auf eurer Liste?«
»Das Kommissariat für Sexualdelikte war schon längere Zeit hinter einem unidentifizierten Serienvergewaltiger her. Die Presse hatte ihn ›Frankenstein‹ getauft.«
»Frankenstein?«
»Wenn du ihm jemals gegenüberstehen würdest, würdest du verstehen, warum. Und glaube mir, du willst Jochen Hübner lieber nicht persönlich gegenüberstehen. Es war übrigens sein ungewöhnliches Aussehen, durch das wir ihn irgendwann erwischten. Hübner war – ist – ein Monster, sowohl äußerlich als auch innerlich. Seine Taten sind so ausgesucht grausam, sein Hass auf Frauen ist so außergewöhnlich, dass die Kollegen vom Kommissariat für Sexualdelikte uns einen Tipp gegeben hatten, dass Frankensteins Übergriffe sehr wahrscheinlich eskalieren würden – dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis er ein Opfer tötete. Nachdem wir Jochen Hübner als Frankenstein identifiziert hatten, schien es plausibel, dass Monika Krone das Opfer war, das seine Wandlung vom Serienvergewaltiger zum Serienmörder markierte.«
»Du glaubst also immer noch, er könnte es gewesen sein?«
»Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, habe ich meine Zweifel. Habe ich immer gehabt. Er hat geschworen, er hätte es nicht getan, und Hübner war so ein Typ soziopathischer Egoist, der stolz auf seine Tat gewesen wäre. Nach seiner Festnahme gab er alle seine Vergewaltigungen mit Vergnügen zu. Es war eine Frau, die damals die Ermittlungen leitete, und Hübner erzählte ihr in allen Einzelheiten, was er jedem Opfer angetan hatte – was jede gesagt hatte, wenn sie ihn angebettelt hatte. Nach seiner Verurteilung musste die Kollegin sich eine Weile beurlauben lassen.«
»Hört sich an, als könnte er es durchaus gewesen sein«, bemerkte Anna.
»Vielleicht.«
Fabel starrte hinunter auf die Knochen in dem flachen Grab, die sich weiß von der rot-schwarzen Erde abhoben. Nummerierte, orangefarbene Spurenmarkierungen umgaben sie wie alte Grabbeigaben. Er wusste, wer sie war, wusste, dass sie fünfzehn Jahre lang unter diesem schäbigen Supermarktparkplatz gelegen hatte, wo ihr Fleisch von den Knochen gefault war, während die Lebenden über ihr mit Einkaufswagen und Tüten voller Lebensmittel hin- und hergeeilt waren, sich um Parkplätze gezankt, Kinder zur Ruhe ermahnt und geflucht hatten, wenn Einkaufstüten gerissen und der Inhalt herausgefallen war. Er wusste, dass das Monika Krone war, in dem flachen Grab vor ihm, doch irgendwie konnte er noch immer nicht die Knochen mit der Person in Verbindung bringen.
Die Sonne brach hinter den Wolken hervor, und Fabel wandte ihr sein Gesicht zu.
»Ich glaube, wir sollten jetzt lieber die Angehörigen benachrichtigen.«
6
Der Film war nicht wie das Buch.
Zombie saß allein in der Sitzreihe. Er saß allein, denn obwohl dieses Art-House-Kino in Rotherbaum normalerweise gut besucht war, gab es in Hamburg nur wenig Publikum für expressionistische Stummfilme; allein, weil er vielleicht ein wenig zu nah vor der Leinwand saß und drei oder vier Reihen weiter hinten besser gesehen hätte. Doch dies war ein Monument von einem Film, und er wollte, dass die Bilder sein gesamtes Blickfeld füllten. Er wollte die sich langsam bewegenden tektonischen Platten von Paul Wegeners Gesicht ganz genau betrachten, lauter scharfe Winkel und Flächen, und er saß allein, weil er nicht wollte, dass jemand seinen Geruch wahrnahm.
Der Tod, so wusste er, besaß einen unverkennbaren Hautgout.
Zombie war kein Spitzname: Einen Spitznamen erhielt man von anderen, und Zombie hatte keinen echten Kontakt zu anderen, keinen engen Kontakt zur Welt der Lebenden, nicht mehr. Er war von den Zwängen seiner weitergeführten, aber leblosen Existenz dazu gezwungen, gelegentlich mit anderen zu interagieren, aber abgesehen vom Umgang mit den Kollegen bei der Arbeit beschränkte er diese zwischenmenschlichen Begegnungen auf ein absolutes Minimum. Zombie war nicht einmal ein Name: Es war eine Beschreibung, eine taxonomische Einordnung. So, wie ein Hai ein Fisch und eine Ratte ein Nagetier war, so war er ein Zombie. Er war gestorben, aber nicht begraben worden und gehörte noch nicht zu den Toten; er war belebt, gehörte aber nicht zu den Lebenden. Er wandelte weiterhin über die Erde, war aber nicht mehr mit ihr verbunden. Und die ganze Zeit über versuchte er zu ergründen, warum er zu diesem Zustand der bewussten Nichtexistenz verdammt war.
Er hatte jedoch noch Lieblingsorte. Zombie ging gerne in dieses Kino; er mochte die Dunkelheit und Stille dieses Saals, und vor allem hielt er sich gerne rund um Friedhöfe auf: der Sog des Heimwehs, wie ihn jeder unfreiwillige Reisende kennt.
Er erinnerte sich noch daran, was es bedeutete, lebendig zu sein, wie es gewesen war, als er Sinne hatte, wie die Welt ausgesehen, gerochen, sich angefühlt und angehört hatte.
Als Kind hatte er mit seiner Familie Ferien in der Nähe von Cuxhaven gemacht, in einem Apartmenthotel am Meer. Er erinnerte sich an seine Aufregung – die fast unerträgliche Vorfreude –, wenn sie den Weg zu den Dünen entlanggegangen waren und wie sich das Meer schon allen Sinnen angekündigt hatte, bevor es in Sicht kam: das Ozon in der Luft, angewehter Sand rechts und links am Wegesrand, das über die Dünen hinweg vernehmliche Rauschen der Wellen, die an den Strand schlugen. So war es gewesen, im Zentrum eines Nervengeflechts zu sein. Lebendig zu sein.
Er erinnerte sich sogar daran, wie es gewesen war, zu lieben; schwache Echos von Sehnsucht, Verlangen, Eifersucht. Das Gesicht der Frau, die er geliebt hatte, der einzigen Frau, die er je geliebt hatte, stand ihm noch klar vor Augen, und der Schmerz dieser Erinnerung war das einzige annähernd intensive Gefühl, das er noch empfand.
Diese Erinnerung war seine Maske, wenn er sich unter den Lebenden bewegen musste. In gewisser Weise besaß Zombie noch Empfindungen. Er sah noch seine Umgebung, aber wie durch die Linse eines toten Auges alles verschwommen, stumpf, vernebelt. Seine übrigen Sinne waren noch mehr geschwächt: Für den lebenden Toten war die Welt ein fader Ort ohne Geschmack und Geruch, außer, wenn er gelegentlich einen Hauch seiner eigenen Verwesung auffing, dem Gestank seines verrottenden Fleisches, der durch seine Kleider drang.
Also saß er jetzt allein in einer ansonsten leeren Stuhlreihe zu dicht vor der Leinwand.
Der Film war nicht wie das Buch.
Es war kaum überraschend, dass er sich viele Filme über die Untoten ansah. Die meisten waren barer Unsinn: Vampirfilme, die schon seit jeher geschmacklos und komisch gewesen waren, hatte man zu albernen Teenagerromanzen recycelt. Aber besonders Zombiefilme waren idiotisch, plump und immer dasselbe: Die Untoten stolperten jedes Mal tollpatschig, seelenlos und gedankenlos umher, gruben faulende Zähne ins Fleisch der Lebenden und machten sie so zu ihresgleichen.
Aber das entsprach so gar nicht der Wirklichkeit.
Niemand hatte sich je Gedanken darüber gemacht, wie es wirklich war, tot, aber noch immer lebendig zu sein, wie es war, dies wirklich zu erleben, wie es war, zum absoluten sozialen Außenseiter zu werden. Zombie aß noch – gelegentlich rührten sich unterschwellige Hungergefühle, allerdings nicht oft –, aber er aß ohne Appetit genau das gleiche wie alle anderen, kein Menschenfleisch, wie es in den Filmen behauptet wurde. Doch zumindest aß er weniger als die Lebenden und war inzwischen klapperdürr. Die Leute auf der Arbeit – wobei seine Arbeit zu den zahlreichen Routinehandlungen gehörte, die er ausführte, um die Illusion der Normalität zu erschaffen – sagten, er gehe vor die Hunde und müsse sich vernünftig ernähren. Doch Zombie wusste, dass er nicht nur aufgrund schlechter Ernährung so ausgezehrt war, sondern, weil er verweste. Er zerfiel von innen nach außen. Doch das konnte er nicht sagen. Einmal hatte ein Kollege über Zombies exzessiven Gebrauch von Eau de Toilette gewitzelt und gefragt, ob er in dem Zeug bade – Zombie konnte nicht erwidern, dass es dazu diente, seinen Leichengestank zu übertünchen.
In der Öffentlichkeit tat Zombie wie ein Lebender: Er folgte den gleichen Abläufen. Sobald er allein war, brauchte er nicht mehr zu schauspielern. Stundenlang lag er schlaflos in seinem abgedunkelten Zimmer, regungslos, kaum atmend, und stellte sich die erdige, wurmige Ruhe vor, die ihm versagt blieb. Doch es gab zwei Dinge, die noch von seinem Leben übrig waren: Geistergewohnheiten. Er las Bücher. Er sah Filme. Die Filme waren hauptsächlich Klassiker, besonders, so wie dieser, Klassiker des deutschen Expressionismus. Gruselfilme, die er sich ansah, um sich selbst besser zu verstehen.
Das Medium Film an sich spiegelte seinen Zustand perfekt wider. Die meisten der Filme, die er sich ansah, stammten aus längst vergangenen Zeiten und von Menschen, die nicht mehr existierten. Er kannte die Schauspieler inzwischen so gut – Paul Wegener, Brigitte Helm, Conrad Veidt, Henrik Galeen, Elsa Lanchester, Lyda Salmonova, Olaf Fønss, Emil Jannings –, als wären sie seine Zeitgenossen, seine Freunde. Genau wie er waren sie alle tot, und genau wie er waren sie auch im Tod noch lebendig und bewegten sich zu seiner Unterhaltung lange nach ihrem Abtreten. Monochrome Geister, die auf einer Leinwand das Leben imitierten.
Doch dieser Film war etwas Besonderes, und ihn sich anzusehen war ein Schritt in Richtung Selbsterkenntnis. Dieser Film erzählte so eloquent, so perfekt von Zombies Zustand des Seins und Nichtseins.
Der Film war nicht wie das Buch.
Zombie hatte das bereits gewusst, bevor er ins Kino gegangen war. Er hatte das Buch zweimal gelesen und den Film so oft gesehen, dass er schon gar nicht mehr sagen konnte, wie oft. Das Buch hatte ihm gefallen, und er hielt Meyrink für unterschätzt, ja, sogar stellenweise – aber nur stellenweise – für ebenso gut wie Kafka. Doch während das Buch seinen Verstand angesprochen hatte, berührte der Film etwas tief in seinem Inneren, jedes Mal, wenn er ihn sich ansah. Dabei hatte er geglaubt, er sei längst über jede innere Regung hinweg.
Dieses Kino in Rotherbaum war etwas Besonderes. Es war auf Klassiker sowie auf Kult- und Kunstfilme spezialisiert. Wann immer möglich, zeigte es die Filme im Original mit Untertiteln anstatt synchronisiert. Zombie fand es wichtig, die echten Stimmen der Schauspieler zu hören, außer in diesem Film natürlich. Obwohl es ein Stummfilm war, sprach er zu Zombie.
Der Golem, wie er in die Welt kam.
Mary Shelley wurde nach einem Besuch in Prag, wo sie von der Legende über den Golem gehört hatte, dazu inspiriert, Frankenstein zu schreiben, und Wegeners expressionistische Leinwanddarstellung als der riesige Homunkulus aus Lehm wurde seinerseits die Inspiration für jedes Frankenstein-Monster im Film, das darauf folgte. Zombie sah seinen eigenen Kampf von Wegeners lieblosem, seelenlosem Menschen aus Lehm reflektiert, der Verständnis in einer Welt der grausamen Lebendigen suchte. Ein totes Ding, einer Seele beraubt, dazu verdammt, einen leblosen Part in einer lebendigen Welt zu spielen. Und ebenso wie Zombie betrachtete der Golem die Welt der Lebenden mit einer Mischung aus Sehnsucht und Hass.
Paul Wegener war als Golem absolut überzeugend: Der Schauspieler war selbst ein Hüne gewesen, fast zwei Meter groß. Mit den riesigen Blockabsatzstiefeln des Golems überragte er das übrige Ensemble bei weitem. Ein zum Leben erwecktes Monument.
Auf der Leinwand erreichte der Rabbi die Menschwerdung seiner Lehmstatue, indem er die heilige Formel zusammenrollte, in einen Talisman schob und das Ganze in die mächtige Brust des Lehmmenschen steckte. Der Golem öffnete die Augen. Blasse Augen in einem grauen Gesicht, geformt aus Lehm, huschten von einer Seite zur anderen und erfassten eine Welt, in die sie nicht gehörten. Eine verwirrte Geburt in eine leblose Existenz.
Genau so war es für Zombie gewesen. Er war in einem Krankenhaus erwacht, nachdem er gestorben war, und niemand glaubte ihm, als er sagte, er sei immer noch tot und die Medikamente, die sie ihm verabreichten und die Therapie, auf der sie bestanden, seien nutzlos. Mittel zur Anwendung an Lebenden.