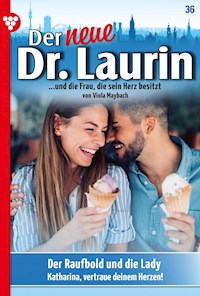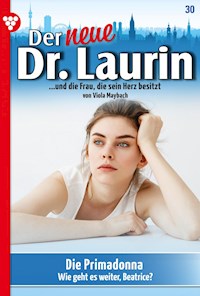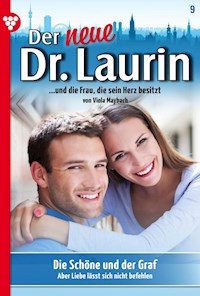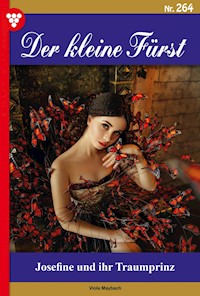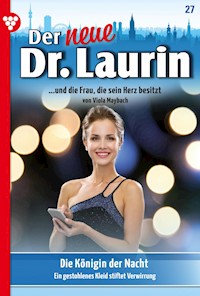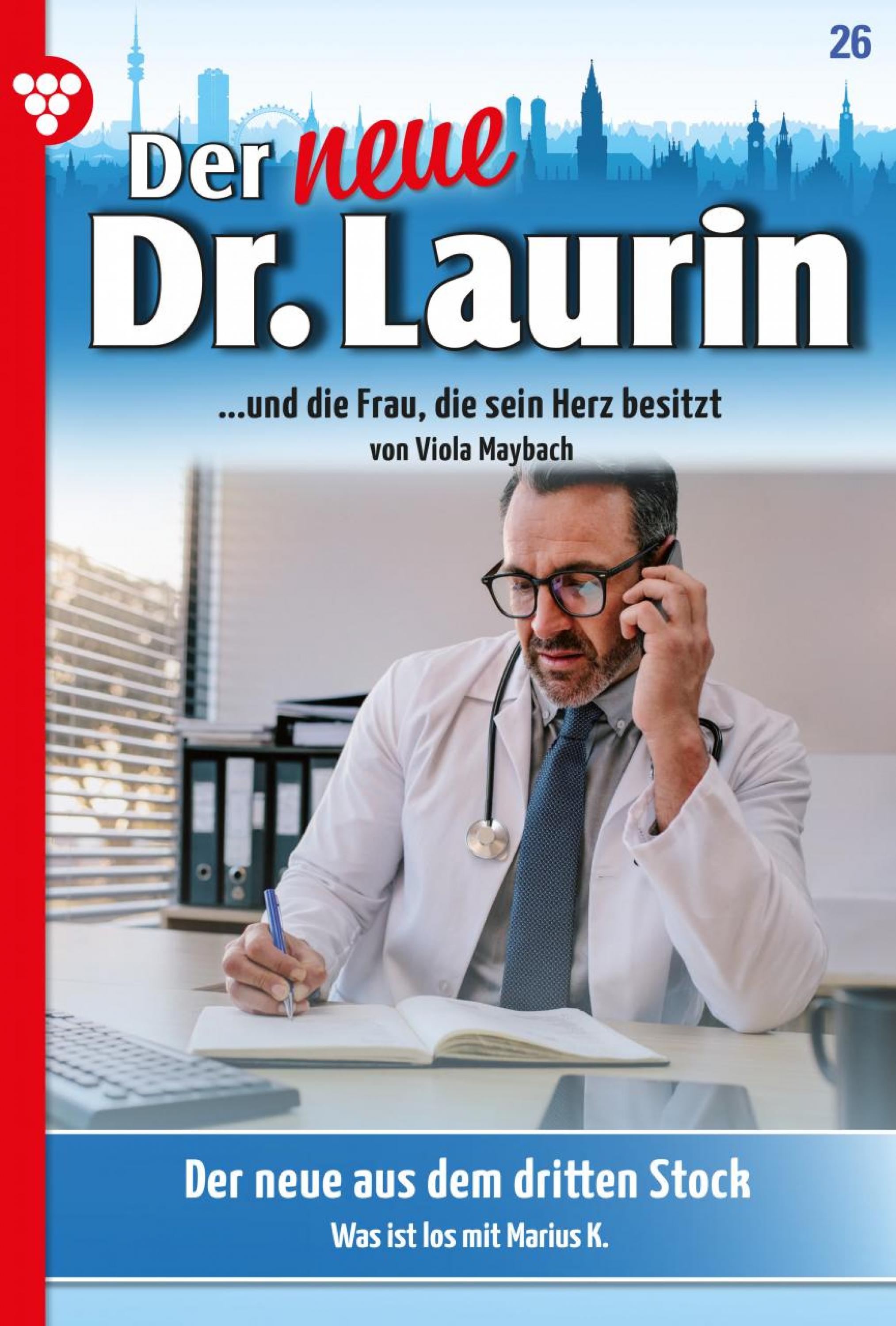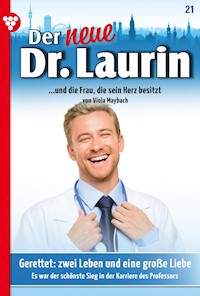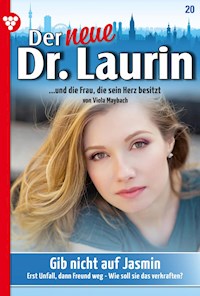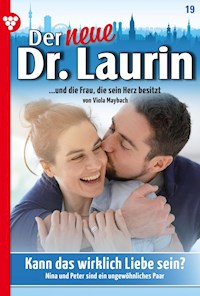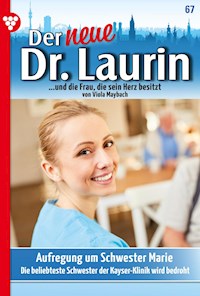
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der neue Dr. Laurin
- Sprache: Deutsch
Diese Serie von der Erfolgsschriftstellerin Viola Maybach knüpft an die bereits erschienenen Dr. Laurin-Romane von Patricia Vandenberg an. Die Familiengeschichte des Klinikchefs Dr. Leon Laurin tritt in eine neue Phase, die in die heutige moderne Lebenswelt passt. Da die vier Kinder der Familie Laurin langsam heranwachsen, möchte Dr. Laurins Frau, Dr. Antonia Laurin, endlich wieder als Kinderärztin arbeiten. Somit wird Antonia in der Privatklinik ihres Mannes eine Praxis als Kinderärztin aufmachen. Damit ist der Boden bereitet für eine große, faszinierende Arztserie, die das Spektrum um den charismatischen Dr. Laurin entscheidend erweitert. Der neue Dr. Laurin Nr. »Du hast jetzt doch Zweifel bekommen«, stellte Olivia Stephan fest, die ihre ältere Schwester Jana beim Frühstück beobachtet hatte. »Du hast nämlich immer noch nichts gegessen, dabei musst du in etwa einer halben Stunde los.« Jana saß mit gedankenverlorenem Blick ihr gegenüber, ihre beiden Hände umfassten einen großen Becher mit Milchkaffee, als müsste sie sich daran aufwärmen. Auf ihrem Teller lag ein Brötchen, von dem sie genau einmal abgebissen hatte. Seitdem schien sie es vergessen zu haben. Auf die Bemerkung ihrer Schwester reagierte sie nicht. »Jana!«, rief Olivia. »Hast du überhaupt gehört, was ich gesagt habe?« Endlich richtete Jana den Blick auf ihre Schwester, sie rang sich sogar ein Lächeln ab. »Jedes Wort«, erklärte sie. »Und ja, ich habe jetzt doch Zweifel bekommen, ob sie mich nehmen. Vielleicht war ich meiner Sache einfach zu sicher, und sie haben sich in der Zwischenzeit für jemanden anders entschieden. Ich weiß nicht, warum ich das bislang nicht für möglich gehalten habe. »Und? Was machst du, wenn es so ist?«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der neue Dr. Laurin – 67 –Aufregung um Schwester Marie
Die beliebteste Schwester der Kayser-Klinik wird bedroht
Viola Maybach
»Du hast jetzt doch Zweifel bekommen«, stellte Olivia Stephan fest, die ihre ältere Schwester Jana beim Frühstück beobachtet hatte. »Du hast nämlich immer noch nichts gegessen, dabei musst du in etwa einer halben Stunde los.«
Jana saß mit gedankenverlorenem Blick ihr gegenüber, ihre beiden Hände umfassten einen großen Becher mit Milchkaffee, als müsste sie sich daran aufwärmen. Auf ihrem Teller lag ein Brötchen, von dem sie genau einmal abgebissen hatte. Seitdem schien sie es vergessen zu haben. Auf die Bemerkung ihrer Schwester reagierte sie nicht.
»Jana!«, rief Olivia. »Hast du überhaupt gehört, was ich gesagt habe?«
Endlich richtete Jana den Blick auf ihre Schwester, sie rang sich sogar ein Lächeln ab. »Jedes Wort«, erklärte sie. »Und ja, ich habe jetzt doch Zweifel bekommen, ob sie mich nehmen. Vielleicht war ich meiner Sache einfach zu sicher, und sie haben sich in der Zwischenzeit für jemanden anders entschieden. Ich weiß nicht, warum ich das bislang nicht für möglich gehalten habe.
»Und? Was machst du, wenn es so ist?«
»Darüber habe ich gerade nachzudenken versucht.«
Olivia war kurz davor, die Geduld zu verlieren, als Jana nach dieser unergiebigen Auskunft wieder verstummte. »Und?«, rief sie erneut.
»Mir ist nichts eingefallen«, gestand Jana. »Tatsache ist: Ich habe keinen Plan B.«
Olivia verdrehte die Augen zum Himmel. Sie war sechs Jahre jünger als Jana, vor kurzem war sie siebenundzwanzig geworden. Die beiden Schwestern unterschieden sich nicht nur äußerlich voneinander, sondern auch im Wesen. Jana sah ihrer Mutter, die aus Gabun stammte, sehr ähnlich: Allerdings war ihre Haut nicht schwarz wie die ihrer Mutter, sondern eher kaffeebraun. Ihre Augen und ihre krausen Haare hingegen waren schwarz. Die Haare trug sie kinnlang, sie wechselte ihre Frisuren oft. Heute würde sie sich einen strengen Knoten machen, hatte sie entschieden, weil sie ‚seriös‘ aussehen wollte. Sie war groß und schlank, liebte farbenfrohe Kleidung und große Ohrringe. Sie vertraute oft auf ‚ihr Bauchgefühl‘, und sie ließ sich mit wichtigen Entscheidungen gerne Zeit. Sie liebte es, alles genau zu durchdenken, drängen ließ sie sich nicht gern.
Olivia hingegen war ungeduldig, sie konnte nicht warten und wurde unleidlich, wenn ihr wieder einmal etwas nicht schnell genug ging. Die blonden Haare und blauen Augen hatte sie von ihrem deutschen Vater geerbt, aber anders als er war sie von zartem Körperbau und fast einen halben Kopf kleiner als Jana. Deren Vorliebe für farbenfrohe Kleidung teilte sie. Große Ohrringe freilich standen ihr nicht, was sie sehr bedauerte. Sie fand Jana schöner als sich selbst, und natürlich war es bei Jana umgekehrt genauso.
Es war unmöglich zu erkennen, dass sie Schwestern waren. In der Familie war ihr unterschiedliches Aussehen das Thema unzähliger Scherze. Sie hatten das Glück, dass die Ehe ihrer Eltern, allen Widrigkeiten zum Trotz, gehalten hatte und dass sie nicht nur Schwestern, sondern auch die besten Freundinnen waren. Außerdem liebten sie ihre Eltern und waren froh darüber, von Anfang an Einblicke in zwei sehr unterschiedliche Kulturen bekommen zu haben. Sie waren oft in Afrika gewesen in den Ferien, vor allem natürlich in Gabun, aber sie waren auch in andere afrikanische Länder gereist, und sie hatten enge Beziehungen zur Familie ihrer Mutter, die in Libreville, der Hauptstadt des Landes, wohnte.
»Iss wenigstens dein Brötchen, bevor du gehst«, mahnte Olivia. »Du kannst nicht mit leerem Magen ein so wichtiges Gespräch führen.«
»Da hast du recht«, gab Jana zu und biss geistesabwesend ein zweites Mal von ihrem Brötchen ab. Olivia erwartete schon, sie werde es daraufhin wieder vergessen, doch mit einem Schlag schien der Appetit ihrer Schwester erwacht zu sein, denn der Rest des Brötchens verschwand ziemlich schnell. Sie leerte auch ihre Tasse und stand auf. »Ich mache mich noch ein bisschen hübsch«, grinste sie, bevor sie das Zimmer verließ.
»Du bist hübsch!«, rief Olivia ihr nach.
»Dann eben: ›noch hübscher‹, Olive!«
›Olive‹ war ursprünglich nur der Familienspitzname für Olivia gewesen, doch seit ihn einmal eine ihrer Freundinnen aufgeschnappt hatte, nannten praktisch alle sie so.
Als Jana wieder ins Zimmer kam, hatte sie ihre Haare in einem Knoten gebändigt. Sie trug einen wadenlangen roten Rock, dazu ein dunkles Oberteil und große goldene Kreolen in den Ohren. Ihr Lippenstift hatte die Farbe des Rockes.
Olivia sah sie bewundernd an. »Du siehst toll aus. Und du wirst sie mit deinem Lebenslauf umhauen. Wenn sie dich nicht nehmen, ist ihnen nicht zu helfen.«
Jana kam zu ihr, gab ihr einen Kuss und verließ dann mit raschen Schritten die Wohnung, ohne etwas zu erwidern.
Olivia schenkte sich eine weitere Tasse Kaffee ein. Sie hatte noch etwas Zeit, bevor sie zur Arbeit fahren musste. Sie entwickelte Düfte für einen großen Konzern. Ihr letzter Duft hatte sich überraschend gut verkauft, jetzt wollten sie natürlich etwas haben, das an diesen Erfolg anknüpfte. Olivia fand dieses Vorgehen langweilig, sie hätte lieber etwas völlig anderes gemacht, etwas Unerwartetes, Gewagtes. Aber wenn es um viel Geld ging, konnte man wohl nicht mehr allzu viel Risikofreude erwarten. Olivia war deshalb längst entschlossen, sich irgendwann selbstständig zu machen.
Sie hatte eine unfehlbare Nase, und die war ihr großes Kapital, das war ihr schon vor langer Zeit klargeworden. Ihre Fähigkeit, Gerüche wahrzunehmen, die andere nicht einmal dann riechen konnten, wenn man sie extra darauf hinwies, war überaus selten und daher ein kostbares Gut. Sie hatte vor, daraus etwas zu machen, und zwar auf eigene Rechnung, nicht für Auftraggeber, die mit ihr das große Geld verdienten, dieses Geld aber nur ungern mit ihr teilen wollten.
In Gedanken sah sie sich bereits als Frau, die mit ihrer Nase berühmt geworden war und musste lachen. Sie wusste genau, was Jana gesagt hätte, hätte sie ihre Gedanken jetzt lesen können. »Du machst wieder mal den zweiten Schritt vor dem ersten, Olive!«
Ja, das tat sie oft. Noch war sie eine kleine Parfümeurin, die nichts weiter als einen ersten Erfolg vorzuweisen hatte. Bis sie so weit war, dass sie sich selbstständig machen konnte, würde noch einige Zeit ins Land gehen. Aber wenn Jana nach München zog, würden sie einander stützen und helfen können, so wie früher, als sie noch Kinder gewesen waren. In den letzten Jahren hatten sie sich nicht oft sehen können, Jana hatte in Gelsenkirchen gearbeitet, das war weit weg von München. Aber wenn sie jetzt diese Stelle bekam …
Ja, wenn! Und was war, wenn es nicht klappte?
Sie beschloss, darüber nicht mehr nachzudenken, deshalb stand sie auf und begann, den Tisch abzuräumen. Ändern konnte sie ohnehin nichts, sie musste es nehmen, wie es kam.
*
Vincent Schumacher stutzte, als er das Erdgeschoss erreichte. Zwar wohnte er im sechsten Stock, aber er benutzte immer die Treppe – so tat er auch etwas für seine Fitness, wenn er sich sonst nicht bewegte. Der Mann, der vor den Briefkästen stand, hatte sich beim Klang seiner Schritte so rasch umgedreht, dass Vincent sein Gesicht nicht mehr sehen konnte, und im nächsten Moment hatte er das Haus bereits verlassen. War das Zufall oder Absicht gewesen?
Ihm fiel ein, dass er nicht zum ersten Mal eine unbekannte Person hier unten im Haus antraf, nur hatte er sich bislang nichts dabei gedacht. Zehn Mietparteien wohnten hier, man kannte sich also untereinander. Natürlich waren immer mal wieder Leute im Haus, die nicht hier wohnten, sie bekamen ja alle Besuch oder hatten Übernachtungsgäste. Aber etwas an der hastigen Bewegung des Mannes, der bereits verschwunden war, als Vincent jetzt die Haustür öffnete und nach rechts und links Ausschau hielt, hatte ihn stutzig gemacht und ihm die zwei oder drei anderen ähnlichen Begegnungen der letzten Zeit wieder in Erinnerung gerufen.
»Guten Morgen, Vincent«, sagte eine Stimme hinter ihm.
Er drehte sich um und lächelte. »Ach, hallo, Marie. Wie geht’s dir?«
Marie Laube erwiderte sein Lächeln. »Gut, ich kann nicht klagen. Und wie läuft’s bei dir in der Schule?«
»Ich kann auch nicht klagen. Wenn du wüsstest, wie froh ich bin, dass ich das Abitur nachgemacht habe! Ich hätte ja sonst nicht Lehrer werden können, und jetzt habe ich so viel Spaß mit und an den Kindern.«
Vincent war Grundschullehrer, Marie hatte sich schon oft mit ihm über seinen Beruf unterhalten, denn darin waren sie sich ähnlich: Beide gingen ganz in dem auf, was sie taten. Marie war Krankenschwester geworden, und diesen Beruf übte sie nun schon sehr lange aus. Obwohl die Arbeit im Laufe der Zeit nicht einfacher geworden war, hatte sie die Begeisterung für ihre Tätigkeit nicht eingebüßt. Sie arbeitete in der Kayser-Klinik, dort war sie mittlerweile zu einer Art Legende geworden. Sie war Diejenige mit den meisten Dienstjahren, also auch mit der größten Erfahrung. Und noch immer war sie die Schwester, der sich Patientinnen und Patienten am liebsten anvertrauten, weil Marie für jede und jeden ein offenes Ohr und einen guten Rat hatte. Sie konnte zuhören, und sie konnte Ruhe und Zuversicht verbreiten, was sie auch oft tat.
Vincent, der ein paar Jahrzehnte jünger war als sie, unterhielt sich gern mit ihr, und umgekehrt war es genauso. Der große Altersunterschied war für sie nichts Trennendes, eher im Gegenteil: Vincent war interessiert an Maries großer Lebenserfahrung und daran, wie sie auch schlimme Erlebnisse verarbeitete, Marie wiederum fand Vincents noch unverbrauchten Blick auf die Welt bereichernd für sich. Sie unterhielten eine gutnachbarliche Beziehung, die einen gelegentlichen gemeinsamen Kaffee oder auch ein Abendessen einschloss. Sie hatten sich bei diesen Gelegenheiten immer etwas zu erzählen, was auch daran lag, dass sie aufrichtig aneinander interessiert waren.
»Du könntest mal wieder zu mir kommen, auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen«, schlug Marie vor.
»Gerne«, sagte Vincent.
»Wieso stehst du eigentlich an der Haustür und siehst dich um? Wartest du auf jemanden?«
»Nein, da war eben nur wieder jemand hier im Haus, den ich noch nie gesehen hatte. Als er meine Schritte gehört hat, war er ganz schnell weg. Das kann natürlich Zufall gewesen sein, aber mir ist dann eingefallen, dass ich in letzter Zeit gelegentlich Leute hier gesehen habe, die mir unbekannt waren.«
Da Vincent, als er das sagte, gerade wieder nach draußen blickte, fiel ihm nicht auf, dass Maries Gesichtsausdruck sich änderte, ganz kurz nur. Als er sich zu ihr umdrehte, sah sie jedoch schon wieder so gleichmütig aus wie zuvor.
»Ich muss los«, sagte er. »Wenn ich zu spät komme, ist in der Klasse sofort die Hölle los, und dann ist es umso schwerer, die Kinder wieder zu bändigen. Sie sind ja jetzt schon im zweiten Schuljahr und nicht mehr so eingeschüchtert wie im ersten.«
»Ich wünsche dir viel Glück, Vincent. Und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche mal vorbeikämst.«
»Das mache ich«, versprach er. »Gehst du auch?«
»Nein, nein«, behauptete sie, »ich muss in den Keller.«
Sie wartete, bis die Haustür hinter ihm ins Schloss gefallen war, dann öffnete sie ihren Briefkasten. Wie befürchtet lag ein einzelner Brief darin. Auf dem Umschlag stand nur ihr Name, keine Adresse, kein Absender.
Ihr Name war in Druckbuchstaben geschrieben.
*
»Das wird heute wieder nichts«, murmelte Timo Felsenstein, als die junge Ärztin, mit der Leon Laurin und er gerade ein Vorstellungsgespräch geführt hatten, hinausgegangen war.
Timo war neununddreißig Jahre alt und Unfallchirurg. Er leitete die Notaufnahme der Kayser-Klinik, und er tat es mit nie nachlassendem Engagement. Aber er sah müde aus und war es auch, hatte er doch, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen, in letzter Zeit zahlreiche Überstunden angehäuft. Die Folgen des großen Sturms, der vor kurzem vor allem über München und Umgebung hinweggefegt war, spürten sie immer noch. Um solchen Situationen in Zukunft besser begegnen zu können, aber auch, um in der täglichen Routine entlastet zu werden, suchten sie seit einiger Zeit nach einer Verstärkung des Notaufnahmeteams. Eine Ärztin oder einen Arzt, die oder der nicht mehr ganz unerfahren war und zudem jung genug, um der außergewöhnlichen Belastung, die die Arbeit in einer Notaufnahme darstellte, gewachsen zu sein. Und auf jeden Fall jung genug, um langfristig mit ihr oder ihm planen zu können. Denn was nützte die beste Verstärkung, wenn sie sich nach einem Jahr wieder verabschiedete?
Leon Laurin leitete die Kayser-Klinik, die sein Schwiegervater Professor Joachim Kayser vor langen Jahren gegründet hatte. Als der Professor in den Ruhestand gegangen war, hatte er das mit der beruhigenden Gewissheit getan, sein Lebenswerk an jemanden zu übergeben, der sich der Medizin ebenso verschrieben hatte wie er selbst. Leon war Chirurg und Gynäkologe, in beiden Fachgebieten arbeitete er auch weiterhin. Das schaffte er, weil er ein völlig anderer Chef war als seinerzeit Joachim Kayser: Leon war Teamarbeiter, er konnte Verantwortung abgeben. Ein ›Halbgott in Weiß‹ hatte er nie sein wollen. Aber für seine Art der Klinikführung brauchte er Angestellte, die selbst bereit waren, Verantwortung zu übernehmen und mit ihm an einem Strang zu ziehen.
Dass alle Angestellten der Klinik ausgezeichnete Fachausbildungen hatten, war selbstverständlich. Darüber hinaus aber waren auch andere Fähigkeiten gefragt: Es ging in erster Linie schließlich darum, kranke Menschen wieder gesund zu machen, und das geschah, wie man längst wusste, nicht nur mit medizinischen Mitteln, sondern auch durch Freundlichkeit, Zuwendung, Gespräche.
Leon war stolz darauf, dass an ›seiner‹ Klinik ein gutes Betriebsklima herrschte und dass sich die ihnen anvertrauten Menschen hier gut behandelt fühlten. Er hatte dafür einiges getan: Die Patientenzimmer waren heller und freundlicher geworden, die Dienstzimmer ebenfalls.
Dazu gab es Aufenthaltsräume, die gemütlich eingerichtet waren. Die größte Errungenschaft aber war, dass die Kayser-Klinik wieder über eine eigene Küche verfügte – mit einem früheren Sternekoch an der Spitze.
Seitdem aßen praktisch alle Angestellten in der Klinik, und zwar gerne. Und die Patienten schwärmten geradezu vom Klinikessen. Nicht wenige erklärten bei ihrer Entlassung, das köstliche Essen habe entscheidend zu ihrer schnellen Genesung beigetragen.