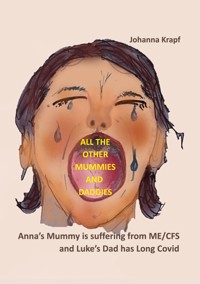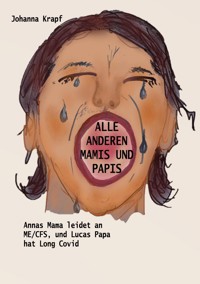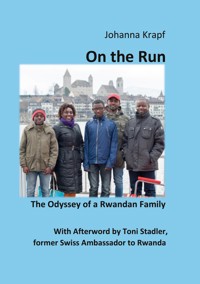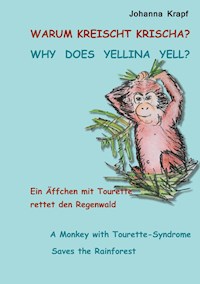Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gehörlose erleben die Welt grundlegend anders als Hörende. Kein tief fliegendes Flugzeug oder heiseres Krähen eines Hahns weckt sie frühmorgens, weder Verkehrsrauschen noch Baustellenlärm lenken sie von der Arbeit ab, ihr Frühling kehrt ein ohne Vogelgezwitscher, und sie sind nie unfreiwillige Zeugen von Handygesprächen im Zug. Da sie in ihrer Wahrnehmung stark visuell orientiert sind, werden sie hin und wieder auch »Augenmenschen« genannt. Die Autorin Johanna Krapf hat acht Gehörlose zwischen 12 und 72 Jahren befragt und ihre Geschichten aufgezeichnet. Sie erzählen darin über ihren Werdegang, über Kommunikationsbarrieren im Alltag, aber auch über das bereichernde Gefühl der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft und Kultur der Gehörlosen. Außerdem schildert ein Jugendlicher, wie er in Schule und Freizeit mit seinem Hörimplantat zurechtkommt. Und eine Gebärdensprachdolmetscherin vermittelt spannende Einblicke in ihre Arbeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johanna Krapf
Augenmenschen
Johanna Krapf
Augenmenschen
Gehörlose erzählen aus ihrem Leben
Rotpunktverlag
Der Verlag dankt dem Schweizerischen Gehörlosenbund SGB-FSS und der Max Bircher Stiftung für die finanzielle Unterstützung.
© 2015 Rotpunktverlag, Zürich Fotos: Matija Zaletel Zeichnungen: Corina Arbenz-Roth
eISBN 978-3-85869-656-4
1. Auflage 2015
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Gebärdensprache
Rita Zimmermann, geboren 1947
Was bedeuten die Begriffe »gehörlos«, »taub« und »schwerhörig«?
Ueli Matter, geboren 1967
Lautsprachbegleitendes Gebärden (LBG)
Pauline Rohrer, geboren 2001
Bilinguale oder orale Erziehung?
Corina Arbenz-Roth, geboren 1975
Der Mailänder Kongress von 1880
Paul von Moos, geboren 1941
Kultur der Gehörlosen
Barbara Diaz, geboren 1985
Diskriminierung
Patrick Mock, geboren 1986
Der GER und die Schweizer Gebärdensprachen
Patricia Hermann-Shores, geboren 1961
Das Cochlea-Implantat
Eymen Al-Khalidi, geboren 1997
Gebärdensprachdolmetschen
Barbara Bucher, geboren 1971
Erläuterungen
Bibliografie
Autorin
Vorwort
Gehörlose sind in ihrer Wahrnehmung stark visuell orientiert. Deshalb werden sie hin und wieder auch »Augenmenschen« genannt. In ihrer Kommunikation sind sie immer auf Sicht- beziehungsweise Blickkontakt mit ihren Gesprächspartnern und -partnerinnen angewiesen, da sie entweder Gebärdensprache sprechen oder von den Lippen ablesen müssen. Sie erleben die Welt grundlegend anders als Hörende. Kein tief fliegendes Flugzeug oder heiseres Krähen eines Hahns weckt sie frühmorgens, weder Verkehrsrauschen noch Baustellenlärm lenken sie von der Arbeit ab, ihr Frühling kehrt ein ohne Vogelgezwitscher, und sie sind nie Zeugen von intimen Handygesprächen im Zug oder hitzigen Diskussionen am Stammtisch. Jedoch: Kein hörender Mensch sieht wie sie sofort aus den Augenwinkeln, wenn sich jemand von schräg hinten nähert, nimmt die Vibrationen des Bodens wahr, wenn der Staubsauger dröhnt, spürt den feinsten Luftzug, wenn eine Tür aufspringt, kann so ausdrucksstark mit Händen, Mimik und Körperhaltung Poesie darstellen.
Im Zentrum dieses Buchs stehen acht Lebensgeschichten von gehörlosen Menschen. Hinzu kommen das Porträt eines schwerhörigen jungen Mannes mit Hörimplantat und das einer Gebärdensprachdolmetscherin. Sie alle haben mir ihre Lebensgeschichte erzählt, haben ihre ganz persönlichen Erinnerungen und prägenden Erlebnisse mit mir geteilt und mich Einblick nehmen lassen in ihren Alltag. Für dieses mir entgegengebrachte Vertrauen möchte ich ihnen von Herzen danken.
Meine Rolle war die einer Gesprächspartnerin und eines Sprachrohrs. Deshalb versuchte ich in diesen Porträts, das mir Erzählte möglichst unverfälscht wiederzugeben. Meine Einflussnahme bestand vor allem darin, dass ich die Interviewpartner und -partnerinnen auswählte, die Fragen zusammenstellte und die Antworten gewichtete. Entstanden ist ein Mosaik, das sich aus zehn individuellen Schicksalen mit zehn unterschiedlichen Perspektiven zusammensetzt. Die Farben der Mosaiksteinchen beißen sich da und dort, und die Fugen dazwischen sind mal breiter, mal kaum zu sehen. Das muss so sein. Ich empfehle den Leserinnen und Lesern, einen Schritt zurückzutreten und das Gesamtbild aus der Distanz wirken zu lassen: Was bedeutet es, in der Mehrheitsgesellschaft der Hörenden nicht beziehungsweise schlecht zu hören? Ist die Beherrschung der Gebärdensprache für die Menschen mit einer Hörbehinderung eine Bereicherung oder sogar die Voraussetzung für eine hindernisfreie Kommunikation? Oder etwa doch nicht? Die Porträts und die Sachtexte, die jeweils an ein spezifisches Thema heranführen, mögen dazu beitragen, Antworten auf diese und weitere Fragen zu finden. Und sie möchten zu Fragen anregen, die die meisten Hörenden sich überhaupt noch nie gestellt haben.
Ein spezieller Dank geht an Hansjörg Roth, der sämtliche Texte kritisch gelesen und mich mit seinen bohrenden Fragen immer wieder zum Nachdenken herausgefordert hat, dann natürlich an meine Familie, alle auch sorgfältige Leserinnen und Leser, und an Barbara Bucher, die als Fachfrau die Sachtexte unter die Lupe genommen hat.
Ohne die tatkräftige Unterstützung von Bernadette Mühlebach, die mich mit ihrer Begeisterung für mein Projekt immer wieder neu ansteckte, hätte ich auf dem langen Weg bis zur Fertigstellung des Mosaiks wohl den Mut verloren und aufgegeben. Herzlichen Dank auch dir, Bernie.
Danken möchte ich zudem den Frauen vom Kiwanis-Club Zürich Turicum für ihre finanzielle Unterstützung.
Johanna Krapf, Jona 2014
Einleitung
Die Idee zu diesem Buch ist nach und nach gewachsen. Seit ich angefangen habe, mich mit Gebärdensprache und mit den Menschen, die sie sprechen, zu beschäftigen, werden mir immer wieder dieselben Fragen gestellt. Kein Zweifel: Die meisten Hörenden – ich bin geneigt zu sagen: alle –, die nie einen gehörlosen Menschen kennengelernt haben, haben keine Ahnung, was es bedeutet, hochgradig schwerhörig zu sein. Ich möchte dies anhand einer Begebenheit, die sich vor ein paar Jahren zugetragen hat, veranschaulichen.
Ich war auf dem Heimweg und wartete in Zürich auf den Zug, als mir eine ehemalige Arbeitskollegin und ihr Mann begegneten. Wir setzten uns ins gleiche Abteil, und wir Frauen fingen an zu plaudern: Wie geht es dir? Wo arbeitest du gerade? Lernst du immer noch Griechisch beziehungsweise Chinesisch? Meine Bekannte berichtete von ihrem ausgefüllten Alltag als Pensionierte, ich von meinem kürzlich erschienenen Lehrmittel über die Gebärdensprache. Plötzlich blickte ihr Mann, der sich hinter der Zeitung verschanzt hatte, auf und fragte: »Wie kann eigentlich ein gehörloses Kind artikulieren lernen? Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit.« Ich erklärte ihm, wie er sich das in etwa vorzustellen habe: Das Kind müsse sich jeden Laut bewusst aneignen, und zwar mit Tasten, Blasen und Kontrollieren der Vorgänge beim Bilden der Laute im eigenen Mundraum – und mit Üben, Üben, Üben. Er hörte interessiert zu und vertiefte sich dann wieder in die Zeitung. Nach einer Weile hakte er nach: »Die Gebärdensprache ist eine universelle Sprache, nicht wahr?« Ich verneinte und erklärte ihm, es gebe unzählige davon, allein in der Schweiz drei: eine deutsche, eine französische und eine italienische. »Schade«, meinte er, »da hat man eine gute Gelegenheit verpasst. Eine einzige internationale Sprache wäre doch viel praktischer gewesen.« Ich erklärte ihm, dass niemand die Gebärdensprachen geschaffen habe, sondern dass sie natürliche, innerhalb von Sprachgemeinschaften gewachsene Sprachen seien, so wie Französisch und Schweizerdeutsch auch – im Gegensatz etwa zur Kunstsprache Esperanto1. Er bedankte sich und verschwand wieder hinter der Zeitung, aber kaum hatten wir Frauen unseren Gesprächsfaden aufgenommen, ließ er sie ein weiteres Mal sinken: »Ich hätte noch eine letzte Frage: Woher kennt eigentlich ein gehörloses Kind die deutschen Wörter? Es ist ja nicht ständig von Lautsprache umgeben wie wir.« Es müsse sie lernen, antwortete ich, genau wie wir Hörenden uns eine Fremdsprache aneignen. Die Zeitung blieb schließlich ganz auf seinen Knien, während er mich mit Fragen löcherte und so sehr ins Thema eintauchte, dass er wohl an seinem Wohnort vorbeigefahren wäre, wenn ihn seine Frau nicht gerade noch rechtzeitig am Ärmel gepackt und zum Ausgang gezogen hätte. Unterdessen hatte sich ein Herr im Abteil nebenan erhoben: »Entschuldigen Sie, ich habe Ihrem Gespräch mit Interesse zugehört und würde Ihnen gern auch noch eine Frage stellen: Warum …?«
Dieses Erlebnis mag als Beispiel dienen für all die Situationen, in denen ich mich damit konfrontiert sah, wie wenig Hörende über Hörbehinderung und ihre Folgen wissen. Augenmenschen möchte Fragen beantworten wie die nach der Anzahl Gehörloser, die in der Schweiz leben (vermutlich knapp 8000 – genaue Zahlen gibt es nicht)2, und falsche Vorstellungen richtigstellen (Gebärdensprache ist keine Pantomime). Es soll aufklären (eine hochgradige Hörbehinderung betrifft nicht nur das Hörvermögen, sondern indirekt auch das Lesen und Schreiben, was seinerseits zu einem Informationsdefizit führt) und Vorurteile abbauen (Menschen mit einer hochgradigen Hörbehinderung sind nicht taubstumm, denn sie können sprechen).
In Augenmenschen erzählen acht Gehörlose ihre Lebensgeschichte: Ueli Matter, dessen Eltern und Geschwister alle hörend sind; Pauline Rohrer und Patrick Mock, deren Eltern und Geschwister alle eine Hörbehinderung haben; Barbara Diaz und Rita Zimmermann, deren Eltern, Geschwister und Kind beziehungsweise Kinder hörend sind, während der Partner eine Hörbehinderung hat; Paul von Moos, dessen Eltern und Kinder hörend sind, während eines der Geschwister und die Partnerin eine Hörbehinderung haben; Patricia Hermann-Shores, deren Eltern hörend beziehungsweise hörbehindert sind, während eines der Geschwister und der Partner eine Hörbehinderung haben, und Corina Arbenz, deren Eltern, Partner und eines der Kinder hörend sind, während das andere Kind eine Hörbehinderung hat. Die jüngste porträtierte Person ist zwölf, die älteste über siebzig Jahre alt. Zusätzlich interviewte ich Eymen Al-Khalidi, der ein Cochlea-Implantat trägt und mit dem operierten Ohr achtzig bis neunzig Prozent hört (ohne CI wäre er völlig taub), und die Gebärdensprachdolmetscherin Barbara Bucher, die als Übersetzerin, aber auch als Tochter von Eltern mit einer Hörbehinderung über beide Sprachen, Gebärden- und Lautsprache, verfügt und mit beiden Kreisen und Kulturen vertraut ist.
Jedem Porträt ist ein Sachtext zu einem in Bezug auf Hörbehinderung oder Gebärdensprache relevanten Thema vorangestellt. Weiterführende Erläuterungen finden sich am Ende des Buchs; auf sie wird in den Porträts an passender Stelle verwiesen.
Die eindrücklichen Porträtfotos stammen von Matija Zaletel. Von Beruf ist er Hauswart, aber seine Freizeit gehört ganz dem Fotografieren. Er sagt: »Als Beruf wäre mir das Fotografieren zu unsicher.« Aufträge erhält er vor allem von der Gemeinschaft der Gehörlosen, denn er ist selber gehörlos. Corina Arbenz-Roth hat die Zeichnungen der Gebärden angefertigt. Sie stellt sich im Interview S. 78 vor.
Die Porträts sind absolut authentische Lebensberichte. Vor jedem Interview rief ich mir vor Augen, warum ich genau diese Person ausgewählt hatte und welche Fragen deshalb im Zentrum des Interesses stehen sollten, seien das diejenigen nach der Kindheit als gehörloses Kind in einer Familie von Hörenden, nach dem Spracherwerb, nach medizinisch-technischen Hilfsmitteln wie dem Cochlea-Implantat und seinen Auswirkungen, nach dem Ausbildungsweg, dem Berufsleben, der Alltagskommunikation oder den Lebensumständen von Gehörlosen in anderen Ländern. Dann stellte ich einen Fragenkatalog zusammen mit diesen spezifischen, aber auch vielen generellen Fragen, die mich bei allen Porträtierten gleichermaßen interessierten. Diese Liste schickte ich meinen Gesprächspartnern und -partnerinnen jeweils ein paar Wochen vor dem vereinbarten Termin. Und nun folgte das jedes Mal mit großer Spannung erwartete Interview: Würden wir einen Zugang zueinander finden? Welchen Verlauf würde das Gespräch nehmen? Würden wir einander verstehen? Diese Frage stellte sich nur bei den drei Interviews mit Eymen Al-Khalidi, Ueli Matter und Paul von Moos, da ich sie in Lautsprache führte. Ihre Formulierungen der Antworten konnte ich zum Teil auch direkt einfließen lassen.
Die übrigen Gespräche, außer dem mit Barbara Bucher, spielten sich in Gebärdensprache ab, und eine Dolmetscherin übersetzte, damit ich das Gesagte aufzeichnen konnte. Um diesen Dolmetschdienst war ich natürlich sehr froh, er führte aber naturgemäß dazu, dass eine Drittperson die gebärdensprachlichen Aussagen der Interviewpartnerinnen und -partner in eigene schweizerdeutsche Worte fasste, die ich dann wiederum verschriftlichte. Dieser Aspekt der zweimaligen Übersetzung und der daraus resultierenden Verfremdung zwischen der Originalerzählung in Gebärdensprache und dem hochdeutschen Text darf nicht außer Acht gelassen werden. Deshalb auch das Interview mit der Gebärdensprachdolmetscherin, in dessen Zentrum die anspruchsvolle Aufgabe des Dolmetschens steht.
Auf die Gespräche folgte jeweils eine Phase, in der ich sie nachklingen ließ und mir die Aufnahmen immer wieder anhörte, bevor ich mit dem Ausformulieren begann. Sobald der Text eine erste Form angenommen hatte, schickte ich ihn der interviewten Person zum Korrigieren und Ergänzen und überarbeitete ihn anschließend so lange, bis sie sich mit allen Aussagen und Formulierungen identifizieren konnte. Diese Phase unterschied sich stark von Text zu Text, abhängig von der Persönlichkeit der Porträtierten und – im Fall der sechs in Gebärdensprache geführten Interviews – von der Qualität der Übersetzungen. Bei manchen Texten musste ich nur wenige Details ändern, bei anderen hatten sich mehr Unstimmigkeiten eingeschlichen. Zudem schickten mir einige Porträtierte nach der ersten Lektüre viele neue, interessante Erlebnisse und Gedanken, die sie selber ausformuliert hatten und die es nun an passender Stelle einzufügen galt. In zwei Fällen war sogar ein zweites Treffen geboten, damit offene Fragen von Angesicht zu Angesicht besprochen werden konnten.
Die Texte haben unterschiedliche Formen und Stimmen: drei Erzählungen in der dritten und zwei in der ersten Person, drei Interviews und zwei mit Rahmentexten verquickte Erzählungen in der dritten Person. Warum diese Uneinheitlichkeit? Die jeweilige Textform spiegelt die Umstände und den Fluss des Gesprächs wider: Mal sprudelten die Erlebnisse wie ein Wasserfall, mal tröpfelten sie, mal plätscherten sie ruhig dahin, mal war ich es, die dem Bächlein eine bestimmte Richtung gab, mal nahm ein Interview einen unvorhergesehenen Verlauf. Aber alle Begegnungen hatten eines gemeinsam: Sie waren spannend, eindrücklich und bewegend. Nun lassen Sie sich bei der Lektüre von Augenmenschen die Augen für eine ganz spezielle Wahrnehmung der Welt öffnen – und zum Nachdenken darüber anregen!
Anmerkungen
1 Die Grundlagen von Esperanto wurden 1887 von dem polnischen Arzt Ludwik Lejzer Zamenhof veröffentlicht mit der Absicht, allen Menschen eine gemeinsame Sprache zu geben.
2 Für Deutschland geht man von rund 80 000 Personen, für Österreich von rund 10 000 Personen aus.
Gebärdensprache
Gebärdensprache ist nicht universell: Es gibt nicht nur eine einzige internationale, sondern viele verschiedene Gebärdensprachen, die sich wie die Lautsprachen ganz natürlich entwickelt haben. Somit hat jedes Land seine eigene Gebärdensprache, deren Gebärden von den besonderen gesellschaftlichen, kulturellen und historischen Gegebenheiten mitgeprägt wurden. In der Schweiz können die Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS), die Langue des Signes Française (LSF) und die Lingua Italiana dei Segni (LIS) unterschieden werden, und in der Deutschschweiz gibt es wiederum fünf Hauptdialekte: die Mundarten von Basel, Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich. Die Kinder lernen die Gebärdensprache meist untereinander, etwa auf dem Pausenplatz der Gehörlosenschulen, und, je nach Schule, auch im Unterricht. Es sei denn, sie wachsen mit gehörlosen Eltern auf, dann wird in der Regel auch zu Hause Gebärdensprache gesprochen.
Die einzelnen Gebärdensprachen unterscheiden sich etwas weniger stark voneinander als die Lautsprachen. Gehörlose können sich deshalb müheloser über Sprachgrenzen hinweg verständigen als Hörende. Im internationalen Austausch untereinander verwenden sie leicht verständliche, oft bildhafte Gebärden. Obwohl diese Verständigungsform nicht als eigentliche Sprache bezeichnet werden kann, schafft sie eine kommunikative Brücke zwischen den verschiedenen Gehörlosenkulturen (21)1. Man nennt sie auch internationale Gebärdensprache.
Gebärdensprache darf nicht mit Pantomime verwechselt werden. Das zeigt sich am schnellsten darin, »dass man eine Geschichte in Pantomime leicht verstehen kann, die gleiche Geschichte in Gebärdensprache Nichtkennern der Gebärdensprache aber unverständlich ist«2. Wer eine Gebärdensprache beherrscht, kann darin ebenso gut abstrakte Vorstellungen und komplexe Zusammenhänge ausdrücken, wie dies in der Lautsprache möglich ist. Beispiele für abstrakte Gebärden in der Deutschschweizer Gebärdensprache sind: VERTRAUEN, MÖGLICH, EINVERSTANDEN, GELB, FÄHIG etc.
Es gibt aber auch bildhafte, sogenannte ikonische Gebärden, deren Bedeutung mit etwas Fantasie erkennbar ist (AUTO – die Hände scheinen ein Steuerrad zu bewegen, MILCH – die Bewegung der Hände erinnert an das Melken). »Auch wenn dem Nichtanwender der Gebärdensprache die Anschaulichkeit vieler Gebärden auffällt, so haben Untersuchungen doch gezeigt, dass nur zwischen einem Drittel und der Hälfte des Gesamtvokabulars eines erwachsenen Gehörlosen als einigermaßen ikonisch beurteilt werden kann.«3
Den Gebärdensprachen liegt genau wie allen anderen natürlichen Sprachen eine Grammatik zugrunde. Zwei Beispiele der DSGS seien hier erwähnt: »Als allgemeinstes Prinzip gilt, dass die Zeit gleich am Anfang oder kurz nach Beginn einer Äußerung durch eine Zeit-Gebärde festgelegt wird.« Und »ein leichtes Kopfnicken nach vorn mit Anheben der Augenbrauen und weitem Öffnen der Augen« charakterisiert einen Satz als Ja/Nein-Frage.4
In der Gebärdensprache werden Hände und Arme, Mimik, Blick, Kopf, Oberkörper und Mundbild (26) eingesetzt. Eine einzelne Gebärde wird definiert durch die Handform (Faust, Faust mit gestrecktem Zeigefinger, gespreizte Hand), die Handstellung (Handrücken nach unten, nach oben), die Ausführungsstelle (vor dem Gesicht, vor der Brust) und die Bewegung (Kreis, Wellenbewegung). Wenn ein einziger dieser Faktoren verändert wird, so wirkt sich das auf die Bedeutung der Gebärde aus. Die visuell wahrnehmbare Gebärdensprache nutzt also den dreidimensionalen Raum und kann deshalb viel mehr Information in eine einzelne Gebärde packen, als das mit den gesprochenen Wörtern der linearen Lautsprache möglich ist. Ein Beispiel (vereinfacht): Beginnt meine Gebärde für ANSCHAUEN bei mir und bewegt sich auf dich zu, so bedeutet das »Ich schaue dich an«, bewege ich die Gebärde von dir auf mich zu, so heißt das »Du schaust mich an«. Gleichzeitig kann ich mit dem Gesicht zusätzlich »staunend«, »verständnislos« oder »heimlich« ausdrücken und mit der Vehemenz der Gebärde die Intensität des Anschauens variieren.
Da es schwierig ist, Gebärdensprache schriftlich festzuhalten, müssen Gehörlose immer in einer Lautsprache schreiben und lesen, also sozusagen in einer Fremdsprache. Ein Wort, für das (noch) keine Gebärde existiert, eine Abkürzung oder auch ein unbekannter Name können buchstabiert werden mithilfe des Fingeralphabets. International verbreitet ist das Einhand-Fingeralphabet, bei dem die Buchstaben mit den Fingern einer Hand gebildet werden (9).
Anmerkungen
1 Diese Verweise werden im Kapitel Erläuterungen (S.223) erklärt.
2 Penny Boyes Braem, Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung, Hamburg 1995, S. 33.
3 Ebd., S. 36.
4 Ebd., S. 105.
Rita Zimmermann
geboren 1947
Rita war fünfeinhalb Jahre alt, als sich bei einer Untersuchung herausstellte, dass sie gehörlos ist. Und bis sie erstmals eine Förderung erhielt, verging ein weiteres Jahr. Außer über einfache Zeichen – von echter Sprache keine Rede – konnte sie also auf sprachlichem Weg fast sieben Jahre lang keinen Kontakt zu ihren Mitmenschen aufnehmen. Es beeindruckt, wie Rita trotzdem ihren Weg machte: Sie schloss eine Lehre als Pelznäherin ab, absolvierte die Ausbildung als Gebärdensprachlehrerin und steckte unzählige Schülerinnen und Schüler, Hörende und Gehörlose, mit ihrer Begeisterung für die geliebte Gebärdensprache an. Heute ist Rita beim Dima-Sprachverein1 angestellt und unterrichtet gehörlose Migrantinnen und Migranten. Und sie ist regelmäßig als Großmutter im Einsatz, da ihre Tochter berufstätig ist.
Rita war ein sehr aufgewecktes, aufmerksames Kind. Wachsam wie ein lauerndes Kätzchen achtete sie auf Zeichen in ihrer Umwelt, ob sie ihr einen Hinweis gaben, was vor sich ging, was von ihr erwartet wurde. Instinktiv entwickelte sie Strategien, schon als Kleinkind, die ihr halfen, sich möglichst gut einzufügen. Beim Spielen mit dem Nachbarshund behielt sie seine Ohren im Blick, denn zuckten sie oder stellte er sie auf, bedeutete das, dass sie sich umsehen musste. Hatte vielleicht jemand nach ihr gerufen? Sie hätte es nicht hören können, denn Rita war gehörlos (15, 17) zur Welt gekommen.
Sie wurde als erstes von vier Kindern geboren, von denen das jüngste schon nach wenigen Monaten starb. Als sie vier Jahre alt war, trennten sich die Eltern. Rita und die beiden Geschwister wurden nun fremdbetreut, die kleine Schwester von der Patin der Mutter, Rita und ihr Bruder in einem Kinderheim in St. Gallen.
Noch wusste niemand, dass Rita gehörlos war. Niemand war der Frage auf den Grund gegangen, warum sie nicht sprechen konnte. Ob die Eltern zu sehr mit ihren Eheproblemen beschäftigt gewesen waren und keine Zeit gefunden hatten, sich um das kleine Mädchen zu kümmern? Ob die Betreuerinnen im Heim sich nur für das körperliche Wohl der Kinder verantwortlich fühlten? Oder ob sich Rita dank ihrer außergewöhnlichen Beobachtungsgabe bisher kaum auffällig verhalten hatte? Die Fragen bleiben unbeantwortet.
Nach eineinhalb Jahren durften die drei Geschwister wieder zur Mutter zurück. Sie war eine neue Beziehung eingegangen und heiratete, als Rita achtjährig war, zum zweiten Mal. Der Stiefvater adoptierte Rita, ihren Bruder und die Schwester. Drei weitere Kinder wurden geboren, und mit der Kinderschar wuchs auch die Belastung. Rita als die Älteste wurde mehr und mehr als Kinder- und Dienstmädchen eingespannt. Sie machte die Betten und die Wäsche, kochte für die Familie, fütterte und wickelte die Kleinen. Noch heute sagt die fünfzehn Jahre jüngere Schwester zu Rita: »Du bist eigentlich meine Mama.« Freizeit, spielen, im Garten herumtollen? Dafür blieb keine Zeit. Der Stiefvater führte ein strenges Regime, duldete keine Widerrede, sparte nicht mit Strafen. Rita war sozusagen ein Verdingkind2 in der eigenen Familie.
Aber sie ließ sich nicht unterkriegen, dachte sich kleine Vergeltungen aus, bettete zum Beispiel mit dem Leintuch ein Schlupfbett oder nähte einen Pyjamaärmel zu. Die harmlosen Streiche bereiteten ihr einen persönlichen Triumph und hellten ihren Alltag auf. Die Strafe des Stiefvaters nahm sie in Kauf, sie konnte es ihm ja ohnehin nie recht machen. Da hatten es die Geschwister viel leichter. Vor allem die drei Jahre jüngere Schwester schlich sich oft davon und überließ Rita die ganze Arbeit. Die Mutter mischte sich nicht ein, und Rita selber konnte sich nicht wehren. Sie war völlig ausgeschlossen von jeder verbalen Kommunikation.
Dieses Fehlen einer Verbindung zu den Mitmenschen über Sprache und Gehör führte zum Glück nicht dazu, dass Rita verbitterte oder sich in sich selbst verkroch. Stattdessen entwickelte sie in ihrer Einsamkeit eine außerordentliche Fähigkeit zu beobachten, saß zum Beispiel in einem langen, dunklen Gang vor dem Mauseloch und beobachtete geduldig. Wartete in höchster Konzentration, bis sich das Mäuschen aus dem Versteck wagte. Wusste genau, was nun zu tun war: Das Händchen schnellte vor und packte das Mäuschen im exakt richtigen Augenblick. Dann brachte Rita die Beute stolz der Mutter, die es kaum glauben konnte: Das Kind hatte eine Maus gefangen, es war ja geschickter als die Katze (8)!
Nur, darüber reden, das konnte Rita nicht. Sie konnte dem Stiefvater am Abend nicht von ihrer Heldentat erzählen noch vor ihren Geschwistern damit auftrumpfen. Hätte es auch nicht gehört, falls die Mutter die Geschichte voller Stolz der Nachbarin berichten sollte. Das Kind hatte keinen Zugang zur Lautsprache. Wie durch eine dicke Glasscheibe war es von den anderen Menschen getrennt.
In ihrer Isolation entfaltete Rita nicht nur eine ausgeprägte Beobachtungsgabe, sondern auch eine Eigenständigkeit und ein starkes Selbstverantwortungsgefühl. Sie unternahm schon als Kleinkind Streifzüge nach St. Gallen, fuhr allein, nur in Begleitung des Nachbarshundes, mit der Mühleggbahn von St. Georgen ins Stadtzentrum hinunter. Der Fahrer der Drahtseilbahn kannte sie und wusste, sie würde ihren Heimweg schon finden, er musste sich nicht um sie kümmern.
Mit den Geschwistern verständigte sich Rita in einer Art Zeichensprache. Zusammen entwickelten sie eigene Handbewegungen, die sich aber nur auf das Notwendigste beschränkten: Komm her! Hilf mir! Lass mich in Ruhe! Du bist doof! Oder der Bruder zog Rita am Ärmel und zeigte ihr, was zu tun sei.
Als Rita fünfeinhalb Jahre alt war und immer noch nicht reden konnte, suchte die Mutter, nun doch allmählich beunruhigt, Rat bei einer Kollegin. Die schlug vor, man solle das Kind in der Taubstummenanstalt und Sprachheilschule in St. Gallen (heute Sprachheilschule St. Gallen) untersuchen lassen. Zwar hatte die Mutter ihren Arzt schon früher einmal darauf hingewiesen, dass ihr Kind nicht sprach, aber er war der Meinung, Rita sei einfach ein verwöhntes, wildes Mädchen; in Bezug auf ihre Sprachentwicklung liege nichts Außergewöhnliches vor, das Sprechen werde sich ganz von selbst einstellen. Also hatte die Mutter die Sache auf sich beruhen lassen. Trotzdem, das Kind war nun schon fünfeinhalb und sagte noch immer kein Wort. Die Mutter beherzigte den Ratschlag der Kollegin und fuhr mit Rita nach St. Gallen. Dort zeigte sich: Das Kind war gehörlos.
Gehörlos? Das konnte sich die Mutter nicht vorstellen. Rita war doch ein gelehriges Mädchen, ging ihr im Haushalt schon fleißig zur Hand und kümmerte sich um die jüngeren Geschwister. Wie war es möglich, dass es nicht hören konnte? Betroffen kehrte sie mit dem Kind nach Hause zurück.
Nun wurde Rita aber nicht, wie man das heute erwarten würde, unverzüglich in ein Frühförderprogramm (12) aufgenommen. Nein, man ließ ein weiteres Jahr verstreichen, in dem Rita sich selber überlassen blieb und keine Möglichkeit hatte, mit ihren Eltern zu kommunizieren.
Im Alter von sechseinhalb Jahren, im Frühling 1954, wurde sie endlich in die Sprachheilschule eingeschult, zusammen mit elf weiteren Kindern mit einer Hörbehinderung. Doch während die anderen Kinder im Schulinternat untergebracht waren, fuhr Rita jeden Abend heim. Der Weg dauerte fast eine Stunde. Und war sie endlich zu Hause angekommen, erwartete sie dort die Hausarbeit. Ein langer Tag für ein kleines Mädchen.
Der Einstieg in den Unterricht war auch kein Zuckerschlecken, denn Rita hatte einen großen Rückstand aufzuholen. Anders als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler verfügte sie noch nicht einmal ansatzweise über irgendeine Form von Sprache, konnte weder von den Lippen ablesen noch in Lautsprache artikulieren (1). Deshalb war Üben angesagt, Üben und nochmals Üben. Der Unterricht hatte vor allem ein Ziel: die Lautsprache zu erwerben. Das Sch musste eingeschliffen werden, der Unterschied zwischen G und K, das Ng. Das R wurde nur akzeptiert, wenn ein vor den Mund gehaltenes Zeitungsblatt zu flattern begann – das vorn gerollte R, wohlverstanden, das Gaumen-R, wurde nicht gebilligt! Dieser Lernprozess war sehr anstrengend und zeitraubend. Daneben lernten die Kinder lesen und schreiben. Auch um sich das Lippenlesen anzueignen, mussten die Kinder viel Geduld und einmal mehr große Konzentration aufbringen. Denn im Deutschen können nur höchstens dreißig Prozent der Laute eindeutig von den Lippen abgelesen werden, die anderen siebzig Prozent müssen ergänzt beziehungsweise erraten werden. Eine Ergänzung ist aber nur möglich, wenn man auf einen gewissen Grundwortschatz zurückgreifen kann, denn wie soll man ein Wort erraten, das man gar nicht kennt?
Also musste auch der Wortschatz erarbeitet werden. Die Kinder lernten Sätze auswendig, immer gleich strukturierte Gebilde – rein mechanisch, ohne deren Sinn zu kennen, übten sie sozusagen tote Wortkörper ein, reine Worthülsen, ohne eine Vorstellung zu haben, welcher Sinn sich dahinter verbarg: »Der Baum ist grün«, »Der Busch ist grün«, »Die Hecke ist grün«.
Nur, was war überhaupt ein Baum oder ein Busch oder eine Hecke? Bilder wurden keine eingesetzt, obwohl sie doch so hilfreich gewesen wären. Und das Sprechen mit den Händen, das Gebärden? War strengstens verboten (25)! Die ganzen acht Schuljahre lang. Immer. Auch in den Pausen, wo eine Lehrperson ständig darüber wachte, dass dieses Grundgesetz eingehalten wurde. Die Hände durften nicht gebraucht werden. Punkt. Zum Glück aber haben Lehrpersonen keine Insektenaugen. Drehten sie den Kindern den Rücken zu, so begannen diese sogleich, miteinander zu gebärden. Für Rita eine ganz neue und wunderbare Erfahrung. Endlich hatte sie die Möglichkeit, spontan draufloszuplaudern, ohne dauernd Angst zu haben, sie verliere den Gesprächsfaden oder verstehe etwas falsch.
Aber eben, die Gebärdensprache kam nur in den Pausen zum Zug und nur, wenn die Aufsichtsperson wegschaute. Leider. Denn dank des Gebärdens lernte Rita sich selbst besser kennen, und es unterstützte sie auch beim Erwerb der Lautsprache. Lautsprachliche Äußerungen füllten sich auf einmal mit Inhalt. Sätze, die sie vorher rein mechanisch nachgesprochen hatte, bekamen plötzlich einen Sinn. Schade nur, dass die Pausen so kurz und die Aufsichtspersonen so aufmerksam waren. Wer beim Gebärden erwischt wurde, erhielt Schläge auf die Finger oder musste hundertmal »Ich darf nicht gebärden« schreiben.
Im Gegensatz zur Gebärdensprache spielte das Hörgerät, das Rita im Alter von zehn Jahren verpasst wurde, nur eine untergeordnete Rolle. Sie konnte dieses lästige Ding nicht ausstehen, das an ihrem Hals baumelte und nur knackte und knirschte und undefinierbare Geräusche von sich gab, die man überhaupt nicht orten konnte. Kaum zu Hause, zog sie das verhasste Ding aus und versorgte es in der Schublade.
Auch ohne Hörgerät machte Rita große Fortschritte. Sie übte viel und gern und war zutiefst wissbegierig. Nach etwa vier Jahren hatte sie das Lesen erfasst, artikulierte nicht mehr nur leere Worthülsen, sondern konnte richtig verstehen, den Wortsinn aufnehmen und einer Erzählung folgen. Die Tür zu einer neuen Welt war ihr aufgegangen. Sie liebte es, Märchen zu lesen, selber welche zu erfinden und zu erzählen, dies allerdings nicht nur mit Worten, sondern immer auch mit den Händen. Rita war regelrecht ausgehungert, begierig nach Geschichten, nach Stoff für ihre Fantasie. Doch dieses Bedürfnis konnte die Schule nicht stillen, denn der Fächerkanon bestand hauptsächlich aus Sprache, Rechnen, Zeichnen, ein bisschen Naturkunde und Geografie. Geschichte wurde überhaupt nicht unterrichtet.
Erst Mitte dreißig wurde Rita so richtig bewusst, wie eingeschränkt ihr Unterricht gewesen war, dann nämlich, als ihr älteres Kind eingeschult wurde und sich bereits in der ersten Klasse mit dem Stoff befasste, den sie selbst in der sechsten Klasse durchgenommen hatte.
Schon während ihrer Schulzeit also las Rita gut und sehr gern. Deshalb zögerte sie nicht lange, als ihre Mutter sie einmal vor Weihnachten fragte, ob sie sich etwas wünsche. »Ja«, antwortete sie, »ein eigenes Buch!« Zwar wurde ihr Wunsch erfüllt, aber leider hatten die Eltern wenig Verständnis für ihre neue Leidenschaft. Deshalb konnte sie tagsüber nur im Verborgenen lesen, und wenn sie vom Stiefvater erwischt wurde, nahm er ihr das Buch weg. Einzig im Bett vor dem Einschlafen fand sie etwas mehr Zeit und Muße. Doch es dauerte nicht lange, bis sie der Stiefvater auch dort ertappte. Nun kontrollierte er regelmäßig durchs Schlüsselloch, ob in ihrem Zimmer noch Licht brannte. Also musste sie unter der Bettdecke im Schein der Taschenlampe lesen.
Ritas Alltag war, wie gesagt, sehr hart: Schule bei einem strengen Lehrer, lange Hin- und Rückfahrten und daheim die Hausarbeit. Ohne dass sie je in die Kochkunst oder Babypflege eingeführt worden wäre und ohne dass ihr jemand die Handgriffe beim Waschen und Bügeln erklärt hätte, hatte sie sich ganz selbständig das notwendige Wissen angeeignet, nur durch Beobachten und Imitieren; an Gelegenheiten, sich darin zu üben, fehlte es ihr jedenfalls nicht …
Seit sie in der Schule das Ablesen und Artikulieren der Lautsprache lernte, war sie aber wenigstens nicht mehr ganz allein in ihrer Welt, denn nun konnte sie mit ihren Geschwistern leichter Kontakt aufnehmen. Immer häufiger versuchte sie, sich mit ihnen in Lautsprache zu verständigen. Allerdings redeten die Geschwister Dialekt, während der Unterricht in Hochsprache stattfand. Folglich musste sich Rita einmal mehr anpassen und die Mundart sprechen lernen. Und zwar möglichst korrekt, denn die Brüder und Schwestern waren noch unerbittlicher als der Lehrer: Sie plagten Rita und lachten sie wegen ihrer Aussprache aus. Doch das schreckte Rita nicht ab, sondern spornte sie erst recht an. Hin und wieder verbündeten sich die Geschwister aber auch mit ihr, um die Eltern zu überlisten. Sie sprachen dann einfach ohne Stimme, nur mit Mundbewegungen, und Rita las von ihren Lippen ab. So bekamen die Eltern nichts davon mit.
Ritas Kommunikation mit Stiefvater und Mutter war und blieb sehr eingeschränkt. Sie konnte nicht erzählen, was sich in der Schule zugetragen hatte, und wenn die Familie um den Tisch beisammensaß, war sie ausgeschlossen. Die anderen lachten und plauderten über Rita hinweg, und sie hatte keine Ahnung, wovon das Gespräch handelte. Die Eltern konnten sich nicht in sie hineinfühlen und wussten auch gar nicht, wie sie mit ihr reden sollten. Oft bat Rita ihre Mutter: »Bitte, Mama, erzähl mir, worüber ihr gerade sprecht! Ich habe nicht folgen können.« – »Das ist nicht wichtig für dich«, antwortete die Mutter dann oder vertröstete Rita auf später. Aber ein Später gab es nicht, denn später hatte die Mutter längst vergessen, was am Tisch verhandelt worden war. Rita tappte auch im Dunkeln, warum Weihnachten oder Ostern gefeiert wurden, denn niemand erklärte ihr den Sinn. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als die Abläufe zu beobachten und sich einzufügen, so gut sie das konnte. Manche dieser Zusammenhänge verstand sie erst, als sie sich Bücher kaufte, weil sie die Fragen ihrer eigenen Kinder beantworten wollte.
So lernte Rita früh, Probleme mit sich selber auszumachen, Ängste zu überwinden und Techniken zu entwickeln, um sich gegen Verletzungen zu schützen. Wenn die Leute um sie herum schwatzten und lachten, ließ sie sich nicht verunsichern. Sie riss sich zusammen und dachte: Nein, die lachen nicht über mich.3