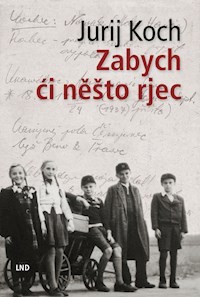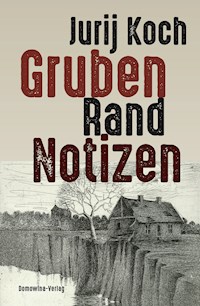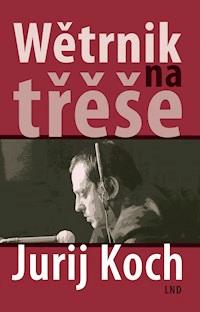7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er bewegt sich in einer eingedunkelten schattenreichen Welt: Gerat Lauter, noch nicht achtzehn. Er wartet darauf, dass seine mit Kalklauge verätzten Augen operiert werden können. Ob er danach wieder sehen wird? Die Chance steht fünfzig zu fünfzig. Alles begann mit dem Bewerbungsschreiben. Wer äußert sich auch so offen über sich selbst und stiftet damit Verwirrung. Nur noch zu sagen, was wahr ist - ein selbstgewählter Anspruch, dessen Folgen Gerat zu spüren bekommt, zu Hause, später im Betrieb, in der Liebe zu Claudia, seiner Lehrerin, von der er nicht weiß, zu wem sie hält, als es um die Aufdeckung eines großen Betruges geht. Die Druckausgabe von "Augenoperation" erschien 1988 beim Verlag Neues Leben Berlin und unter dem Titel "Schattenrisse" 1989 beim Spectrum Verlag Stuttgart und 1993 bei dtv München. Das Buch wurde 1991 von der DEFA verfilmt (Tanz auf der Kippe, Regie Jürgen Brauer).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Jurij Koch
Augenoperation - Schattenrisse
Roman
ISBN 978-3-86394-814-6 (E-Book)
Die Druckausgabe von "Augenoperation" erschien 1988 beim Verlag Neues Leben Berlin und unter dem Titel "Schattenrisse" 1989 beim Spectrum Verlag Stuttgart und 1993 bei dtv München. Das Buch wurde 1991 von der DEFA verfilmt (Tanz auf der Kippe).
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta Foto: Thomas Kläber
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Von meinem Fall, dem Fall Gerat Lauter, existieren zwei Akten. Eine abgeschlossene im Archiv der Staatsanwaltschaft. Eine zweite in der Augenklinik bei Professor Hedderoth. In der zweiten fehlen die letzten Seiten: Verlauf und Ergebnis der Operation. Sie wird Klarheit bringen. Das ist in meinem Fall wörtlich zu nehmen. Meine Aktion, falls sie am Ende der Betrachtung noch als Aktion bezeichnet werden kann, hat mir zwei blinde Augen eingebracht. Meine Chancen stehen fünfzig zu fünfzig. Es kann mir keiner etwas vormachen. Ich hatte sieben Monate Zeit, mich mit meinen Augen zu beschäftigen. Meinen halbtoten Augen sieben Monate in meinem Zimmer bei Kleebusch. Auf der Straße vor dem verfallenen Jugendstilgebäude. Dahinter in den Gassen. Manchmal bis zum Fluss, über den Nonnensteg sogar. Ich habe Radio gehört und mir Bücher vorlesen lassen.
Meine Augen sind zwei Milchglaskugeln. Man sieht ihnen die irrsinnige Bemühung an, etwas von der Welt wahrzunehmen. Als Schatten und weniger Schatten. Professor Hedderoth sagt, ich habe gekochte Fischaugen. Gekochte Fischaugen klingt viehisch, vor allem aus seinem Munde. Als ich's zum ersten Mal hörte, dachte ich, der Mann ist bescheuert. Hat jedes Gefühl verloren. Für das, was in einem vorgeht, wenn man sich mit solchen Augen vorstellt. Macht sich lustig über das Elend, das ihm täglich vorgeführt wird. Schottet sich ab mit Humor. Ist aber nicht. Gekochtes Fischauge ist Fachausdruck. Manchmal drückt sich die Medizin ländlich aus.
Fünfzig zu fünfzig. Das ist so, als führte man mich in einen dunklen Raum, der zwei Lichtschalter hat. Ich muss mich für einen entscheiden. Den rechten oder den linken. Einer wird den Raum erhellen. Der andere wird nur knipsen. Und es wird dunkel bleiben. Zappenduster. In ein paar Tagen, Gerat Lauter, kannst du entweder den richtigen oder den falschen Schalter erwischen. Keiner kann dir helfen. Keiner kann dir einen Tipp geben. Nimm den, nimm den! Die Natur hat noch genügend Räume, in denen immer von zwei Schaltern einer tot ist. Leer. Ohne Strippe und Saft. Zur Veralberung des Menschen. Zur Verhöhnung. Doch möchte ich verdammt gern erfahren, wie das Licht angeht. Wie ein dunkler Raum sich aufhellt. Und die Dinge in ihm.
Sieben Monate und drei Tage seit dem Sturz. Dem Abgang in die Brühe. Sieben Monate bei meiner Wirtin, die Kleebusch heißt und eine Wohnung hat im Jugendstilgebäude in der Mitte der Stadt. Gewartet, dass sich die Augen beruhigen und reif werden für Hedderoths Messer. Kleebusch ist fünfzig Jahre älter als ich. Kleebusch kann erzählen. Und singen. Wir haben manchmal zusammen gesungen. Sie hat das Essen gemacht. Und die Wäsche. Manchmal ist Juliane gekommen, meine Schwester. Manchmal Mutter. Mein Vater nicht. Weil ich das so wollte. Vielleicht wäre er gekommen. Petra war da. Vor allem die.
Das ist fast alles, was von den sieben Monaten zu sagen wäre. Kein Wort über den Prozess. Er ist nicht der Erwähnung wert. Er steht eingeaktet im Archiv der Staatsanwaltschaft.
Nun endlich bald die Operation. Ich habe das Bett am linken Fenster, wenn man reinkommt. Darunter der Klinikhof. Das am rechten Fenster hat Hinnerk. Das an der Tür Albert. Hinnerk hat Tintenstift im Auge. Und gute Aussichten, mit einem blauen Auge davonzukommen. Aber er freut sich nicht. Er heult sogar. Heimlich, wenn er denkt, dass ich's nicht merke. Unter der Decke. Ich frage. Er antwortet nicht. Traurigt vor sich hin, dass man denken könnte, hier stimmt was nicht. Tintenstift ist gefährlich.
Und Albert. Neunundsiebzig, Maurer. Grauer Star. Albert will immer nach Hause. Zur Tochter. Doch die Tochter will ihn nicht. Das weiß hier jeder. Sie hat ihn ins Heim gegeben. Weil sie selbst nicht klarkommt. Mit nichts. Mit Männern nicht. Mit Kindern nicht. Dem Vater. Sich selbst. Er will zu ihr. Will sich plötzlich den Star nicht herausnehmen lassen. Steht auf und läuft davon. An der Treppe fangen sie ihn wieder ein. Ich sage zu ihm: Mensch, Albert! Ein Peitschenknall, und der ist raus, der Star.
Ich kenne mich auf den Fluren der Klinik aus. Zweite Tür links das Zimmer der Schwestern. Petras Aufenthalt. Petra ist, wie soll ich sagen, die Zusammenfassung aller Vorstellungen von guten Krankenschwestern. Da muss man meine Sentimentalität verstehen. Sie spricht leise. Auch wenn sie nichts sagt, versteh ich sie. Ich kann ihren Atem deuten. Wie sie einatmet und wie sie ausatmet. Langsam, schnell. Manchmal ist ein leiser Ton darin.
Das ist mir schon an jenem Abend aufgefallen, an dem ich mich bis zum Krankenhaus durchgeschlagen habe. Petra war unter den Schwestern, denen ich in die Arme lief. Sie musste mich halten. Als sie meine Augen spülten. Es war Eile geboten. Die Verätzung hatte schon Zeichen hinterlassen. Sie sprachen erregt miteinander. Der Arzt stolperte über seinen Stuhl, er fluchte, er telefonierte mit dem Chefarzt. Der nicht in der Klinik war. Der gleich kommen wollte. In der Zwischenzeit sollte gespült werden. Noch einmal ran an die Buletten. Schnell!
In mir stieg Angst auf. Dass es aus sein könnte. Mit dem Tageslicht. Für immer. Sie mussten mitbekommen haben, was mit mir los war, dass ich Angst hatte und so, und versuchten mich zu beruhigen.
Keine Angst! sagte Petra. Wir müssen nur noch einmal. Halten Sie den Kopf nach hinten!
Aber ich hatte mit dieser Angst zu tun, mit der ich noch nie etwas zu tun gehabt habe. Mit Ängsten schon, aber nicht mit dieser. Sie kam unerwartet wie ein Krokodil aus der Spree.
An der Wand des Behandlungsraumes hing ein Kalender. Mit Bild, darunter der Monat, darunter die Tage einer Woche: Ich versuchte die Zahlen zu erkennen. Die großen Buchstaben des Monats. Es musste September heißen. Aber es konnte auch Oktober heißen. Es war die letzte Woche des September. Das Blatt konnte vorzeitig gewendet worden sein, dann las ich September, wo schon Oktober stand.
Schwester, fragte ich, steht dort September?
Sie drehte sich nicht nach dem Kalender um. Ja, sagte sie. Aber sie holte tief Luft. Ja, September.
Dann kam ein anderer Arzt hinzu. Er begann sich für meine Kopfverletzungen zu interessieren. Vor allem für die Wunde am Hinterkopf. Ich war nicht gut gefallen.
Sind Sie gefallen? fragte er.
Er ist zusammengeschlagen worden, antwortete der Augenarzt für mich. Auf der Deponie am Stadtrand. Und in ein Bassin geworfen. Mit Kalklauge. Es ist eine merkwürdige Geschichte. Wir müssen die Polizei verständigen.
Ätzkalk?
Ja
Er ließ einen Pfiff hören. Er wusste Bescheid. Er wusste, was Kalklauge für Augen bedeutet.
Von wem, fragte er weiter, von wem sind Sie zusammengeschlagen worden? Ich spürte einen brennenden Schmerz. Er machte etwas an der Wunde, die ich schon vergessen hatte. Erzählen Sie!
Ich sah nicht ein, dass ich ihnen alles erzählen sollte. Warum? fragte ich, soll ich Ihnen das alles erzählen?
Erzählen Sie! sagte er. Es ist besser, wenn Sie erzählen. Wir haben die Polizei verständigt. Dann werden Sie ohnehin alles erzählen müssen.
Raupe, sagte ich.
Was, Raupe? fragte der Augenarzt.
Raupe ist ein Mann, sagte ich. Er heißt so.
Gut, Raupe. Weiter! War noch jemand dabei?
Rucksack-Erich.
Er wiederholte den Namen und klammerte die Wunde. Mir wurde übel. Noch nicht so sehr, dass ich mich übergeben musste. Aber mir wurde sehr übel.
Also die beiden?
Ich wollte ihnen sagen, dass noch ein dritter beteiligt gewesen war, aber ich brachte seinen Namen nicht mehr heraus. Ich übergab mich. Ich kotzte. Mitten hinein in die gute Stube. Ich schämte mich, aber ich fühlte mich erleichtert. Ich hatte den Namen nicht mehr über die Lippen gebracht.
Sie behielten mich zwei Tage in der Klinik. Zur Beobachtung. Mit der Aussicht auf eine erfolgreiche Operation wurde ich entlassen. Aber ein reichliches halbes Jahr muss ich warten, sagten sie. Dann begab ich mich in die eingedunkelte schattenreiche Welt.
Professor Hedderoth will die Operation vorzeitig wagen. Keratoplastik. Meine trübe Hornhaut wird entfernt und mit durchsichtiger ersetzt. Von einem Toten. Mehr sagt er nicht. Tut so, als wüsste er selber nicht, von wem die Transplantate stammen. Oder von WAS. Sagt man beim Toten von WEM? Es ist sicher, dass ich wieder sehn werde. Voll. Zunächst. Dann erst beginnt die Spannung. Ob das Auge die neue Hornhaut annimmt oder nicht. Acht Tage Unsicherheit. Acht Tage nach der Operation.
Heute hab ich mit Hinnerk am Flurfenster gestanden. Er war gesprächiger als sonst. Er beschrieb den Bahnhof unter uns. Die Gleise und so. Wie sie aus der Stadt laufen. Ich fragte ihn nach anderen Dingen. Zum Beispiel, ob noch was von dem Gasometer zu sehen ist, aber er blieb bei seinen Schienen. Einmal sagte er, als der Pfiff einer Lokomotive zu hören war, dass sie mit einem solchen Zug davongefahren ist. Wer ist SIE? fragte ich. Er drehte sich vom Fenster und ging. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist.
Von Petra weiß ich, dass heute Alberts Tochter zu erwarten ist. Petra ist bei ihr gewesen, um sie zu überzeugen, den Vater zu überzeugen. Zugesagt hat sie.
Warten im Krankenhaus. Ich sitz im Innenhof der Klinik. Wasser spritzt aus einem Rohr ungefähr einen Meter hoch und fällt ins Becken zurück. Dahinter steht eine palmige Pflanze. Und bewegt die Arme. Mit gespreizten Fingern. Sobald sich die Flügeltür öffnet. Palmen sind Mode. Ich sollte für Tobias eine besorgen. Und für Ines mit. Wenn man schon nicht hin kann, wo sie im Freiland stehn.
2. Kapitel
Angefangen hat's, wenn ich's genau nehme, an dem Tag, als wir neben der Schule Fußball spielten. Neun A gegen die Lehrer. Es stand 1:0 für uns. Die Mädchen ringsherum. Es war der vorletzte Schultag vor den Herbstferien. Die Mädchen schrien sich dusslig. Ich wusste, dass Ines unter ihnen war. Ich schoss das 2:0. Aber Tobias gab mir keine Vorlage mehr. Zwischen ihm und mir bestand eine Feindschaft, von der wir beide nicht wussten, woher sie kam. Vielleicht aus dem Paradies. Folgen der Erbsünde. Oder so was.
Tobias saß zu Beginn der Neunten neben Ines. Ines Kurfürst, wenn der volle Name interessiert. Ich weiß bis heute nicht, ob die beiden etwas miteinander gehabt haben. Er hatte eine windhundartige Gestalt, dünn, mit langen Hinterbeinen. Wenn er in den Startlöchern zum Hundertmeterlauf saß, bekam ich immer meinen Lachanfall. Ich sagte ihm, dass er mit Leichtigkeit Weltrekord läuft, wenn er unterwegs bellt. Außerdem pflegte er sich gern sein Fell. Er hatte in jeder Tasche einen Kamm. In verschiedenen Größen und Formen. Darunter einen, dessen Metallgriff sich als Hülle auf die Zähne klappen ließ. Einmal hatte er ihn auf der Bank liegenlassen. Ich klappte die silberne Hülle zurück. Die Zähne waren voll Dreck. Ich zeigte ihn Ines. Sie wandte sich angewidert ab. Er war ein schneller, schlampiger Hund. Es fehlte noch, dass er sein Untergestell genauso wenig säuberte wie seinen Kamm. Aber das sagte ich Ines nicht. So weit wollte ich nicht gehn.
Eines Tages erschien er mit der Nachricht, dass er bei den Bezirksmeisterschaften für Haarkunst als Modell teilnehmen wird. Seine Frisöse hat ihn überredet. Seine! Frisöse. Ich bekam wieder diesen Lachkrampf, der nicht lange dauert, aber sehr intensiv ist. Und fragte ihn, ob ihn sein! Schofför von der Schau abholt. Ich hatte die Klasse auf meiner Seite, wenn ich ihn auf diese Weise fertigmachte. Aber auch das Gefühl, dass Windhunde nicht leicht aus dem Rennen zu werfen sind. Einmal sah ich, dass Ines in seinem schwarzen Haar wühlte. Leicht mit den Fingern, wie's die Mädchen tun, wenn sie die langhaarigen Puppen weggelegt haben. Mir hatte sie noch niemals in die Haare gefasst. Von den Haarlackmeisterschaften kam er mit zwei Fotos zurück, auf denen er als drittes Modell zu sehen war. Einmal von vorn, feixend, einmal von hinten mit den in der Mitte auf- und zueinander gekämmten Haaren. Ich fragte ihn, wie die Frisur heißt. Er antwortete Entenarsch. Und wir jubelten.
Nach den Ferien verspätete sich Tobias um einen Tag. Ich besetzte den freien Platz neben Ines. Sie hatte nichts dagegen. Aber als er am nächsten Tag erschien, mit einem Schnurrbart unter der Nase, forderte er mich auf aufzustehn. Ich pfiff drauf. Er sagte, ich soll gefälligst auf meinen beschissenen Platz zurückkehren. Ich blieb sitzen und tat, als wär an dem einen Tag, an dem er gefehlt hatte, allerhand losgegangen. Ines spielte mit, indem sie wie ich mit einem Auge zwinkerte. Tobias griff nach mir und zog mich aus der Bank. Und schleuderte mich über meinen eigenen Stuhl hinweg in die andere Bankreihe. Liegend noch schrie ich: Bescheuert, was! Dir ist wohl Lack ins Gehirn gekommen!
Er hatte sich hingesetzt und blätterte in seinen Heften, als wär nichts gewesen. Ich warf eine Tasche in seine Richtung. Er fing sie auf und warf sie zurück.
Wenn ich dir sage, du sollst von meinem Platz gehn, dann hast du von meinem Platz zu gehn, rief er.
Gar nichts hab ich.
Haste, merk dir das. Oder soll ich dich noch einmal...
Versuchs doch, du Entenarsch. Weißt du, dass du noch viel schlimmer aussiehst wie ein Entenarsch.
Er sagte: Als! Das heißt als! Entenarsch.
Damit traf er mich härter als mit dem Hinauswurf aus seiner Bank. Ich verbesserte, sooft ich's konnte, seine steinzeitlichen grammatikalischen Fehler. Die Ausdauer, mit der ich's betrieb, hatte ihn verunsichert, dass er oft nicht wagte, den Mund aufzutun. Nun konnte er endlich einen Stein zurückwerfen, den er von mir an den Kopf gekriegt hatte. Ich wollte nicht zugeben, dass er Recht hatte. Und stritt, dass man auch wie! Entenarsch sagen kann. Bis die Lehrerin kam und wissen wollte, worum wir stritten. Sie entschied zu meinen Ungunsten, benutzte aber statt Entenarsch ein anderes Wort.
Ines war offensichtlich mit dem erneuten Wechsel zufrieden. Was mir nicht in den Kopf ging. Ich konnte nicht begreifen, dass sie den Unterschied zwischen uns nicht sah. Und mich mit diesem englischen Pavian, falls es so etwas gibt, auf eine Stufe stellte. Für mich gab es überhaupt keinen Zweifel, wer von uns beiden aus der Sicht eines Mädchens der Bessere war. Gleich in der nächsten Stunde sah ich, dass sie sich beschriebene Zettel zuschoben. Ich vermutete, es ging um mich. Außerdem sah ich in der Pause, dass Ines in seine dicken Bemmen biss, die er ihr hinhielt.
Ines war ein staketenartiges Wesen, falls eine Vorstellung davon möglich ist. Ich hab noch nie eine Gazelle laufen sehn. So wie sich Ines fortbewegte, stelle ich mir Gazellen in freier Wildbahn vor. Wenn sie auf dem Hof luftwandelte, fiel ihr hochgetragener Kopf auf. Was an ihrem schönen Hals lag. Wenn sie sich bückte, verschwand sie in der Steppe der anderen. Mit der Brust hatte sie ihre Schwierigkeiten. Auch wenn sie sie vorantrug, war nicht viel von ihr zu sehn. Sie half ein bisschen mit Schaumgummi nach. Ines als ein besonderes Exemplar ihrer Gattung. Eigentlich gefiel sie mir nicht. Trotzdem wollte ich, dass ich! ihr! gefalle. Warum, weiß ich nicht.
Einmal sagte ich - das lag daran, dass sie sich nun täglich von Tobias füttern ließ, als bekäme sie zu Hause nichts zu fressen -, dass einer, der behauptet, Ines an die Brust gefasst zu haben, ein Schaumschläger ist. Das war ein großer Fehler. Man darf Mädchen alles Mögliche sagen, nur nicht, dass sie keine Brust haben. Ines heulte los und verschluckte sich dabei. Und saß eine ganze Stunde mit glühenden Ohren in der Bank.
Na warte, das kriegst du zurück!
Ach, Mensch, Ines, ich... Ich bekam keine Entschuldigung zusammen. Außerdem wusste ich nicht, wofür ich mich entschuldigen sollte, wenn ich doch nichts weiter als die Wahrheit gesagt hatte. Jedenfalls, wie sie sich mir bot. Ich versuchte von nun an keine Kräfte mehr an die Gazelle zu vergeuden. Auch in den Stunden wollte ich Ines und Tobias nicht beobachten. Tat es aber. Doch nicht mehr so oft.
Ich rechnete damit, dass mich Ines' Vater zur Rede stellen wird. Er kreuzte in fast regelmäßigen Abständen in der Schule auf. Dienstlich. Weil er als Hauptberuf die Erziehung der jungen Generation ausübte, indem er von Schule zu Schule fuhr und dort nach dem Rechten sah. Er hatte mich schon einmal in eindringlich pädagogischer Weise ermahnt. Nach seiner Festrede zur Jugendweihe. Also, er hielt! diese, indem er sich fest an sein Manuskript hielt, das er kurz vor Ankunft am Pult aus der linken Sakkotasche zog. Das Papier war schon reichlich zerfleddert. Ich sahs, weil ich in der ersten Reihe saß. Er redete nicht schlecht, aber auch nicht besser als fast alle Redner bei uns. Ich zählte zunächst die Blumen auf dem Podest, wurde aber dann gestört, weil mir in der Rede ein Fehler auffiel: Als vor soundso viel Jahren die Russischen Arbeiter in Petrograd und so weiter aber das war nicht vor soundso viel Jahren, sondern vor soundso viel plus ein Jahren. Er hatte die Rede vom Vorjahr. Vielleicht sogar vom Vorvorjahr, nur dass er inzwischen auf Korrekturen verzichtete, weil er nicht mehr damit rechnete, dass ein Verrückter im Publikum sitzt, der alles nachrechnet. Wichtig ist allein die Tatsache, dass die Russischen Arbeiter in Petrograd und so weiter. Das sagte er mir, rot vor Zorn, nach der Feier, die durch meinen berichtigenden Zwischenruf in ihrer Weihe gelitten hatte. Dem schloss sich der Direktor an. Er wurde Otto I. genannt, aber keiner wusste, warum. Vielleicht, weil er tatsächlich Otto hieß. Ich denke eher, weil er sich nach einer Kaiserkrone im Schuldienst sehnte, um ein kleiner Imperator Augustus zu werden. Otto I. hatte mich längst auf dem Kieker. Wegen einer Reihe anderer Zwischenbemerkungen. Ich stand also allein mit meiner Meinung, dass die Weihe aufgewertet worden war, weil erstens die Wahrheit gesagt worden ist und zweitens viele wieder aufgewacht sind. Ines' Vater wird sobald nicht wieder mit einer alten Rede aufkreuzen können. Tut mir leid.
Also, wir spielten Fußball auf dem Platz neben der Schule. Das Spiel war noch nicht zu Ende, als der kleine Sohn des Hausmeisters angerannt kam. Mitten aufs Spielfeld. Tobias fing ihn auf und wollte ihn aus der Gefahrenzone bringen. Aber der Junge zappelte in seinen Armen. Er widersetzte sich heftig, dass mir klar war, er hatte was mitzuteilen. Kaum wieder auf den Beinen, sprang er zum Direktor und sagte ihm etwas. Daraufhin ging der vom Feld. Und nach ihm ein paar Lehrer. Ich schoss den Ball zum Ausgang. Als wir auf den Schulhof kamen, sahen wir das Auto und den fremden Mann neben ihm. Der ging gleich mit allen ins Haus. Und ins Sekretariat. Schon kurz darauf lief die Nachricht über die Flure und machte uns sprachlos und steif. Lehrer Lorenz ist tot. Gestorben gestern Vormittag. Während der Vorbereitung auf seine letzte Stunde vor den Ferien.
Neiein! rief Ines. Und griff sich an den Kopf. Sie rannte auf ihren Platz. Dort zerknüllte sie ein Heft. Wir sahen das, aber taten nichts dagegen. Es war, als brauchten wir nun tatsächlich keine Hefte mehr.
Am nächsten Tag versammelte sich die ganze Schule zur Gedenkminute. In einer Ecke der Aula stand sein Bild mit Trauerflor und Blumen. Eine Rede wurde gehalten. Vom Stellvertreter des Direktors. Otto I. war nicht da, weil er zu einer Konferenz war. Oder weiß der Teufel wo. Was uns nicht passte. Weil wir nicht begreifen konnten, dass etwas wichtiger sein konnte, als Lorenz ein paar gedenkende Worte zu widmen. Gerade diesem. Wenn es ein anderer gewesen wäre. Für diesen hätte er alles sausenlassen müssen. Alles, verdammt und zugenäht! Also sprach Goldi, der überhaupt nicht sprechen kann. Sein goldener Zahn funkelte. Wir verlieren einen treuen, aufrechten, ehrlichen und Pipapo. Es stimmte. Wir hatten einen solchen verloren. Aber niemand im Saal glaubte, dass Goldi darüber so traurig war, wie er vortäuschte. Und seinen spitzen Adamsapfel springen ließ, um vorzumachen, dass ihm etwas im Hals steckte. Er kaute seine Lüge. Jeder wusste, dass Lorenz Goldis Feind gewesen war. Lorenz hatte Goldis Sohn einen glänzenden Abgang von der Schule vermasselt. Mit einer fetten Vier, die er sich verdient hatte. Weil er den Inhalt eines Fasses nicht berechnen konnte. Ja, wenn ich's aussaufen darf, hatte er Lorenz gesagt, könnte ich sagen, wie viel drin war. Die Schulleitung war sauer, weil sich Goldis Sohn zur Armee gemeldet hatte. Lorenz sagte, dass er nicht schlafen kann, wenn er daran denkt, dass in der Armee mathematische Nullen an Kanonen stehen könnten. Schluss! Aus! Wir klatschten, als Lorenz wieder in unserer Klasse erschien, obwohl es geheißen hatte, dass er auf eine andere Schule gehen soll.
Und nun redete Goldi von seinem und aller Schmerz über den Verlust... Pah! Ich überlegte, ob ich gehen sollte. Aufstehn und gehn. Und eine Trauerfeier allein abhalten.
Irgendwo in einer Ecke. Vielleicht im Sessel am kleinen runden Tisch vorm Sekretariat, in dem er fast jede Pause gesessen hatte. Dorthin konnte man gehen. Mit seinen Fragen. Er war immer da. Es klingt sentimental. Aber es war so.
Uns war gleich in der ersten Stunde aufgefallen, dass er sehr gut zeichnen konnte. Er malte ohne Zirkel einen Kreis an die Tafel, der sich gewaschen hatte. Dabei stellte er den Ellbogen auf die schwarze Fläche und ließ den Arm mit Kreide einmal nach rechts und einmal nach links ausschlagen. Fertig. Auch die anderen geometrischen Figuren zeichnete er ohne Lineal und Dreieck. Einmal waren wir bei ihm zu Hause. Seine Frau hatte Kuchen gebacken. Und wir saßen im Zimmer herum. Er zeigte uns alles. Vor allem seine unheimliche Bibliothek. Von der ein Teil im Keller untergebracht war. Plötzlich entdeckte jemand die Folien mit Diagrammen, Paradigmen und anderen Mustern. Die uns bekannt vorkamen. Zunächst dachten wir, dass er sie aus den Lehrbüchern abgezeichnet hatte. Bis sich herausstellte, dass es umgekehrt war. Er zeichnete sie für den Schulbuchverlag. Stapelweise Versinnbildlichungen. Atome. Moleküle. Verschiebungen. Räume mit und ohne Inhalt. Er brachte die unsichtbare Welt ins Bild. Erst viel später erfuhren wir von der Auszeichnung, die er nicht angenommen hatte. Er sagte, ein anderer verdient sie, weil der andere den größeren Teil der geistigen Arbeit geleistet hat. Indem er! auf die Idee gekommen ist, wie etwas für Schulrüben begreiflich zu machen ist. Das muss man sich vorstellen. Ich meine, dass einer zehntausend Mark oder mehr oder weniger ablehnt, weil er der Meinung ist, er verdient sie nicht. Das gibt's nur im Russenfilm. Wo die Brigade eine Prämie ablehnt, weil sie gar nicht den Plan erfüllt hat, für den sie die kriegen soll. Da fasst man sich in der Regierung an den Kopf und wird stutzig: Was geht hier vor? Was wollen die damit erreichen? Auch einige von uns zweifelten, ob Lorenz alle beisammen hat. Wenn er so etwas tut. Als uns Ines die Geschichte erzählte, die sie von ihrem Vater hatte, der solche Dinge wusste.
Dann das Begräbnis. Wir hatten in der Klasse beschlossen, uns nicht nur hinzustellen und zu heulen. Wie es auf allen Begräbnissen geschieht. Wir wollten uns von Lorenz auf besondere Weise verabschieden. Zunächst sprach Otto I. Ich war froh, dass er nicht wieder auf einer Konferenz war, während wir einen guten Lehrer der Erde übergaben. Ich glaube, ich hätte Goldi nicht noch einmal zu Wort kommen lassen. Ich hätte mich hingestellt und losgeredet. Im Namen der Schülerschaft. Der Eltern. Des Ministers für Volksbildung. Das wäre die kleinere der beiden Lügen gewesen. Dann sprach jemand vom Bezirk. Dann vom Elternbeirat. Der Schulchor brachte nichts zustande. Er blieb bei der ersten Strophe stecken. Der Dirigent machte zwei Versuche. Dann heulte er mit. Wir traten alle noch einmal an den Grubenrand und warfen unsere Blumen auf den Sarg. Jeder unserer Klasse hatte sich einen Spruch für Lorenz ausgedacht. Zum Beispiel: Toter Freund, du bist nicht tot. Und: Wer so stirbt, stirbt nicht wohl. Tobias hatte einen Vierzeiler. Er brachte ihn nicht zusammen. Und trat nach mehreren Anläufen unverrichteterdinge vom Brett. Was ich als gute Lösung empfand, denn sein Vers ähnelte einem zerbeulten Eimer. Lorenz genügte die Bemühung. Er hatte für gute Lösungswege bessere Noten verteilt als für richtige Endergebnisse. Ich sagte einen Satz, der auf einem Papier auf dem Grab des Sängers und Schauspielers Wyssocki gestanden haben soll. Immer sterben die Falschen! Für einen Augenblick hörte das weitrundige Schluchzen auf. Ich hatte als letzter auf dem Brett gestanden. Nun löste sich die Trauergemeinde auf.
Otto I. trat zu mir und sagte: Na ja, ganz gut, nur...
Was meinen Sie? fragte ich.
Das mit den Falschen, die sterben. Du wünschst dir, dass andere...
Nein, wünsch ich mir nicht.
Aber es klingt so.
Ich meine, er hätte noch bleiben müssen. Er! Vor allem, sagte ich. Alle sollen bleiben. Einige vor allem. Die noch etwas zu erledigen haben. Die sollen nicht gehn. Aber die gehn.
Er hatte die Arme auf dem Rücken. Wie im Unterricht. Ich wusste, dass er sich bald verabschieden wird, weil irgendwo um die Ecke sein Auto stand. So ist es, sagte er. Wusstest du nicht, dass er schwer krank war?
Nein, keiner von uns wusste es.
Wir waren an seinem Wagen. Er fragte mich, ob er mich mitnehmen kann. Ich bedankte mich. Als er den Schlüssel aus der Tasche zog, sagte er: Komisch klingt es schon. Immer sterben die Falschen. Man kann sich vieles denken.
Er zündete schon. Ich sagte: Aber wenn man sich's denken kann, muss man es auch sagen können. Ich meine, es müsste immer alles gesagt werden können, was gedacht werden kann. Man kann doch nicht alles in den Kopf hinein verlagern. Und dort speichern. Und niemals wieder herausholen.
Ja, aber solche Sprüche, sagte er. Ich sah, dass er wegwollte. Er zeigte kein großes Interesse, sich mit mir darüber zu unterhalten, was man wo sagen kann oder nicht. Er legte den Gang ein.
Einige aus unserer Klasse holten mich ein und fragten, ob ich mit baden komme. Ich hatte keine Lust. Ich nahm mir vor, nach Hause zu laufen. Drei Kilometer. Unser Haus steht am Stadtrand, schon wieder im nächsten Dorf. Ich war schrecklich niedergeschlagen. Weil alles zusammenkam.
Zu Hause setzte ich mich in den Garten und begann ein dickes Buch zu lesen. In dem sich Mönche wie verrückt über etwas stritten. Morde kamen auch vor. Sein Autor sagt immer das Gegenteil von dem, was er meint. So groß ist die Kraft der Wahrheit, dass sie - wie die Schönheit - sozusagen von selber um sich greift. Und gelobt sei der Name unseres Herrn Jesus Christus für diese schöne Erkenntnis!
Als ich beim zweiten Mord war, kam Vater. Mit dem ersten Bus des Berufsverkehrs. Er fragte mich, was ich lese. Er wartete keine Antwort ab. Es interessierte ihn nicht, wonach er fragte. Er fragte, weils üblich ist, etwas zu fragen, wenn man nach Hause kommt. Ich glaube, er hat noch kein Buch zu Ende gelesen. Eigentlich wollte ich noch bis zum dritten Mord lesen, weil er zwischen den Zeilen angekündigt war, aber Mutter rief zum Abendbrot.
3. Kapitel
Abendbrote sind bei uns Festmahle. Mit Kerze auf dem Tisch. Und so. Vater wollte etwas von dem Prunk, der auf den Bildern an unseren Wänden zu sehen war. Er aß mit silbernem Besteck, das keins war. Er sagte, mit silbernem isst nicht mal die Regierung, weil Silber ungesund ist. Er führte uns vor, wie behaglich er sich fühlte, indem er langsam aß. Obwohl ich wusste, dass er gern schneller gegessen hätte. Ich stellte mir den malmigen Brei in seinem Mund vor. Zu allem trank er Rotwein. Ich wusste aber, dass er nach dem Essen in die Speisekammer gehen wird, um ein Bier hinunterzukippen. Aus der Flasche.
Esst, Kinder, esst! sagte er. Und meinte auch die Mutter.
Ich wartete auf den zweiten Teil des Abends. Nach der Sättigung wurden Familienangelegenheiten besprochen. Man konnte sein Herz öffnen. Nachdem sich Vater den Mund abgewischt hatte, legte er die Arme auf den Tisch und sagte: Dann schießt mal los!
Ich wollte nicht. Und stand auf.
Wo willst du hin? fragte er.
In mein Zimmer.
Du weißt...
Ja, weiß ich.
Setz dich!
Ich setzte mich, obwohl Mutter sagte: Lass ihn doch! Er hat einen schweren Tag hinter sich.
Was für einen schweren Tag?
Lorenz.
Was für Lorenz?
Der Lehrer.
Er hatte es vergessen. Es war zum Kotzen. Er hatte gewusst, aber den ganzen Tag nicht daran gedacht, dass mein Lehrer gestorben und beerdigt worden war. Dass wir alle auf dem Friedhof gewesen sind. Und gesungen haben. Und gebetet. Es wird mancher unter uns gewesen sein, der gebetet hat. Und er hatte in seinem Hotel gesessen, und es war ihm nicht für den Bruchteil einer Sekunde eingefallen, dass heute Lorenz... Den er gekannt hatte. Vom Sehen. Und Hören. Ich hatte oft von Lorenz erzählt.
Ach ja, sagte er. Das ist wirklich traurig. Wenn man bedenkt... Wie alt war er?
Nicht einmal vierzig, antwortete Mutter.
Ihm gefiel das Thema nicht, und er erzählte von einer Touristengruppe im Hotel, für die keine Zimmer reserviert gewesen waren. Panne. Übermittlungsfehler. Wie er hatte eingreifen müssen. Mit Ausweichquartieren. Die eigentlich nicht belegt werden dürfen. Er hatte es auf die eigene Kappe genommen. Dann fragte er übergangslos, ob ich mein Bewerbungsschreiben fertig habe. An dem ich seit Tagen schrieb. Ich nickte.
Zeig her! sagte er.
Ich stand auf und ging in mein Zimmer, das ganz vorn lag. Oder ganz hinten, wie man's nimmt. Mit den Papieren unterm Arm kehrte ich zurück. Ich reichte ihm den Lebenslauf und die anderen Bögen. Zunächst nahm er den Stapel und klopfte die überstehenden Blätter randbündig. Ich sah die Professionalität im Umgang mit Unterlagen. Und zugleich den unausgesprochenen Vorwurf gegen meine Respektlosigkeit gegenüber Akten. Er trug manchmal die ganze Belegschaft des Hotels unterm Arm. Das ganze Hotelwesen der Stadt. In Ordner geklemmt. Nun las er meine Papiere. Die ersten, die ich über mich selber angefertigt hatte. Er las an. Überflog vorauseilend. Kehrte zum Ausgangspunkt zurück. Blätterte um. Alles klar. Gut. Dann las er laut vor: Warum habe ich mich für den Beruf des Montageschlossers entschieden... Könnte ein Fragezeichen dahinter, oder?
Er las weiter, leiser werdend. Und verstummte. Nach einer Weile legte er das Blatt auf den Tisch. Und die Hand darauf.
Also, mein Junge, sagte er.
Was ist?
Wasistwasist! Er suchte nach Worten. Wenn ich's richtig überlege, ist er ständig auf der Suche nach Worten. Passenden. Wenn er für die Zeitung schreibt zum Beispiel. Es ist erstaunlich, wie viel Zeit er dafür hergibt. Er hat sich eine Kartei schöner Adjektive und Verben angelegt. Sie stammt aus der Zeit, als er noch Redakteur war. Bei einer kleinen Zeitung. Sie hatte ihr Erscheinen eingestellt. Was keinem aufgefallen war. Flurbereinigung im Blätterwald. Nun ist er Personalchef im Hotelwesen. Aber das Schreiben kann er nicht lassen. Er setzt auch Briefe und Anträge auf. Für Kollegen, Bekannte und Nachbarn. Die sich nicht gut ausdrücken können.
Weißt du, sagte er, wir werden uns alles noch einmal genau überlegen, was wir sagen. Was wir nicht sagen. Wie! wir das! sagen, was! wir sagen.
Ich schaute auf die Uhr.
Also, wenn du keine Zeit hast...
Ich sagte, dass ich schon Zeit habe, aber keine Lust und dass es nicht so wichtig ist, wie! etwas gesagt wird, sondern einzig und allein, dass!
Du musst noch viel lernen, mein Junge, sagte er.
Ich bat ihn, mich nicht weiter mit mein Junge anzureden. Weil es bescheuert klingt. Weil ich mich dabei als Schaf fühle.
Wieso Schaf?
Ich konnte es nicht genau begründen. Ich sah mich in einer Herde mit einem Hirten davor. Kläffende Hunde waren auch dabei. Er schüttelte den Kopf.
Es ist ja nicht für mich.
Also, fangen wir an, sagte ich.
Mutter und Juliane räumten ab. Sie zogen sich zurück. Es war mir recht, dass sie Platz machten. Ich ahnte, dass etwas passieren wird.
So wird kein Hering zu gewinnen sein, sagte er. Und hielt das Blatt wie einen Fisch am Schwanz.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel: Was heißt: lch habe den Wunsch, den Beruf des Montageschlossers zu ergreifen, weil er mir gefällt. Was gefällt dir? Der Wunsch oder der Beruf? Und überhaupt...
Was überhaupt?
In solche Schriftstücke muss man mehr hineinlegen. Man muss alles herausholen.
Was, reinlegen oder rausholen?
Du, sagte er, du, ich habe keine Lust, mich mit einem Ziegenbock zu streiten. Also was!
Er stand auf und ging zum Fenster. Draußen war noch Sonne. Sie fiel ihm ins Gesicht und färbte es rot. Es geht ums Ganze, sagte er. Der wichtigste Lebensabschnitt beginnt. Der Beruf entscheidet, wie es dir einmal geht.
Immer beginnt der wichtigste Abschnitt im Leben. In den der Mensch vorbereitet treten soll, damit er nicht schon an der Schwelle auf die Fresse fliegt. Beim Eintritt in die Schule. Beim Wechsel von der Vierten in die Fünfte. In der Pubertät. Nach der Schule. Wenn er einen Beruf lernt und die Frau kennen. Und so weiter. Er redete von der Wurst, um die es wieder einmal ging. Ich hörte nur mit halbem Ohr zu.
Du musst den Lehrplatz bekommen, sagte er. Unbedingt. Die müssen, wenn sie deine Papiere in die Hand kriegen, sagen: Hier ist einer, der weiß, was er will, hier kämpft einer. Wenn du nur schreibst: weil er mir gefällt. Das kann jeder sagen: weil er mir gefällt. Weißt du, was ich zu einer solchen Begründung sagen würde? Denkste! würde ich sagen. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben... Und so weiter. Wenn bei mir ein solcher Fall auf den Tisch kommt: Erledigt! Abgeheftet. Der nächste bitte.