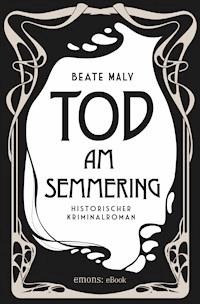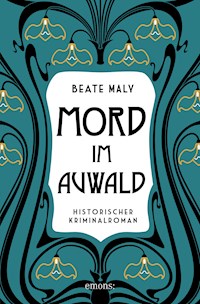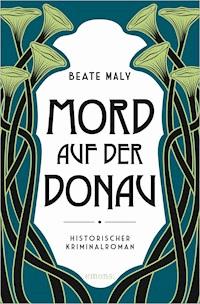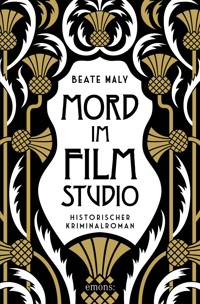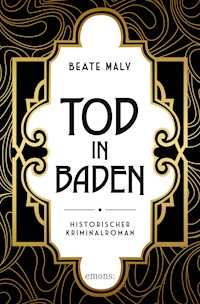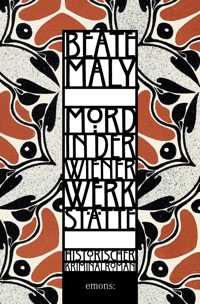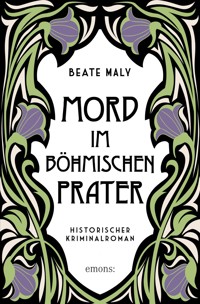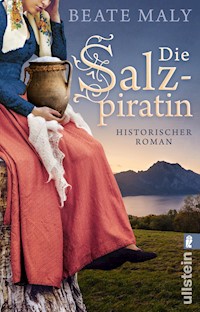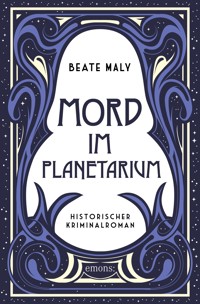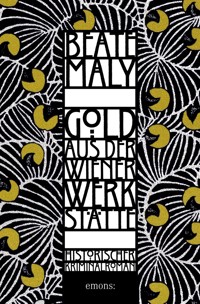12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Aurelia von Kolowitz
- Sprache: Deutsch
Januar 1872, Ballsaison in Wien: keine gute Zeit für junge Gräfinnen, die sich nicht verheiraten lassen wollen. Der Rest der Stadt ist im Glücksrausch, Lose sind die Vergnügung der Stunde. Freiherr von Sothen hat mit dem Verkauf von Lotterielosen sein Geschäft gemacht und viele Leute arm. In Glanz und Gloria lebt er in einem Schlösschen am Cobenzl – bis er erschossen wird. Pech für den gierigen Freiherrn, Glück für Oberinspektor Janek Pokorny, denn wenn ein Mord in bester Gesellschaft geschieht, ist die junge Gräfin Aurelia von Kolowitz nicht weit. Doch die adelige Hobbykriminalistin hat andere Sorgen: Ihr Verleger will ihre Karikaturen nicht mehr drucken, ihr Vater will sie an einen Süßwarenfabrikanten verheiraten, und Janek, der sie nach ihrem letzten Fall ins Theater einladen wollte, hat sich nie wieder gemeldet. Wie immer machen die Männer um Aurelia herum also nichts als Ärger. Doch dann tritt die Witwe des Freiherrn auf den Plan – und die stellt was Habgier und Niedertracht betrifft noch so manchen Mann in den Schatten. Die Aurelia von Kolowitz Reihe: Band 1: Aurelia und die letzte Fahrt Band 2: Aurelia und die Melodie des Todes Band 3: Aurelia und die Jagd nach dem Glück Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden .
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Winter 1872, Ballsaison in Wien: keine gute Zeit für junge Gräfinnen, die sich nicht verheiraten lassen wollen. Der Rest der Stadt ist im Glücksrausch, Lotterielose sind die Vergnügung der Stunde. Freiherr von Sothen hat mit ihrem Verkauf ein Vermögen gemacht – und viele Leute arm. In Glanz und Gloria lebt er in einem Schlösschen am Cobenzl, bis er erschossen wird. Pech für den gierigen Freiherrn, Glück für Oberinspektor Janek Pokorny, denn wenn ein Mord in bester Gesellschaft geschieht, ist die junge Gräfin Aurelia von Kolowitz nicht weit. Doch die adelige Hobbykriminalistin hat andere Sorgen: Ihr Verleger möchte ihre Karikaturen nicht mehr drucken, ihr Vater will sie an einen Süßwarenfabrikanten verheiraten und Janek, der versprach, Aurelia ins Theater einzuladen, hat sich nie wieder bei ihr gemeldet. Wie immer machen die Männer um Aurelia herum also nichts als Ärger. Doch dann tritt die Witwe des Freiherrn auf den Plan – und die stellt was Habgier und Niedertracht betrifft noch so manch einen Mann in den Schatten.
© Dan D. Joseph
Beate Maly, geboren und aufgewachsen in Wien, arbeitete in der Frühförderung, bevor sie vor mehr als zwanzig Jahren mit dem Schreiben begann. Neben Geschichten für Kinder und pädagogischen Fachbüchern hat sie bereits zahlreiche historische Romane und Kriminalromane veröffentlicht. Bei DuMont erschienen zuletzt ›Aurelia und die letzte Fahrt‹ (2022) und ›Aurelia und die Melodie des Todes‹ (2023).
Beate Maly
Aurelia und die Jagd nach dem Glück
Ein historischer Wien-Krimi
Von Beate Maly sind bei DuMont außerdem erschienen:
Aurelia und die letzte Fahrt
Aurelia und die Melodie des Todes
E-Book 2025
© 2025 DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1133-6
www.dumont-buchverlag.de
Hier in dieser Gruft
Liegt ein großer Schuft.
Zeigts keinen Zwanzger runter
Sonst wird er wieder munter.
Prolog
Cobenzl Anfang Jänner 1872
Seit dem späten Nachmittag hockte Fanny auf einem wackeligen Stockerl in der eiskalten Abstellkammer und knackte Walnüsse mit einem stumpfen Messer. Ihre Muskeln schmerzten, ihr Rücken war in einer unnatürlichen gekrümmten Haltung erstarrt. Die Nusskerne warf sie in eine hölzerne Schüssel, die Schalen in einen Korb. Morgen würde die Hausherrin kontrollieren, ob auch reichlich Kerne in der Schüssel waren und Fanny nicht zu viele genascht hatte. Bloß zwei hatte sie sich bisher in den Mund gesteckt und rasch gekaut, aus Angst, jemand könnte sie erwischen.
Fannys Arbeitstag hatte bereits vor vierzehn Stunden begonnen. Sie war so müde, dass ihr die Augen immer wieder zufielen und sie Gefahr lief, einfach vom Holzschemel zu fallen. Gleich nach dem Aufstehen hatte sie die Pfannen vom Vortag so sauber geschrubbt, dass ihre Finger wund gewesen waren, dann hatte sie Erdäpfel fürs Mittagessen geschält, Obers steif geschlagen und anschließend das Geschirr der Herrschaft gespült. Hauchdünnes Porzellan aus der kaiserlichen Manufaktur. Jedes Häferl entsprach ihrem gesamten Monatslohn. In diesem Jänner würde dieser besonders mager ausfallen. Vorgestern hatte Fanny versehentlich ein Lackerl Milch verschüttet. Sofort war die Herrin zeternd über sie hergefallen und hatte angeordnet, ein paar Kreuzer von Fannys ohnehin mickrigem Gehalt abzuziehen. Das Malheur war ihr ausgerechnet im Salon passiert, unter den gestrengen Augen der Freifrau Franziska von Sothen.
Dabei hatte Fanny mit der Lohnminderung noch Glück gehabt. Letzte Woche hatte die Freiherrin das junge Dienstmädchen Grete aus dem Haus gejagt, weil diese heimlich einen der süßen Faschingskrapfen genascht hatte. Die Regeln im Hause Sothen waren streng. Die Freiherrin hatte Grete keinen Lohn ausbezahlt. Dabei hatte das arme Ding härter geschuftet als alle anderen. Jetzt musste Fanny auch Gretes Arbeiten miterledigen. Heute hatte sie zusätzlich Zwiebeln geschält, Karotten geputzt und weitere Töpfe sauber gekratzt.
Jeden Tag fragte sich Fanny, was mit all dem Essen geschah, das am Herd in der Küche gekocht wurde. Die Dienerschaft bekam nichts davon ab, so viel war klar. War es möglich, dass Herr und Frau Sothen alles allein aßen? Die beiden waren nicht gerade schlank. Aber selbst ein korpulenter Mensch konnte nicht mehr als fünf riesige Portionen am Tag essen. Der Freiherr und seine Gattin hatten keine Kinder. Sie residierten allein auf dem weitläufigen Anwesen am Cobenzl. Eine ganze Schar Bediensteter versorgte das Gut, bewirtschaftete den Wald, die Weingärten, die Obstplantagen und Felder. Fanny war nur eine von vielen. Es war kein Trost, dass die gesamte Dienerschaft gleichermaßen schlecht behandelt wurde. Der Gärtner und der Stallknecht, die Köchin und die beiden anderen Dienstmägde. Der Förster und die Wald- und Erntearbeiter. Sie alle wurden vom Ehepaar Sothen geschunden. Als Fanny die Zusage für die Stelle als Dienstmädchen erhielt, hatte sie sich glücklich gewähnt. Die Sothens waren reich, und es hieß, dass sie der Kirche beeindruckende Geldbeträge spendeten. Von dieser Großmut hatte Fanny noch nichts mitbekommen.
Im vergangenen Herbst hatte sie vom Fluss aus beobachtet, wie Frau von Sothen, auf ihrem Pferd sitzend, mit einer Peitsche auf den Rücken eines kleinen Jungen eingeschlagen hatte. Die Freiherrin war völlig von Sinnen gewesen, hatte in einem wahren Rausch so lange auf den kleinen Apfelpflücker eingedroschen, bis sich das löchrige Hemd rot verfärbt und der Junge wie leblos am Boden gelegen hatte. Erst als sich ein älterer Erntearbeiter dazwischengeworfen hatte, hatte sie innegehalten. Die Erwachsenen hatten dem Jungen wieder aufhelfen müssen, und der Kleine war mit von Tränen verklebtem Gesicht und mit geschundenem Rücken erneut auf die Leiter geklettert.
Fanny weinte schon lange nicht mehr. Sie hatte vor Jahren damit aufgehört. Genau genommen vor drei Jahren. Damals war Herr von Sothen zum ersten Mal zu ihr gekommen, als sie hinter dem Schuppen einen Kübel sauber gewaschen hatte. Ohne Vorwarnung hatte er sie brutal von hinten genommen. Einer seiner Freunde hatte lachend zugesehen und ebenfalls seinen Spaß bei der Sache gehabt. Nie wieder hatte Fanny sich so schmutzig und erniedrigt gefühlt wie in diesen paar Minuten. Hinterher hatten die beiden so getan, als wäre nichts passiert. Fanny hatte sich stundenlang im eiskalten Fluss gewaschen, so lange, bis ihre Haut rot und wund gewesen war. Den Geruch ihres Peinigers war sie dennoch nicht losgeworden.
Fünf Monate später hatte sie allein und heimlich ein viel zu kleines Kind im Ziegenstall zur Welt gebracht. Damals war etwas in ihr zerbrochen. Das Kind hatte nicht geschrien, es war grau und leblos gewesen. Aber sonst wunderschön. Mit zwei zerbrechlichen Ärmchen und Beinchen und einem winzig kleinen Köpfchen. Fanny hatte mit ihrem Finger darübergestrichen. Der helle Flaum war ganz weich gewesen. Sie hatte das kleine Kind in ihr bestes Tuch gewickelt und unter einem der Apfelbäume hinter der Kapelle mit ihren bloßen Händen begraben. Das Kind sollte es nicht weit zum Himmelvater haben. Unschuldige Kinder wurden zu Engeln. Das hatte die Köchin einmal gesagt. Bestimmt hatte die alte Else recht. Sie war schon so lange auf dieser Welt, sie kannte sich aus.
Danach hatte Fanny weitergearbeitet wie immer. Aber geweint hatte sie seither nicht. Auch nicht jetzt, da sich eine besonders spitze Nussschale in ihren Zeigefinger bohrte. Fanny steckte den Finger in den Mund und saugte den Blutstropfen weg. Er schmeckte bitter und herb. Müde spähte sie in den Sack, der vor ihr auf dem Boden stand. Sie hatte erst die Hälfte der Nüsse geknackt. Else hatte versprochen, ihr zu helfen, sobald sie mit dem Kneten des Blätterteigs fertig war, aber offenbar hatte sie Fanny vergessen. Fanny lauschte. In der Küche nebenan war es still geworden. Waren die anderen am Ende schon schlafen gegangen? Fanny hob den Kopf zum winzigen Fenster über ihr. Draußen war es seit Stunden finster, was kein Wunder war, denn Anfang Jänner waren die Tage kurz. Ein sichelförmiger Mond kämpfte sich durch eine dicke Wolkendecke. Es roch nach Schnee. Bestimmt würde es heute Nacht schneien. Fanny hatte einen Riecher dafür. Neben ihr auf dem festgestampften Lehmboden sorgte eine rußende Laterne für Licht. Der schmale Mond zauberte einen feinen Silberschimmer in die trostlose Kammer.
Vor Weihnachten hatte es schon einmal Schnee gegeben. Aber zum Jahreswechsel hatte Tauwetter eingesetzt. Zuerst war der Schnee durch die Ritzen in ihre Kammer unter dem Dach gedrungen, dann Schmelzwasser. Fanny hatte vor Kälte nicht schlafen können. Erst als Lene, eine der Küchenmägde, sich zu ihr ins Bett gelegt hatte und die beiden sich gegenseitig gewärmt hatten, war es ein bisschen erträglicher geworden. Lene war am Neujahrstag an der Schwindsucht verstorben. Nicht einmal eine Totenmesse hatte sie bekommen. Wie einen wertlosen Kadaver hatte man sie neben der Kapelle hinter dem Gutshof verscharrt. Weder ein Grabstein noch ein Kreuz erinnerte an sie. Es war, als hätte es sie nie gegeben.
Fanny griff nach der nächsten Nuss. Mit dem Messer fuhr sie in den Spalt zwischen den beiden Schalenhälften und knackte sie geschickt auf. Sie holte die beiden Kerne heraus, einer zerbröselte zwischen ihren Fingern. Fanny steckte sich rasch die kleinen Teile in den Mund. Ihr Magen knurrte, und sie war müde. Die winzigen Brösel würden niemandem auffallen, auch der Freiherrin nicht. Die Schalen warf sie in den Korb. Gerade als sie die nächste Nuss nehmen wollte, vernahm sie Schritte auf dem gekiesten Weg zum Haus. Es war also doch noch jemand unterwegs. Ein Gast etwa? Das war ungewöhnlich, denn Herr und Frau von Sothen empfingen selten Gäste, und wenn doch, dann nicht zu so später Stunde.
Fanny schob das stumpfe Messer in den dünnen Spalt der nächsten Nuss und drehte das Messer vorsichtig. Es war die schnellste und schonendste Art, Nüsse zu knacken. Else hatte sie ihr beigebracht. Weitere Schritte, jetzt deutlich lauter und schwerer als zuvor. Ein Bein wurde nachgezogen. Hätte Fanny es nicht besser gewusst, hätte sie geschworen, dass Herr von Sothen an ihrem Fenster vorbeiging. Aber vielleicht war er es ja doch. In letzter Zeit vertrat er sich nach dem Abendessen des Öfteren noch einmal die Füße. Seither kam er nicht mehr so häufig zu Fanny. Was auch immer er abends trieb, Fanny war erleichtert darüber.
Müde richtete sie sich auf, fasste sich mit beiden Händen ins Kreuz und streckte sich. Ihre verspannten Muskeln schmerzten, die Wirbel knackten. Es war ungesund, stundenlang in derart gekrümmter Haltung im ungeheizten Raum zu hocken. Aber was von der Schinderei, der sie Tag für Tag ausgesetzt war, war schon gut für den Körper?
Leise Stimmen drangen zu ihr in die kleine Kammer. Fanny konnte die Worte nicht genau verstehen, doch es handelte sich offensichtlich um eine aufgeregte Unterhaltung. Eine Beleidigung fiel: »Gieriges Schwein!«
Sollte Fanny auf das Stockerl steigen und einen Blick hinaus wagen? Wer war zu so später Stunde im Hof und schimpfte wie ein Rohrspatz? Eine der Stimmen war ihr vertraut, sie hatte sie schon oft gehört. Eine kleine Unterbrechung würde ihr guttun und ihren Rücken entlasten. Also schob Fanny den Nusssack zur Seite und stand auf. Ihr rechter Fuß kribbelte. Sie hatte nicht bemerkt, dass er eingeschlafen war. Als sie auf den Hocker klettern wollte, zerriss ein ohrenbetäubender Schuss die nächtliche Stille. Fanny zuckte zusammen und erstarrte dann. Der Lärm hallte in ihren Ohren nach. Was zum Kuckuck war das gewesen? Als das Surren nachließ, vernahm sie schnelle Schritte, die sich hastig über den Kiesweg vom Haus entfernten. Umständlich bestieg sie den Hocker und hielt sich an der kaltfeuchten Wand fest. Sie musste aufpassen, ihr Fuß war immer noch taub. Vorsichtig spähte sie in den Hof. Nicht unweit von ihrem Fenster lag eine leblose Gestalt. Erschrocken schrie Fanny auf. Sie blickte zum Ende des Weges. Er war leer. Ihre Augen suchten den Hof und das gesamte Grundstück ab. Sie konnte nichts entdecken. Erst als ihre Aufmerksamkeit zum Wald wanderte, bemerkte sie dort eine dunkle Gestalt. Sie drehte sich zum Haus um, doch gerade in dem Moment schob sich eine der vielen Wolken, die erneut Schnee ankündigten, vor die schmale, kaum sichtbare Mondsichel. Blitzschnell verschwand die Gestalt zwischen zwei hohen Büschen. Es geschah so schnell, dass sich Fanny im Nachhinein nicht sicher war, ob sie den Menschen tatsächlich gesehen oder ihre Fantasie ihr bloß einen Streich gespielt hatte.
Ihr Herz raste, sie schnappte nach Luft. Fanny ahnte, wer auf dem Kiesweg lag. Sie hatte seine Stimme erkannt. Bestimmt war er schwer verletzt oder tot. Fanny musste nachsehen. Sie sprang vom Hocker und humpelte los.
Aurelia
Bäckerstraße
Dicke weiße Schneeflocken segelten seit Stunden vom Himmel. Nass und schwer legten sie sich auf die roten Dächer und grauen Gehsteige und verliehen der Stadt ein winterlich friedliches Bild. Aurelia war froh, dass sie in der gemütlichen Stube nichts von der eisigen Kälte mitbekam. Der Kachelofen im Speisezimmer glühte und sorgte für eine wohlige Wärme.
Vor Entzückung über den Schneefall, der Aurelia an ausgelassene Kindheitstage erinnerte, hatte sie vergessen, ihre Melange zu trinken. Die hellbraune Milchkaffeemischung war in der weißen Tasse mit dem feinen Goldrand und den kleinen von Hand gemalten rosa Blümchen längst kalt geworden. Aurelia langte dennoch danach, nahm einen winzigen Schluck und zog die Nase kraus. Sie stellte die Tasse zurück auf den Unterteller. Doch der Schnee war nicht der einzige Grund ihres Schweigens.
»Ich frage mich schon den ganzen Morgen, wo du mit deinen Gedanken bist.« Graf Otto von Kolowitz senkte die Zeitung, hinter der er sich die letzten zwanzig Minuten hartnäckig versteckt hatte, faltete das Papier zusammen und legte es neben seinen Frühstücksteller. Fragend richtete er seinen Blick auf seine Tochter. Trotz seines fortgeschrittenen Alters war er ein sehr attraktiver Mann. Groß, schlank, mit grauem Haar und Vollbart. »Du hast weder gegessen noch getrunken.«
»Du kannst unmöglich über mich nachgedacht haben«, entgegnete Aurelia. Sie war Otto von Kolowitz’ einzige Tochter. Ihr Aussehen hatte sie jedoch von ihrer verstorbenen Mutter. Aurelia war klein, schlank, hatte rotes Haar, dunkelgrüne Augen und jede Menge Sommersprossen. Sie war der Augapfel ihres Vaters, was mitunter sehr anstrengend war.
»Ich habe genau gesehen, dass deine Aufmerksamkeit einzig der Wiener Tagespresse galt. Was gibt es denn Neues in der Stadt? Hat man die Ballsaison eröffnet?«, fragte sie.
»Ich kann sehr wohl die Nachrichten lesen und mir dabei Gedanken um meine Tochter machen. Die Ballsaison ist längst eröffnet. Wir haben erst letzte Woche darüber gesprochen. Du bist unaufmerksam.«
»Tatsächlich?« Aurelia runzelte die Stirn. Die Unterhaltung war ihr entfallen, was seltsam war, denn für gewöhnlich hatte sie ein ausgesprochen gutes Gedächtnis. Ihr Vater hatte recht, momentan galten ihre Gedanken nicht ihm, sondern Ferdinand Lorenz, dem Chefredakteur der Satirezeitschrift Figaro, und dem unerfreulichen Gespräch, das sie beide gestern geführt hatten. Sie nahm einen weiteren Schluck kalten Kaffee und bereute es sofort.
»Du hast noch nichts gegessen«, wiederholte ihr Vater. »Schmecken dir die Semmeln nicht? Ich wusste doch gleich, dass es nicht klug war, den Bäcker zu wechseln. Ich war immer sehr zufrieden mit Bäcker Pospischill. Aber Marie holt seit Neuestem ja immer die Semmeln vom Feigl. Dabei sind die nicht resch genug, und die Kipferl schauen verwortakelt aus.«
Zum Beweis hob Otto von Kolowitz eines der mürben Kipferl hoch. Statt ihm zuzustimmen, griff Aurelia danach, riss das knusprige Ende ab, steckte es in den Mund und meinte kauend: »Also ich finde, es schmeckt köstlich. Du kannst dich auf Maries Geschmack verlassen. Das Mädchen weiß, was gut ist. Außerdem hat Feigl die besten Faschingskrapfen der Stadt.«
»Du weißt, dass ich es nicht ertrage, wenn du mit vollem Mund sprichst. Das ist undamenhaft«, brummte Otto von Kolowitz. »Marie ist vom guten Geschmack so weit entfernt wie ein einfaches Wäschermadl vom Opernball. Sie ist bloß gefräßig und faul.« Es war kein Geheimnis, dass er an Marie immer etwas zu beanstanden hatte. Das Dienstmädchen war vorlaut und hin und wieder gar frech. Aber sie hatte das Herz am rechten Fleck, war schlau, konnte lesen, schreiben und rechnen und war absolut loyal. Genau wie Sebastian, Otto von Kolowitz’ persönlicher Diener, der jetzt in den Wintergarten trat, um nach dem Rechten zu sehen.
»Benötigen die Herrschaften meine Hilfe?« Sebastians lang gezogenes Gesicht war emotionslos wie immer. Sein schütteres Haar war sorgsam über die kahle Stelle auf seinem Kopf gekämmt.
»Nein, Sie können gehen, Sebastian«, sagte Otto von Kolowitz. So streng er mit Marie ins Gericht ging, so großzügig zeigte er sich Sebastian gegenüber. Der hagere Diener, der die Aufsicht über das Personal hatte, verbeugte sich und verließ wort- und geräuschlos den Raum. Aurelia fragte sich stets, wie er das bewerkstelligte. So völlig lautlos zu verschwinden.
»Wohin geht Sebastian eigentlich jeden Tag nach seinem Dienst?«, fragte Aurelia neugierig. Auch sie mochte den Diener, dessen Priorität stets das Wohlbefinden seines Vorgesetzten war. Zu gerne hätte sie gewusst, was der Diener trieb, wenn er regelmäßig für mehrere Stunden das Haus verließ. Sie kannte niemanden, der so gut über alle Neuigkeiten in der Stadt informiert war wie Sebastian. Noch bevor ein Skandal in den Zeitungen zu lesen war, wusste er darüber Bescheid. Und wenn die Presse über eine große Betrugsaffäre berichtete, hatte Sebastian verlässlich alle Details dazu bereit. Ebenso kannte er den Namen der jungen Dienstmagd, die tot aufgefunden wurde, da sie, unfreiwillig von ihrem Dienstherrn geschwängert, aus großer Not aus dem Fenster gesprungen war. Prozesse und Verurteilungen wegen unsittlicher Schriften, aufrührerischer Ideen oder untersagter Vereinigungen – Sebastian konnte zu allem etwas erzählen. Manchmal fragte sich Aurelia, ob der Diener auch von ihrem verbotenen Tun wusste.
»Papa, ich habe dir eine Frage gestellt.«
Otto von Kolowitz brummte etwas Unverständliches, und Aurelia gab auf. Sie würde wieder nicht erfahren, was Sebastian trieb. Vielleicht hatte es aber auch seine Vorteile, dass sie nicht die Einzige im Hause Kolowitz war, die ein Geheimnis hütete.
Seit Jahren zeichnete Aurelia heimlich Karikaturen für die Satirezeitschrift Figaro. Sie veröffentlichte die Zeichnungen unter dem Pseudonym Fritz Lustig. Würde jemals herauskommen, dass sich eine junge, adelige Frau hinter diesem Namen verbarg, gäbe das einen waschechten Skandal, der den Verleger hinter Gitter bringen und Aurelias Namen und ihren guten Ruf für immer ruinieren würde. Leider war Aurelia mit ihrer letzten Karikatur übers Ziel hinausgeschossen und hatte eine Menge Kritik einstecken müssen. Grund des Anstoßes war das Thema Zensur gewesen. Aurelia hatte eine Zeitung gezeichnet, deren Inneres herausgeschnitten war. Bloß der Rahmen mit dem Titel war noch übrig. Der Zeitungsjunge reichte den Papierrahmen einem feinen Herrn mit den Worten: »Den Rest hat der Kaiser zurückbehalten.«
Aurelia hatte die Idee lustig gefunden. Die kaiserliche Zensurstelle war jedoch anderer Meinung gewesen. Sie hatte die Zeichnung entschärfen und den Kaiser – welch Ironie – entfernen lassen. Leider hatte Lorenz schon einen Teil der Auflage ausgeliefert. Über die Kosten, die entstanden waren, um sie zurückzuholen, war er nicht sonderlich erfreut gewesen. »Wenn uns so etwas öfter passiert, müssen wir zusperren«, hatte er grimmig gesagt.
»Soll ich das Frühstück abräumen?« Marie hatte den Raum betreten. Wie immer saß ihre weiße Haube ein wenig schief auf ihrem Haar, und ihre Schürze zeigte verräterische Marmeladespuren. Vielleicht war einer der köstlichen Faschingskrapfen in ihren Mund gewandert. Der weiße Staubzuckerrand an ihrer Oberlippe war ein weiteres Indiz.
»Marie, die Semmeln vom Bäcker Feigl sind eine Zumutung«, schimpfte Otto von Kolowitz. Aurelia wurde den Verdacht nicht los, dass ihr Vater nur zu gerne das Thema wechselte. Hatte er Angst, sie könnte ihre Frage über Sebastian wiederholen? Es war nicht das erste Mal, dass er ihr auswich, wenn es um den Diener ging.
Marie knickste. Die Bewegung sah ungelenk aus. Das Mädchen war am Land aufgewachsen. Manch eine Dienstbotenetikette wirkte bei ihr immer noch wenig elegant.
»Die Semmeln vom Pospischill sind kleiner und teurer«, verteidigte sie sich. »Außerdem sind sie bis zum Nachmittag steinhart und können nur noch an die Tauben verfüttert werden. Die Köchin will, dass ich die Semmeln vom Bäcker Feigl hol.«
»Du kannst abräumen«, sagte Aurelia schmunzelnd. »Wir sind mit dem Frühstück fertig.« Andere Dienstmädchen hätten schweigend geknickst und wären mit gesenktem Kopf gegangen. Aurelia fand Maries Ehrlichkeit erfrischend.
Unter dem finsteren Blick von Otto von Kolowitz machte Marie sich daran, das Geschirr auf einen Servierwagen zu stapeln. Den Brotkorb ließ sie noch stehen. Laut scheppernd rollte sie mit dem Wagen aus dem Wintergarten.
Otto von Kolowitz sah ihr grantig hinterher. »Wohin soll das alles noch führen? Die Dienstmagd widerspricht mir in meinem eigenen Haushalt. Ich kann nicht mehr entscheiden, von welchem Bäcker ich meine Semmeln bekomme, und Marie wird eines Tages unser gesamtes Porzellan ruiniert haben. Vom weißen Service fehlen bereits zwei Teller.«
»Ach, Papa!« Aurelia lachte. »Du übertreibst maßlos.«
Bevor er weiterjammern konnte, erkundigte sie sich noch einmal über die Neuigkeiten aus der Presse. »Was hast du eben gelesen?«
»Nichts von Interesse«, brummte Otto von Kolowitz. »Verbrechen, Mord und Totschlag. Am Cobenzl hat man den Freiherrn von Sothen erschossen aufgefunden.«
»O mein Gott«, entfuhr es Aurelia. »Ein Jagdunfall?«
»Man weiß es noch nicht«, sagte Otto von Kolowitz. »Die Stadt ist ein Molloch. Wir steuern auf unseren eigenen Untergang zu. Wobei es mit diesem von Sothen zur Abwechslung einmal einen erwischt hat, um den es nicht schade ist.«
»Papa!«
»Was denn? Der Mann hat sich mit dem Verkauf von Glückslosen ein Vermögen ergaunert. Wenn du mich fragst, sollte der Verkauf solcher Lose längst verboten sein.«
Aurelia musterte ihren Vater eingehend. Was war heute nur los mit ihm? Auch ihr war zu Ohren gekommen, dass der Freiherr von Sothen skrupellos gewesen sein soll. Ihm deshalb den Tod zu wünschen, war dennoch verwerflich und passte so gar nicht zu Otto von Kolowitz.
»Bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden?«, fragte sie besorgt. »Schau aus dem Fenster. Es schneit.« Aurelia beugte den Kopf, um über das Vordach zu spähen. Der Schneefall hatte nachgelassen, und im Westen zeigten sich erste hellblaue Stellen am Himmel.
»Wenn die Wolkendecke aufreißt, liegt ein wunderschöner Wintertag vor uns«, meinte Aurelia.
Ihr Vater brummte nur.
»Hat deine schlechte Laune etwas mit Dorothea Ziegler zu tun?«, fragte Aurelia. Seit letztem Frühling traf Otto von Kolowitz die reiche Witwe und Modehausbesitzerin. Ihr war gelungen, woran zuvor zahlreiche heiratswillige Damen in Wien gescheitert waren. Sie hatte das Interesse des reichen, verwitweten Grafen auf sich ziehen können. Seither überredete sie Aurelias Vater, der jahrelang seine Abende allein zu Hause verbracht hatte, zu gesellschaftlichen Veranstaltungen, die ihm eigentlich zuwider waren. Vielleicht hatte die Ballsaison etwas mit Otto von Kolowitz’ düsteren Gedanken zu tun. Er war ein lausiger Tänzer.
»Ich habe Frau Ziegler versprochen, sie zum Wiener Eislaufverein zu begleiten. Sie ist eines der Gründungsmitglieder.«
Vor Überraschung weiteten sich Aurelias Augen. Das war tatsächlich eine Neuigkeit, mit der sie nicht gerechnet hatte. »Kannst du denn eislaufen?«
»In meiner Jugend habe ich mich darin versucht.«
»Das hast du mir nie erzählt.«
»Es gab keine Veranlassung dazu.«
»Hat es dir denn Spaß gemacht?«, wollte Aurelia wissen. Vergangenen Winter hatte sie ebenfalls überlegt, Mitglied im Verein zu werden. Nach langwierigen Verhandlungen hatten die Gründungsmitglieder, wohlhabende Männer und Frauen aus der Aristokratie und dem Großbürgertum, vor vier Jahren einen Pachtvertrag von der Stadt Wien erhalten. Seither stand die Fläche des trockengelegten Hafens den Schlittschuhlaufenden zur Verfügung. Als der Winter vorbei war, hatte Aurelia enttäuscht festgestellt, dass sie aus irgendeinem Grund doch nicht zum Eislaufen gekommen war.
»Ich kann mich nicht erinnern, ob ich es mochte«, sagte Otto von Kolowitz. Es war offensichtlich, dass er log.
»Soll ich dich und Frau Ziegler begleiten?«, bot Aurelia an. »Ich kann mit ihr ein paar Runden auf dem Eis drehen, während du eine Tasse Tee oder Kakao im Vereinshaus trinkst. Ich habe mir sagen lassen, dass die Gastronomie hervorragend sein soll. Angeblich serviert man auch köstlichen Punsch.«
»Das würdest du tun?«, fragte Otto von Kolowitz.
»Sehr gerne.«
Augenblicklich hob sich Otto von Kolowitz’ Laune. Er langte nach dem Brotkorb, holte eine Semmel heraus und brach sie in zwei Teile. Die goldbraune Kruste bröselte auf das weiße Tischtuch.
»Vielleicht sind die Semmeln doch rescher, als ich dachte«, meinte er versöhnlich.
Aurelia lehnte sich über den Tisch und nahm ihrem Vater einen Teil der Semmel ab. Sie riss ein Stück davon ab.
»Definitiv!«, sagte sie mit vollem Mund und erntete einen missbilligenden Blick, aber keine rügenden Worte, dazu war Otto von Kolowitz mit einem Mal zu gut gelaunt.
Janek
Polizeidirektion Petersplatz
Seit einer Woche hing ein neues Schild neben der Tür zu Janeks winzigem Büro. »Oberinspektor Pokorny« stand in schwarzen Lettern darauf. Er hatte kein größeres Zimmer erhalten, die Polizeidirektion am Petersplatz platzte jetzt schon aus allen Nähten. Was viel wichtiger war als das Schild oder der Raum: Janek bekam nun jede Woche vier Gulden mehr ausbezahlt, was über den ganzen Monat sechzehn zusätzliche Gulden bedeutete und ihm deutlich mehr finanziellen Spielraum gab.
Janek könnte sich nun Theaterkarten der günstigsten Kategorie leisten. Das aktuelle Programmheft vom Carltheater lag vor ihm auf dem Schreibtisch. Lumpazivagabundus wurde angekündigt, ein Stück von Johann Nestroy. Janek könnte zwei Karten erstehen und eine ganz bestimmte Person mitnehmen, wenn da nicht die Angst wäre, sich damit lächerlich zu machen. Auch als Oberinspektor stand er in der gesellschaftlichen Hierarchie viel zu weit unten, als dass er eine Grafentochter hätte einladen können.
Es klopfte. Zeitgleich wurde die Tür geöffnet. Der Polizeidiener Johannes Hofer würde auch in hundert Jahren nicht lernen, so lange vor der Tür zu warten, bis Janek »Herein!« rief.
»Sie sollen ganz schnell zum Chef!«, sagte Hofer. Er hatte sich seit zwei Wochen nicht rasiert. Wohl in der Hoffnung, dass sein jungenhaftes Gesicht dadurch männlicher wirkte. Aber der Schuss ging nach hinten los. Ein paar mickrige Härchen standen verloren von seinem Kinn und seiner Oberlippe ab und verliehen ihm das Aussehen eines räudigen Straßenköters.
»Bitte, tun Sie uns allen einen Gefallen«, bat Janek. »Verwenden Sie ein Rasiermesser.«
Betroffen fasste sich Hofer ans Kinn. »Meinen Sie wirklich?« Er drehte sich zur Wand, wo über einem gerade mal tellergroßen Handwaschbecken ein Spiegel hing. Er musterte seine Wangen und wirkte dabei wie ein Kind, dem man den Nachtisch weggenommen hatte.
»Vergessen Sie es«, sagte Janek. Im Grunde war es ihm egal, wie der Mann aussah, Hauptsache, er verrichtete seine Arbeit ordentlich. Was in letzter Zeit immer häufiger der Fall war. Hofer mauserte sich zu einem fähigen Polizisten.
Janek stand auf und ging an Hofer vorbei. Über die enge Treppe stieg er hoch in den dritten Stock, der eigentlich der erste war. Parterre, Hochparterre und Mezzanin lagen dazwischen und verliehen der dritten Etage somit den vornehmen Einser.
Janek klopfte an die Tür des Polizeidirektors Andreas Körner. Anders als Hofer wartete er darauf, eingelassen zu werden.
Sein Vorgesetzter saß hinter seinem massiven Schreibtisch. Körners schütteres Haar war in den letzten Monaten weiß geworden. Wie immer standen eine Tasse Melange und ein Teller mit einem Nusskipferl vom k. u. k. Hofkonditor Demel vor ihm.
»Kommen Sie rein, und schließen Sie die Tür hinter sich!« Körner winkte Janek herein.
»Setzen Sie sich.«
Janek nahm seinem Vorgesetzten gegenüber Platz. An der Wand des geräumigen Büros hingen drei gerahmte Porträts. Sie zeigten Körners Ehefrau und seine beiden geliebten Töchter: Eunike und Sybille. Die zwei jungen Damen sahen ihrer Mutter ähnlich, was sehr zu ihrem Vorteil war. Andreas Körner neigte zum Übergewicht, was sicherlich auch mit seiner Vorliebe für Süßes zu tun hatte. Seine Hängebacken wurden von einem Backenbart im Stil des Kaisers kaschiert. Bei seinem mächtigen Bauch half aber kein Bart.
»Es gibt einen Toten. Johann Carl Freiherr von Sothen wurde vor seinem Anwesen am Cobenzl erschossen.«
»Gibt es Hinweise auf den Täter?«
»Die Witwe beschuldigt einen jungen Mann, Viktor Hermann, ein Leutnant der Kavallerie.«
»Dann geht uns der Fall nichts an«, sagte Janek. »Das Militär wird sich um die Angelegenheit kümmern.«
Seitdem man die Geheimagenten nach dem Revolutionsjahr 1848 aus dem Militär ausgegliedert und der Polizei zugeordnet hatte, herrschte ein Konkurrenzkampf zwischen dem Kriegs- und dem Innenministerium. Janek war schon einmal zwischen die Fronten geraten, ein weiteres Mal wollte er tunlichst vermeiden. Die Angelegenheit damals hatte für ihn im Allgemeinen Krankenhaus geendet. Eine Narbe auf seinem Hinterkopf erinnerte ihn bei jeder Haarwäsche an das unerfreuliche Abenteuer.
»Leider gibt es noch keine Beweise. Der junge Mann ist auch noch auf freiem Fuß. Es handelt sich bloß um die Anschuldigung der trauernden Witwe. Beim Militär hat man die Vorwürfe nicht ernst genommen.«
Janek dachte nach.
»Ich habe den Namen von Sothen schon einmal gehört.«
»Selbstverständlich kennen Sie ihn«, sagte Kröner. »Der ganzen Stadt ist der Mann ein Begriff. Er ist Bankier. Seine Bank befindet sich am Graben. Er hat sein Vermögen als Lottokaiser verdient.«
»Er verkauft Glückslose?«, fragte Janek.
»Er wurde damit einer der reichsten Männer der Stadt. Er verkaufte Lottoscheine und nahm Lotteriezahlen entgegen. Außerdem hat er das Promessengeschäft in Wien eingeführt.«
»Was für ein Geschäft?« Janek war der Begriff völlig unbekannt, und das, obwohl er wahrlich über einen großen Wortschatz verfügte. Im Unterschied zu den meisten anderen Polizeiagenten hatte er ein Gymnasium besucht und verfasste orthografisch fehlerfreie Protokolle, worauf er durchaus stolz war.
»Eine Promesse ist die Veräußerung der Gewinnhoffnung eines Loses«, erklärte Körner.
»Wie soll das funktionieren?« Janek verstand immer weniger.
»Angenommen, von Sothen besitzt einen Lottoschein mit einer Gewinnsumme im Wert von 100 000 Gulden. Er verkauft hundert Kunden je einen Schein mit einem Gewinnanteil von einem Prozent für zwei Gulden. Das sind die Promessen. Gekauft werden sie in der Sothenschen Handlung, die mittlerweile ein Großhandelshaus ist und sich neben seiner Bank am Graben befindet. Wenn das Los nicht gewinnt, schuldet der Käufer dem Verkäufer weitere Gulden. Wer sich dabei verschuldet, kann im Hause Sothen erneut Kredit nehmen.« Körner sah Janek eindringlich an. »Wie können Sie diesen Mann nicht kennen?«
»Für mich klingt das nach Betrug«, sagte Janek finster. »Warum hat man ihm nie das Handwerk gelegt? Wie kann man eine Schuldverschreibung auf einen möglichen Gewinn verkaufen? Mir kommt das nicht ganz koscher vor.«
»Das ist alles völlig legal. Der Mann verkauft Hoffnung. Die Menschen lieben Glückslose aller Art. Meine Frau und meine Töchter nehmen auch jede Woche an einer Lotterie teil. Haben Sie noch nie ein Los gekauft oder Glückszahlen getippt?«
»Noch nie«, bestätigte Janek.
»Dann werden Sie wohl zu keinem Reichtum gelangen«, sagte Körner. Er konnte nicht ahnen, wie sehr seine Worte Janek trafen. Er war der Sohn von einfachen Ziegelböhmen, Menschen, die unter prekären Bedingungen im Süden der Stadt arbeiteten. Statt mit Geld wurden sie mit Blechmünzen bezahlt, die sie nur in den Geschäften auf dem Ziegelwerksgelände ausgeben konnten. Die Läden gehörten den Werksbesitzern. Jeder Laib Brot kostete das Dreifache von dem, was man anderswo dafür bezahlte. Janek hatte es geschafft, den Werken und der tristen Armut zu entfliehen. Er hätte noch weitaus mehr aus seinem Leben machen können, wäre da nicht Nepomuk Hofmeister gewesen, der ihm seine Karriere verbaut hatte. Und wäre Janek reich, dann könnte er eine gewisse junge Frau ins Theater einladen, ohne Gefahr zu laufen, sich lächerlich zu machen.
»Hören Sie mir noch zu?« Körner sah Janek vorwurfsvoll an. »Sie sollten sich ein Los gönnen. Wer weiß, vielleicht wartet der große Gewinn auf Sie.«
»Oder ich verliere das bisschen Geld, das ich jetzt mehr verdiene. Nein danke. Ich werde auf keine Promessen hereinfallen. Ein Los, das ›Versprechen‹ heißt, kann nur faul sein.«
Körner schüttelte verständnislos den Kopf.
»Ich nehme an, dass Promesse vom lateinischen Wort promittere stammt – versprechen.«
»O mein Gott. Pokorny. Wie kommen Sie bloß auf solche Gedanken?« Er langte nach seiner Kaffeetasse und nahm einen Schluck. Zufrieden schmatzte er und fuhr sich mit der Zunge über die rosigen Lippen. »Machen Sie sich auf, zum Himmel. Sothens Anwesen liegt hinter dem Gspöttgraben.«
»Am Cobenzl?«, fragte Janek entsetzt.
»Ja, natürlich. Wo denken Sie denn, dass sich der Gspöttgraben befindet?«
Janek wurde übel. Um das Gut des getöteten Bankiers zu erreichen, musste er zuerst mit der Pferdetramway nach Nussdorf, von dort bekam er vielleicht eine Mitfahrgelegenheit auf einem Fuhrwerk bis nach Grinzing, und dann hieß es zu Fuß den steilen Berg hinaufsteigen. Janek war ein zügiger Läufer. Aber in weniger als vierzig Minuten würde er sein Ziel von Grinzing aus nicht erreichen. Die Tage waren kurz. Er würde erst im Dunkeln zurückkehren.
Körner nahm eine Mappe von einem Stapel auf seinem Schreibtisch und schlug sie auf. Mit dem Zeigefinger fuhr er die Listen entlang.
»Sie können für einen Weg einen Fiaker nehmen«, sagte er großzügig. Bevor Janek sich bedanken konnte, fügte er streng hinzu: »Aber nur für einen! Wir haben bei der Polizei schließlich nicht im Lotto gewonnen.«
Aurelia
Naglergasse
»Sie haben außergewöhnlich große Füße für eine junge Dame.« Der Lehrling musterte Aurelia, als wären große Füße ein Makel bei einer Frau.
»Meine Füße sind genau so, wie sie sein sollen«, entgegnete Aurelia verärgert. »Was ich jedoch beanstande, ist Ihr Sortiment an Schlittschuhen. Vielleicht ist es klüger, einen anderen Schuhmacher aufzusuchen.«
Sie beugte sich nach vorne, um ihre Stiefel zu schnüren. Sofort ging der Bursche in die Hocke, um ihr zur Hand zu gehen. Offenbar war ihm eben bewusst geworden, wie unhöflich seine unbedachte Bemerkung gewesen war. Vielleicht war seine plötzliche Höflichkeit aber auch dem finsteren Blick seines Chefs geschuldet, der nun hinter dem Verkaufstresen hervortrat.
»Fräulein von Kolowitz, wir werden genau den Schlittschuh für Sie herstellen, den Sie sich wünschen. Sie können auch die Farbe des Leders bestimmen. Soll Ihr Schlittschuh dunkelblau oder braun, schwarz oder weiß sein? Wir können auch rot gefärbtes Leder verwenden. In spätestens einer Woche sind die Schuhe fertig, das verspreche ich.«
Der Schuster war ein kleiner, zierlicher Mann, dessen Körper fast in Gänze in eine braune Lederschürze gehüllt war.
»Dasselbe gilt natürlich für Sie, Herr Hofmeister.« Er deutete eine Verbeugung vor Nepomuk Hofmeister an, dem Advokaten der Familie von Kolowitz.
Der attraktive Mann strich sich sein blondes Haar hinters Ohr. Seit Neuestem zierte ein stattlicher Vollbart sein Gesicht, was Aurelia schade fand, denn so waren seine markanten Wangenknochen nicht mehr zu sehen. »Ich bin mit schwarzen Schlittschuhen vollauf zufrieden«, meinte Nepomuk amüsiert.
Der Schuster lief rot an und hüstelte verlegen. »Die Frage der Farbe war an Fräulein von Kolowitz gerichtet. Aber selbstverständlich können auch Sie wählen, wenn Sie das wünschen.«
»Auch ich will ein schlichtes Modell in Schwarz«, antwortete Aurelia.
Sichtlich zufrieden mit dem Verlauf des Gesprächs winkte der Schuster seinen Lehrling wieder zu sich. »Der Ferdl wird die Maße Ihrer Füße aufnehmen.« Danach sah er den Burschen eindringlich an. Der Junge presste seine Lippen fest aufeinander. Gewiss würde er keine Bemerkungen über die Größe der Füße mehr von sich geben. Aurelia war Nepomuk Hofmeister dankbar, dass er sich ebenfalls fürs Schlittschuhfahren interessierte. Als sie ihm von ihrem Vorhaben erzählt hatte, war er sofort Feuer und Flamme gewesen und hatte sich bereit erklärt, sie zu begleiten. »Ich wollte schon im Vorjahr Mitglied des exklusiven Vereins werden«, hatte er gesagt.
Ohne weitere Unhöflichkeiten wurden ihre Füße vermessen und die Bestellungen abgegeben. Als Aurelia und Nepomuk wieder am Graben standen, wirkte der Advokat unschlüssig. Nepomuk arbeitete seit Jahren für Otto von Kolowitz. Er hatte die Aufgabe seines Vaters übernommen, der sich vor einiger Zeit zur Ruhe gesetzt hatte. Nepomuk Hofmeister war mit Abstand einer der unterhaltsamsten Männer, die Aurelia kannte. Er war wohlhabend, eloquent, witzig und gut aussehend. Außerdem war er unverheiratet, was ihn zu einem der begehrenswertesten Junggesellen der Stadt machte. Otto von Kolowitz rechnete seit Jahren damit, dass er um Aurelias Hand anhalten würde. Doch Aurelia wusste, dass das niemals geschehen würde. Im Vorjahr hatte Nepomuk ihr gestanden, dass sein Herz für jemand anderen schlug. Für eine Person, die niemals erfahren durfte, was er für sie empfand. Die Ironie des Schicksals sorgte dafür, dass Aurelia zarte Gefühle für dieselbe Person hegte. Die Erwiderung ihrer Zuneigung war ebenso aussichtslos wie die von Nepomuk. In ihrem Fall waren es die gesellschaftlichen Zwänge, die eine Verbindung unmöglich machten. Der Mann, für den sich beide interessierten, war der Oberinspektor Janek Pokorny.
»Wollen Sie mich denn nicht nach Hause begleiten?«, fragte Aurelia irritiert. Es war ihr unmöglich, allein über den Graben Richtung Rotenturmstraße und weiter in die Bäckerstraße zu gehen. Unverheiratete Damen aus besserer Gesellschaft mussten sich stets in Begleitung eines Herren oder einer Anstandsdame befinden. Seit Jahren lag ihr Vater ihr in den Ohren, dass sie sich eine Gesellschafterin suchen sollte. Aurelia weigerte sich hartnäckig. Die Damen, die sich ihr vorgestellt hatten, waren langweilig oder einfältig. Und vor allem fand es Aurelia ungerecht, dass sie keinen Weg allein beschreiten durfte. Sie war eine erwachsene Frau und kein unmündiges Kind.
»Doch, natürlich begleite ich Sie«, sagte Nepomuk. »Zuvor würde ich Sie jedoch gerne ins Kaffeehaus einladen. Es gibt da etwas, das ich mit Ihnen besprechen möchte.«
»Sie brauchen meinen Rat?« Aurelia hob die schmalen Augenbrauen.
»Formulieren wir es anders.« Der Advokat lächelte. »Ich würde mir gerne eine Sorge von der Seele reden.«
»Nur immer zu«, sagte Aurelia. Neugier war eines ihrer Laster. Verschwiegenheit dagegen ihre große Stärke. Aus diesem Grund schüttete Nepomuk ihr immer wieder sein Herz aus. Er war zu ihrem guten Freund geworden.
»Lassen Sie uns zum Demel gehen. Dort kriegen wir die besten Punschkrapferl der Stadt«, schlug er vor.
Aurelia war einverstanden. Für die Punschkrapfen beim Demel fand sich immer ein Platz in ihrem Bauch.
Über den Graben spazierten sie zum Kohlmarkt. Nepomuks modischer Spazierstock schlug leise auf dem Kopfsteinpflaster auf. In einigen der Auslagen der Geschäfte lagen noch Reste der Weihnachtsdekoration. Die meisten Ladenbesitzer hatten jedoch die längst vertrockneten Tannenzweige gegen Faschingsmasken eingetauscht. Die Ballsaison in Wien sorgte für klingende Kassen in den Modesalons und Schneidereien, bei den Hutmachern und Taschenverkäufern der Stadt. Auch exquisite Fächer, maßgeschneiderte Handschuhe und Masken waren gefragt. Es war eine Zeit des närrischen Treibens, in der die Gutsituierten in hell erleuchteten Ballsälen das Tanzbein schwangen, während die weniger Betuchten sich mit den Etablissements am Stadtrand begnügten und zu einfacher Volksmusik in Wirtshäusern tanzten. In beiden Fällen floss reichlich Alkohol, so als müsste man vor Aschermittwoch den gesamten Übermut ausleben, da es danach keine Freude mehr gäbe.
Auch beim Demel waren die Auslagen der Jahreszeit entsprechend geschmückt. Eine riesige Pyramide aus Faschingskrapfen zierte das Schaufenster neben dem Eingang.
Nepomuk öffnete für Aurelia die Tür. Augenblicklich schlug ihnen der Duft von frisch geröstetem Kaffee und köstlichen Mehlspeisen entgegen. In der Glasvitrine neben der Theke aus poliertem Kirschholz fanden sich herrlichstes Backwerk und köstliches Konfekt. Besonders begehrt war der Schichtnougat, der in buntes Papier gewickelt und pyramidenförmig auf einem Porzellanteller gestapelt war. Für gewöhnlich waren die Verpackungen in dezenten Pastellfarben gehalten, doch jetzt im Fasching sprangen den Kunden die Süßigkeiten in knalligen Farbtönen entgegen.
Ein Ober im schwarzen Frack kam ihnen entgegen, während ein Dienstmädchen in schwarzer Uniform, weißer Schürze und Spitzenhäubchen ihnen die Mäntel abnahm. Der Ober verbeugte sich. »Grüß Sie Gott, Herr Hofmeister, gnä Fräulein von Kolowitz, welche Ehre. Sie ham a Glück, ich habe noch ein besonders schönes Tischerl in einer Fensternische.«
»Wunderbar, das nehmen wir. Vielen Dank, Ferdinand.«
Nepomuk war ein Stammgast in fast allen namhaften Kaffeehäusern und Konditoreien der Stadt. Aurelia fragte sich, ob er jemals zu Hause aß. Auch einen Teil seiner Arbeit erledigte er im Kaffeehaus. Sie folgten dem Ober ans andere Ende des Raums und nahmen in einer Fensternische neben einer Grünpflanze Platz. Von hier aus hatten sie Sicht auf den Kohlmarkt.
»Oh, sehen Sie, es fängt erneut zu schneien an«, rief Aurelia entzückt. Tatsächlich hatte sich der Himmel wieder zugezogen. Wie heute Morgen segelten dicke weiße Flocken vom Himmel. Vor ein paar Stunden waren sie noch geschmolzen, sobald sie auf dem Boden gelandet waren, jetzt blieben sie liegen. Es war jedes Mal erstaunlich, wie schnell der Schnee die Geräusche der lärmenden Stadt dämpfen konnte. Ein Fiaker glitt geräuschlos vor der großen Fensterscheibe an ihnen vorbei.
»Ich hätte keinen Schnee mehr gebraucht«, meinte Nepomuk. »Wenn es nach mir ginge, könnte nach Weihnachten der Frühling beginnen.«
»Aber nein, wir wollen doch unsere Schlittschuhe einweihen«, entgegnete Aurelia.
Der Ober fragte nach ihren Wünschen. Aurelia nahm eine Melange und ein Punschkrapferl. Nepomuk entschied sich für einen kleinen Schwarzen und ebenfalls ein Punschkrapferl. Eine Mehlspeise, die zum Fasching gehörte wie der Krapfen.
Sobald der Ober weg war, lehnte sich Aurelia nach vorne. Sie stützte sich mit beiden Ellbogen auf dem Tisch ab und sah Nepomuk neugierig an.
»Also, was liegt Ihnen am Herzen?«
»Lassen Sie uns noch warten, bis wir unsere Bestellung bekommen haben.« Er senkte die Stimme. »Ich will sichergehen, dass uns niemand zuhört. Auch der Kellner nicht.«
»Es muss sich ja um etwas wirklich Dringliches handeln.« Aurelias Neugier wuchs. Selten hatte sie Nepomuk so nervös erlebt. Zitterten seine Hände etwa? Er schwieg hartnäckig und fing erst mit seinen Ausführungen an, als zwei knallrosa Punschkrapferl mit glasierten Kirschen und zwei Tassen Kaffee vor ihnen standen.
»Ich habe ein Problem«, fing er so leise an, dass nur Aurelia ihn hören konnte.
»Das habe ich mir fast gedacht. Was bedrückt Sie?«, fragte sie neugierig und einfühlsam zugleich. Es war ungewohnt, Nepomuk so ernst zu sehen.
Er senkte seine Stimme noch weiter, sodass Aurelia sich weit über den Tisch beugen musste, um ihn zu verstehen.
»Seit geraumer Zeit treffe ich mich mit jemandem.«
»Das ist doch schön«, sagte Aurelia verwirrt. »Das heißt, Sie haben sich neu verliebt. Sollte das nicht ein Grund zur Freude sein?«
Nepomuk neigte den Kopf. »Die Intensität der Gefühle, die ich einer gewissen Person entgegenbringe, wird nie übertroffen werden können. Aber ich gestehe, dass ich mich zu der anderen, der neuen Person, durchaus hingezogen fühle.«
Aurelia nahm einen Schluck von ihrer Melange. Sie konnte Nepomuk sehr gut verstehen. Ging es ihr doch ähnlich. Auch sie hegte zarte Gefühle für einen Mann, der für sie völlig unerreichbar war.
»Der Mann, den ich treffe, ist Leutnant bei der Kavallerie.«
»Aha.«
»Jetzt ist er in große Schwierigkeiten geraten.«
»Welche Art von Schwierigkeiten?«
»Das ist eine lange, komplizierte Geschichte.«
»Ich liebe Geschichten.« Aurelia sah ihn erwartungsvoll an. »Ganz besonders, wenn sie lang und kompliziert sind. Schießen Sie los, mein Lieber.«
»Kennen Sie den Freiherrn von Sothen?«
»Nicht persönlich«, gab Aurelia zu. »Aber der Name ist jedem in der Stadt ein Begriff. Mein Vater hat mir heute Morgen aus der Wiener Tagespresse vorgelesen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist der Mann tot.«
Nepomuk nickte. »Man hat ihn aus nächster Nähe erschossen.«
»Das ist grauenvoll. Wer macht so etwas?«
»Von Sothen war ein gerissener Strizzi. Ein Krimineller, der mit Gaunerei reich geworden ist und sich an gutgläubigen Menschen bereicherte.«
»Wenn er ein Betrüger war, frage ich mich, warum er nicht im Gefängnis saß.«
»Würden alle Betrüger im Gefängnis sitzen, wären die Straßen der Stadt leer.«
»Jetzt übertreiben Sie«, meinte Aurelia.
»Von Sothen war ein Mann, der definitiv hinter Gitter gehört hätte«, sagte Nepomuk finster.
»Das mag schon sein«, erwiderte Aurelia. »Trotzdem darf niemand Selbstjustiz betreiben.«
»Natürlich stimme ich Ihnen in diesem Punkt zu«, gab Nepomuk zu.
»Was haben die Schwierigkeiten Ihres Freundes mit dem Ableben des Freiherrn zu tun?«, wollte Aurelia wissen.
Nepomuk streckte sein Kreuz durch und sah sich nach allen Seiten um, so als fürchtete er, belauscht zu werden. Sein rechtes Augenlid zuckte. Schließlich flüsterte er hinter vorgehaltener Hand: »Die Witwe des Verstorbenen behauptet, mein Freund hätte ihren Gatten erschossen.«
»Um Himmels willen«, entfuhr es Aurelia. »Hat er es denn getan?«
»Natürlich nicht. Wo denken Sie hin?« Empört riss Nepomuk die Augen auf. »Ich treffe mich nicht mit Mördern.«
Entschuldigend zuckte Aurelia die Schultern. Nepomuk kannte eine Menge dubioser Menschen. Der Gedanke war nicht so abwegig.
»Wenn Ihr Freund unschuldig ist, frage ich mich, wie die Dame auf die Idee kommt, ihn eines Mordes zu beschuldigen.«
»Mein Freund war über den Freiherrn sehr erbost«, gestand Nepomuk. »Er hat bei ihm Promessen gekauft.«
Aurelia lehnte sich zurück und zog das Punschkrapferl näher zu sich.
»Was sind Promessen?« Ihr Vater hatte heute Morgen von Losen gesprochen. War das etwa ein anderes Wort dafür?
»Dubiose Schuldverschreibungen auf Gewinnanteile eines Loses.«
»Was für Schuldverschreibungen?« Aurelia war nicht auf den Kopf gefallen. Sie kannte sich mit Geschäften aus. Ihr Vater legte Wert darauf, dass sie das Unternehmen jederzeit allein führen könnte. Als Besitzer großer Waldgebiete handelte Graf von Kolowitz mit Holz, das in seinen eigenen Sägewerken verarbeitet und dann verkauft wurde. Er verpachtete Weideland an Bauern und beschäftigte Jäger. Aber trotz ihres Verständnisses für wirtschaftliche Zahlen war Aurelia das Wort »Promessen« noch nie begegnet.
»Der Freiherr hat die Gutgläubigkeit und die Sehnsucht der Menschen ausgenutzt.«
»Die Sehnsucht wonach?«, fragte Aurelia.
»Nach dem schnellen Geld, dem großen Glück, nach dem Los, das einem Reichtum und Wohlstand beschert.«
»Ich verstehe«, sagte Aurelia. »Und um das zu bekommen, hat Ihr Freund Schuldverschreibungen auf Gewinnanteile gekauft?« Allein die Formulierung ließen bei ihr alle Alarmglocken läuten. Wie konnte man auf so etwas hereinfallen? Das ergab keinen Sinn.
»Es war alles sehr undurchsichtig und nicht sonderlich klug von meinem Freund. Niemals hätte er sich darauf einlassen dürfen. Er hat sich blenden lassen. Und er war und ist damit nicht der Einzige. Unzählige gutgläubige Menschen sind von Sothen auf den Leim gegangen.«
Aurelia wusste, dass gerade der Fasching eine Zeit war, in der die Wiener dem Glückspiel noch häufiger zusagten als normalerweise. Es schien zum Feiern dazuzugehören, aufs Glück zu hoffen. Das Geld saß den Menschen locker in der Tasche, und sie gaben es für Firlefanz und Larifari aus.
»Hat Ihr Freund den Freiherrn am Tag seines Todes gesehen?«
»Leider ja.«
»Und gab es einen Streit?«
»Auch das kann ich nicht verneinen.«
»Hat er Alkohol getrunken?« Wien war eine Stadt, in der man immer dem Wein und dem Bier zugetan war, doch im Fasching floss beides in noch größeren Mengen als sonst.
Niedergeschlagen nickte Nepomuk.
»Wie können Sie sich so sicher sein, dass Ihr Freund nicht doch die Contenance verloren und den Freiherrn erschossen hat? Es ist allgemein bekannt, dass Menschen ungehemmt reagieren, wenn sie trinken.«
Nepomuk schüttelte entschieden den Kopf. »Ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass mein Freund nicht der Mörder von Freiherrn von Sothen ist.«
»Warum sind Sie so überzeugt?« Aurelia nahm die Gabel auf und stach damit in die Zuckerglasur des Punschkrapferls.
»Ich war zum Zeitpunkt des Mordes mit meinem Freund unterwegs.«
»Na, bitte. Dann ist doch alles ganz einfach«, sagte Aurelia. »Gehen Sie zur Polizei, und geben Sie dort zu Protokoll, was Sie eben zu mir gesagt haben, und schon ist Ihr Freund aus dem Scheider.«
Nepomuks hübsches Gesicht verfinsterte sich. »So einfach ist das nicht.«
»Warum nicht?«
»Nun, die Polizei wird wissen wollen, wo Viktor und ich unterwegs waren.«
Aurelia führte einen Bissen des Punschkrapferls zum Mund, ließ die Gabel aber wieder sinken. »Haben Sie etwas Verbotenes getan?«
Nepomuk räusperte sich. »Leider wird es von der Sittenpolizei nicht gerne gesehen, wenn Männer in einschlägigen Etablissements unterwegs sind.« Er räusperte sich erneut. »Sie verstehen mich?« Seine blauen Augen sahen sie eindringlich an.