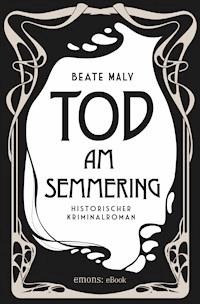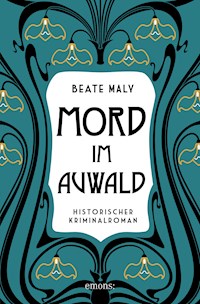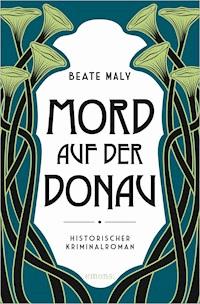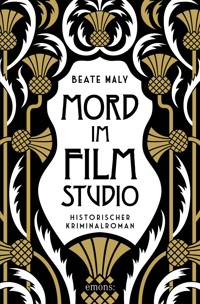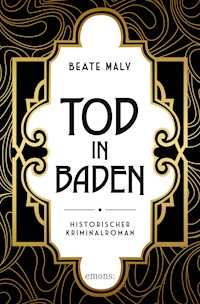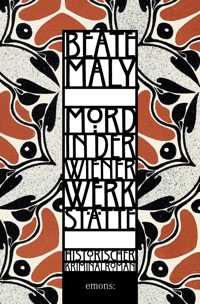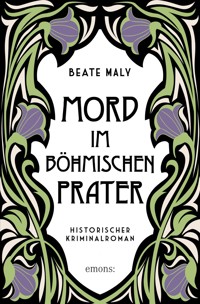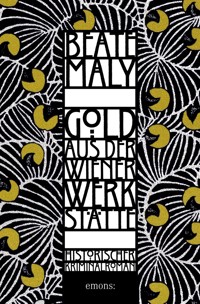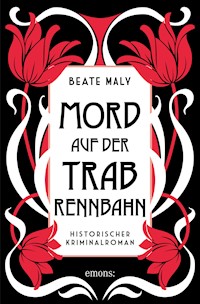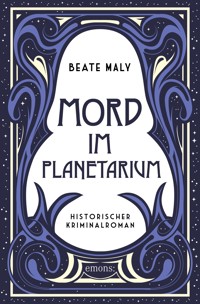
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ernestine Kirsch und Anton Böck
- Sprache: Deutsch
Mörderjagd zwischen Sternen und Planeten. Der neue Fall für Anton und Ernestine! Wien, 1927: Das erste Planetarium Österreichs wird eröffnet, die Besucher kommen in Scharen. Auch Anton und Ernestine wollen sich das Spektakel auf keinen Fall entgehen lassen. Doch als nach der Vorführung das Licht wieder angeht, ist einer der Besucher tot. Schnell wird klar, dass er nicht auf natürliche Weise starb. Anton und Ernestine wittern das Motiv hinter der schillernden Fassade einer angesehenen Familie und machen sich an die Ermittlungen... Mit feinem Humor, historischem Flair und einem Hauch Nostalgie entführt Beate Maly in »Mord im Planetarium« in das Wien der Goldenen Zwanziger – ein raffiniert konstruierter Wohlfühlkrimi voller Atmosphäre, Spannung und Wiener Esprit. Tauchen Sie ein in die Glanzzeit Wiens und rätseln Sie mit! »Beate Maly gehört zu den erfolgreichsten heimischen Autorinnen.« – »Kronenzeitung« Band 10 der Reihe »Ernestine Kirsch und Anton Böck«. Alle Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Beate Maly wurde 1970 in Wien geboren, wo sie bis heute lebt. Zum Schreiben kam sie vor rund zwanzig Jahren. Sie widmet sich dem historischen Roman und dem historischen Kriminalroman. 2019 und 2023 war sie für den Leo-Perutz-Preis nominiert, 2021 gewann sie den Silbernen Homer.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
www.emons-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung des Bildmotivsshutterstock.com/AKV
Lektorat: Uta Rupprecht
E-Book-Erstellung: Geethik Technologies Pvt Ltd
ISBN 978-3-98707-332-8
Historischer Kriminalroman
Originalausgabe
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen
insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß
§ 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Unser Handeln sei getragen von dem stets lebendigen Bewusstsein, dass die Menschen in ihrem Denken, Fühlen und Tun nicht frei sind, sondern ebenso kausal gebunden wie die Gestirne in ihren Bewegungen.
Albert Einstein
PROLOG
Wien, Hotel Metropol, 1900
Wie immer hatte er ein Zimmer mit Blick auf den Donaukanal gemietet, in einem der luxuriösesten Hotels der Stadt, dem Metropol. Mit dem Haus, das im Zuge der Weltausstellung errichtet worden war, verband ihn eine persönliche Geschichte. Sein Großvater hatte sich 1872 Hotelaktien gesichert. Die Nachfrage war enorm gewesen, denn niemand hatte am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens gezweifelt. Die Aktien waren immer noch im Familienbesitz und lieferten jedes Jahr einen satten Gewinn. Geld, das einfach eintrudelte, ohne dass man etwas dafür leisten musste.
Während andere Hotels wegen des Misserfolgs der Weltausstellung rasch wieder geschlossen wurden, erfreute man sich im Metropol stets ausgebuchter Zimmer. Vor einiger Zeit hatte der amerikanische Schriftsteller Mark Twain fast zwanzig Monate lang in einem der Appartements gewohnt.
Für gewöhnlich versetzte ihn schon der Weg am Donaukanal entlang zum Hotel in Festtagsstimmung. Der Anblick der prächtigen Fassade ließ sein Herz schneller schlagen. Die korinthischen Säulen, die Karyatiden – Frauen aus Stein mit tragender Funktion – und die Atlanten waren für ihn der Inbegriff gelungener Architektur. Danach genoss er den luxuriösen Empfang in einer der schönsten Hotellobbys der Stadt. Die Kronleuchter aus geschliffenem Bleikristall, die goldgerahmten Spiegel und die plüschigen Wollteppiche aus dem Orient ergaben ein harmonisches Gesamtbild. Sogar die Uniformen der Mitarbeiter waren farblich auf die Polsterung der Sessel und Sofas abgestimmt. Die Hotelbesitzer Klein und Feix verstanden es, ihre Gäste stilvoll zu verwöhnen. Nicht umsonst wurde das Hotel auch als »jüdisches Sacher« bezeichnet.
Doch heute konnten all die Annehmlichkeiten seine Stimmung nicht aufhellen. Ohne auf die luxuriöse Umgebung zu achten, lief er an der Rezeption vorbei. Den Schlüssel zum Zimmer hatte er bereits am Vortag von diesem Burschen organisiert, der seit ein paar Monaten am Empfang arbeitete. Genau wie gestern musterte der junge Mann ihn mit unverhohlener Neugier. Wären seine Gedanken nicht schon bei dem bevorstehenden Treffen gewesen, hätte er dafür gesorgt, dass der Rezeptionist zurechtgewiesen wurde. Es gehörte sich nicht, Gäste dermaßen neugierig anzustarren. Der Kerl war ihm bereits mehrfach wegen seines Übereifers aufgefallen. Während andere Gäste es schätzten, wenn man sich nach ihrem Befinden erkundigte, bevorzugte er Diskretion. Er wollte nicht mit Namen angesprochen werden und das Hotel möglichst unauffällig betreten und wieder verlassen. Und das galt besonders für den heutigen Aufenthalt. Er hatte eine Entscheidung getroffen, die der Dame, die er gleich empfing, nicht gefallen würde. Dabei hatte er es sich nicht so leicht gemacht wie sonst, wenn er eines seiner Gspusis abservierte, denn diesmal empfand er gewisse Gefühle. Aber er durfte sich seine Zukunft und seine Karriere nicht durch ein ungewolltes Kind zerstören lassen.
Wie groß seine Wertschätzung war, sollte das Geschenk beweisen, das er eigens für die Dame hatte anfertigen lassen. Ein wunderschönes Schmuckstück, das selbst der verstorbenen Kaiserin zur Ehre gereicht hätte. Es würde ihr über den ersten Schmerz hinweghelfen. Wie sie danach über die Runden kommen würde, war nicht mehr seine Angelegenheit. Sie war eine erwachsene Frau, sie hatte wissen müssen, worauf sie sich einließ. Eine Schwangerschaft war immer ein Risiko. Hatte sie etwa geglaubt, er werde sie heiraten, nur weil sie ein Kind von ihm erwartete?
Vielleicht hätte er das tatsächlich in Erwägung gezogen, wären die Umstände andere gewesen. Aber sie brachte schlicht und ergreifend zu wenig Geld mit. Sie konnte nicht annehmen, dass er seinen guten Ruf aufs Spiel setzte. Nicht wegen eines ungeborenen Balgs. Sollte er jemals den Bund der Ehe eingehen, dann musste sich das finanziell und gesellschaftlich rentieren. Eine Ehe war keine Sache von Liebe oder Leidenschaft, das konnte man beides ohne Gegenleistung haben. Der eheliche Bund war ein wirtschaftlicher Vertrag, der ausgehandelt wurde. Und da er nicht in Geldnöten war und die Dame ihm gewiss keinen gesellschaftlichen Aufstieg ermöglichen konnte, würde er ihr heute sagen, dass er sie nicht wiedersehen wollte.
Er war auf hysterische Gefühlsausbrüche vorbereitet, weshalb er vorsichtshalber eine Flasche Champagner bestellt hatte. Die würde er zuvor mit ihr trinken. Vielleicht noch ein letztes Mal mit ihr ins Bett gehen, schließlich hatte er für das sündhaft teure Zimmer bezahlt und wollte sein Geld nicht einfach beim Fenster hinauswerfen. Und dann war da noch das Schmuckstück, auch dafür hatte er tief in die Tasche greifen müssen. Da stand ihm ein bisserl Unterhaltung zu.
Er schloss die Zimmertür auf. Wie immer wehte ihm der dezente Duft von Rosenwasser entgegen, das man auf seinen persönlichen Wunsch versprüht hatte. Die Dame, die er empfing, mochte diese Blumen. Es war alles wie immer. Das Himmelbett, die seidenen Bettlaken, der weiche Teppichboden.
Er trat zum Fenster und holte das kleine Schmuckkästchen aus seiner Weste, neben seiner goldenen Taschenuhr. Mit einem leisen Schnappen klickte er es auf. Das Schmuckstück war atemberaubend schön. Drei kleine Diamantsplitter bildeten den Mittelpunkt einer aus Rubinen bestehenden Blume. Wenn dieses kostbare Geschenk sie nicht besänftigte, dann war ihr nicht zu helfen.
Er schloss das Kästchen wieder und steckte es zurück zur Uhr. Dann zog er die Champagnerflasche aus dem silbernen Kühler. Geschickt öffnete er den Korken und hielt ihn fest, damit er nicht gegen die stuckverzierte Zimmerdecke flog.
Er sah zu, wie die sprudelnde goldgelbe Flüssigkeit langsam in einen der Bleikristallkelche plätscherte. Unzählige Perlen stiegen darin auf.
Dann schaute er in den Spiegel. Der Mann, der ihm entgegenblickte, gefiel ihm. Er war zweifelsohne attraktiv. Im Nu würde er eine neue Gespielin für unterhaltsame Stunden finden. Zufrieden prostete er sich selbst zu. »Auf eine strahlende, erfolgreiche Zukunft ohne Verpflichtungen!«
In einem Zug leerte er das Glas und stellte es zurück auf das Silbertablett. Da klopfte es leise an der Tür.
Sie war um zehn Minuten zu spät. Wie immer. Heute ärgerte er sich nicht darüber. Auch das Warten hatte ab jetzt ein Ende.
EINS
Wien, Kirchengasse, 1927
Auf Zehenspitzen schlich Anton in seine frühere Wohnung, in der seit über einem Jahr seine Tochter Heide und ihr Ehemann Erich Felsberg mit Rosa, Heides Tochter aus erster Ehe, und seit Jänner auch mit Erichs und Heides gemeinsamem Sohn Julian lebten. Anton selbst war mit der pensionierten Lateinlehrerin Ernestine Kirsch in das renovierte Kutscherhäuschen im Garten hinter der Apotheke gezogen. Ein Umstand, den er sehr erfreulich fand.
Geräuschlos zog er die Wohnungstür hinter sich zu. Auf keinen Fall wollte er unnötigen Lärm verursachen. Als er das Wohnzimmer betrat, fand er seine Tochter im Halbschlaf auf dem Sofa sitzend. Sein Enkelsohn lag friedlich in der Wiege daneben.
Als Heide die leisen Geräusche wahrnahm, schreckte sie sofort hoch. Besorgt warf sie einen Blick in die Wiege und sank dann erleichtert zurück ins Sofa. Julian schmatzte zufrieden. Dabei hielt er die Augen geschlossen und begnügte sich mit seinem Daumen.
Wie immer, wenn Anton seinen Enkel sah, ging ihm vor Freude und Stolz regelrecht das Herz über. »Er ist das hübscheste Kind, das ich je gesehen habe. Mit Ausnahme von Rosa, die war ebenso entzückend«, flüsterte er. Er sah Heide an. »Und du natürlich auch!«
Warnend legte seine Tochter den Finger gegen die Lippen: »Pst!« Sie rappelte sich auf und bedeutete Anton mit einem Wink, ihr zu folgen. »Lass uns in die Küche gehen. Du hättest Juli vor einer halben Stunde erleben sollen, da hättest du ihn nicht so verliebt angesehen.«
»Unsinn, Juli ist auch weinend zum Anbeißen. Hat der Arme immer noch Bauchkoliken? Ist er dazu nicht inzwischen zu alt?«
»Er war einfach nur müde«, sagte Heide gähnend.
»Hat er wieder schlecht geschlafen?«
»Er hat zu jeder vollen Stunde nach der Brust verlangt.« Heide strich sich das ungekämmte Haar hinter die Ohren. Unter ihren Augen lagen dunkle Ringe, sie sah erschöpft aus. Andere Frauen nahmen während des Stillens zu, Heide war in den letzten Monaten so abgemagert, dass man die Knochen unter ihrem hellen Sommerkleid sah. Anton machte sich ernsthaft Sorgen um seine Tochter. So gut er konnte, half er in der Apotheke aus. An manchen Tagen stand er sogar allein im Geschäft. So wie früher, bevor Heide die Leitung übernommen hatte.
»Oh mein Gott«, sagte er bestürzt. »Dann habt ihr zwei ja gar nicht geschlafen.«
»Und Erich auch nicht!«, fügte Heide hinzu. »Trinkst du mit mir eine Tasse Fencheltee?«
»Kaffee wäre mir lieber.«
»Du weißt doch, dass ich den nicht trinken darf, solange ich stille.«
Enttäuscht verzog Anton den Mund. Seit Heide literweise Fenchel- und Kümmeltee in sich hineinschüttete, hatte niemand in der Familie mehr Blähungen. Nur Juli schien gegen die Wirkung der Kräuter immun. Er jammerte trotzdem, weil ihm der Bauch wehtat.
Erich, der bei der Kriminalpolizei Oberkommissar war, trank seinen Kaffee jetzt im Büro. Ernestine versorgte sich morgens in der Arbeiterbücherei, in der sie seit ein paar Monaten ehrenamtlich aushalf, mit Pfefferminztee, und Rosa löffelte so viel Honig in den Fencheltee, dass vom eigentlichen Geschmack nur noch wenig übrig blieb.
Aus Solidarität mit seiner Tochter nahm Anton das Angebot an. »Aber nur ein kleines Häferl.« Er warf einen Blick auf die Wanduhr. In einer halben Stunde musste er die Apotheke aufsperren. So erschöpft, wie Heide aussah, würde er den Vormittag dort wieder ohne seine Tochter verbringen. Eigentlich hatte er heute frische Pfefferminzpastillen drehen wollen, aber das musste warten.
»Kommt Ilse später?«, fragte Heide. Das war die Aushilfskraft, die vor ein paar Wochen in der Apotheke angefangen hatte. Eigentlich hatte Ilse eine Stelle in einer Buchhandlung oder einer Bücherei gesucht, doch daraus war nichts geworden. Sie war eine höfliche und hilfsbereite junge Frau, die Bücher liebte und darin förmlich zu leben schien. Ständig war sie mit ihren Gedanken in einer der Geschichten, die sie gerade las. Dementsprechend unkonzentriert arbeitete sie. Sie vergaß Bestellungen, verlegte wichtige Medikamente und vertauschte Kundennamen. Täglich kam sie zu spät, weil sie so sehr in ihr Buch vertieft war, dass sie die Haltestelle verpasste. Dann musste sie eine oder zwei Stationen zu Fuß zurücklaufen. Am liebsten sortierte sie die Zeitschriften, die auf einem kleinen Tischchen für wartende Kunden bereitlagen.
»Nein, sie kommt nicht, aber heute kann sie nichts dafür«, sagte Anton. »Sie hat einen Zahnarzttermin und hat sich im Voraus entschuldigt.«
Heide stellte den Teekessel auf den Gasherd. »Ich mag Ilse, aber sie sollte lieber in einer Buchhandlung arbeiten. Wir müssen uns nach einer anderen Aushilfskraft umsehen.«
»Und Ilse kündigen?«, fragte Anton. »Wir haben so lange nach einer Mitarbeiterin gesucht. Ilse ist klug und sehr bemüht. Wenn sie ein bisserl weniger tagträumen würde, wäre alles gut.«
»Sie wäre besser bei Ernestine in der Arbeiterbücherei aufgehoben«, sagte Heide.
Anton stimmte seiner Tochter zu. »Leider kann Ilse von den ehrenamtlichen Tätigkeiten dort nicht leben.«
Drei Monate lang war die Stelle in der Apotheke ausgeschrieben gewesen, doch es war wie verhext. Trotz steigender Arbeitslosigkeit in der Stadt war es schwierig, qualifizierte Kräfte zu finden.
Der Wasserkessel pfiff, und Heide goss den Tee auf.
»Selbst wenn wir jemand anderen finden würden, ich glaube, ich brächte es nicht übers Herz, Ilse zu entlassen.«
Schon beim Gedanken an das Gespräch brach Anton eiskalter Schweiß aus. Er wollte einer jungen Frau nicht die Lebensgrundlage entziehen. Und auch wenn Ilse Dinge verschusselte, so war sie doch eine gewisse Hilfe und Anton nicht mehr der Jüngste. Nach seiner Pensionierung hatte er sich rasch an die Annehmlichkeiten des Ruhestands gewöhnt. Er genoss die gemütlichen Spaziergänge mit Minna, der Cockerspanieldame, ebenso wie die wohlverdiente Jause am Nachmittag. Doch damit war vorerst Schluss.
Weshalb es ihm noch schwerer fiel als sonst, sich mit Ernestines Abenteuerlust abzufinden. Immer wieder gelang es der pensionierten Lateinlehrerin, ihn zu Unternehmungen zu überreden, die er eigentlich verabscheute. Erst gestern hatte sie mit einem neuen Vorschlag aufhorchen lassen. Sie hatte ein Prospekt aus der Bibliothek mitgebracht, von dem auch ein Exemplar in Heides Küche lag. »Wien und die Wiener«, war darauf zu lesen. »Das alte und das neue Wien, Ausstellung im Messepalast Wien, Mai bis August 1927«. Anton nahm es zur Hand, auch wenn er es gestern schon durchgeblättert hatte. Neben Volkskunstspielen, einem Alt-Wiener Kaffeehaus und einem Heurigengarten wurden täglich Konzerte angeboten, und es gab zwei Sonderausstellungen. Die eine stand unter dem Motto »Die Wienerin« und war von den vereinigten Frauenverbänden organisiert worden. Die andere hieß »Der Himmel über Wien«, denn es war gelungen, das erste Planetarium außerhalb Deutschlands nach Wien zu holen. Für den riesigen Projektor der Firma Zeiss hatte man vor dem Messepalast eigens ein großes Gebäude errichtet. Es erinnerte an eine achtseitige ägyptische Pyramide.
»Hat Ernestine euch auch gefragt, ob ihr mit ins Planetarium kommt?«, erkundigte sich Anton.
»Nicht nur das«, sagte Heide. »Sie hat sogar schon Karten für uns alle besorgt.«
Anton schaute auf den Eintrittspreis. Er betrug einen Schilling pro Person, ein Betrag, den sich auch Menschen aus der Arbeiterschicht leisten konnten.
So als könnte Heide die Gedanken ihres Vaters lesen, fuhr sie fort: »Ernestine hat natürlich ganz besondere Karten. Wir bekommen eine kleine, fast private Vorführung mit dem wissenschaftlichen Leiter des Planetariums und einen Imbiss davor.«
»Wo hat sie denn die wieder aufgetrieben?« Anton sah fragend zu seiner Tochter und hob dann abwehrend beide Hände. »Ach, lass nur. Ist ohnehin egal. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als mitzugehen. Aber wie willst du mit Juli eine Ausstellung besuchen?«
»Auch diesbezüglich hat Ernestine bereits vorgesorgt. Anna Wagner, Fritzis Mutter, wird auf Juli aufpassen, wenn wir im Gegenzug Fritzi mitnehmen. Die Klassenlehrerin hat vor den Ferien so von dem Planetarium geschwärmt, dass die Kinder unbedingt zu einer Vorführung wollen.«
»Wäre es nicht einfacher, wenn Fritzis Mutter Rosa mitnimmt?«, fragte Anton. In dem Fall würde er sich den Besuch vielleicht ersparen.
»Das war auch mein erster Gedanke«, gab Heide zu. »Doch dann hat Ernestine gemeint, dass es für Rosa doch schön wäre, wenn wir alle gemeinsam etwas unternehmen. Sie musste in den letzten Monaten so oft zurückstecken, weil Erich und ich keine Zeit für sie hatten. Ständig stand Juli im Mittelpunkt.«
»Damit hat Ernestine wohl recht«, gab Anton zu. Auch wenn Rosa sich bis jetzt nicht beschwert hatte, blieb für sie deutlich weniger Zeit als früher. Er selbst konnte seiner Enkeltochter nicht mehr so oft und so viel vorlesen wie noch vor einem halben Jahr, weil er abends einfach zu müde war.
»Und wann werden wir uns die Ausstellung ansehen?«, erkundigte er sich.
»Am Wochenende.«
»So schnell schon?« Anton hatte gehofft, die freie Zeit gemütlich im Liegestuhl unter dem großen Marillenbaum im Garten verbringen zu können. Daraus wurde nun nichts. Er würde einem Konzert lauschen, Ausstellungen von Frauenvereinen ansehen und dann eine Vorstellung im Planetarium über sich ergehen lassen. Heide reichte ihm den Fencheltee.
»Ich glaube, ich brauche jetzt doch ein Häferl Kaffee«, meinte er mit leidender Miene. »Eines mit viel Zucker und Milch.«
»Ach, Papa. Hier, nimm den Tee. Der ist fertig.«
In dem Moment erwachte Juli. Zuerst raunzte er leise, und als Heide nicht sofort reagierte, fing er an zu weinen.
»Siehst du«, sagte Anton vorwurfsvoll. »Mein Enkelsohn teilt meine Meinung. Auch er protestiert gegen Fencheltee.«
Heide drückte Anton das Teehäferl in die Hand und eilte ins Wohnzimmer. Kaum hatte sie Juli aus dem Stubenkorb genommen, hörte der Bub zu weinen auf. Heide trug ihn in die Küche, und als Juli seinen Großvater sah, lächelte er übers ganze Gesicht. Seine feinen orangeroten Locken, die er von seinem Vater Erich geerbt hatte, waren verschwitzt vom Schlaf. Die riesigen hellblauen Augen glänzten.
Auf der Stelle vergaß Anton den Kaffee. »Guten Morgen, Sonnenschein!« Er nahm Juli entgegen, und mit einem Mal war auch die Ausstellung nicht mehr schlimm.
ZWEI
»Nächste Woche findet endlich der Prozess gegen die drei Schützen aus Schattendorf statt.« Ernestine faltete die Tagespresse zusammen und legte sie zur Seite.
Die Reste vom Frühstück befanden sich noch auf dem Terrassentisch. Das letzte Stück Butter schmolz gerade in der Sonne und hinterließ eine kleine goldglänzende Pfütze auf dem Teller. Mit einem Stück Semmel tupfte Anton die Flüssigkeit auf und steckte den Leckerbissen in den Mund.
»In der Bibliothek wird über nichts anderes mehr geredet«, fuhr Ernestine fort. Seit einem halben Jahr war sie mittlerweile in der Arbeiterbibliothek beschäftigt. Zuerst hatte sie nur sporadisch ausgeholfen, doch seit es im Jänner in Schattendorf zu den Todesschüssen gekommen war, hatte sie ihre ehrenamtliche Tätigkeit ausgeweitet. »Es ist nicht länger möglich, sich aus allem herauszuhalten. Man muss sich jetzt politisch engagieren«, hatte sie gesagt.
Anton sah das nach wie vor anders. Er hatte zu all den unerfreulichen Entwicklungen, die die Gesellschaft zu entzweien drohten, zwar eine Meinung, doch er weigerte sich, selbst politisch aktiv zu werden. Vor allem verurteilte er die paramilitärischen Einheiten in den Parteien. Nie wieder wollte er Männer mit Waffen in den Händen sehen. Drei Jahre in der Kaiserlichen Armee der Habsburger und die Teilnahme am schrecklichsten Krieg aller Zeiten hatten tiefe Spuren bei ihm hinterlassen.
»Die Männer müssen verurteilt werden«, sagte er überzeugt. »Diese Feiglinge haben aus einem Wirtshaus heraus auf Demonstranten geschossen. Ein Kriegsinvalide und ein Kind sind vorsätzlich getötet worden. Eigentlich verstehe ich die ganze Diskussion nicht. Wir leben in einem Rechtsstaat, da kann es doch nur ein Urteil geben. Die Mörder gehören ins Gefängnis, denn die Todesstrafe wurde zum Glück abgeschafft.«
»Ich hoffe sehr, dass du recht behältst«, entgegnete Ernestine. Sie trug ein zitronengelbes Sommerkleid, das ihre gebräunte Haut hübsch zur Geltung brachte. Seit Wochen schon hielt das warme Sommerwetter an. »Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es anders ausgeht; schließlich werden Geschworene über die Angeklagten entscheiden, und da sind auch Christlichsoziale dabei. Wenn die drei freigesprochen werden, dann schütze uns Gott.«
»Du bittest Gott um Schutz?«, fragte Anton erstaunt. Zu gerne hätte er noch den allerletzten Rest der Butter aufgewischt, aber der Brotkorb war leer. »Seit ich dich kenne, hast du noch nie den Allmächtigen um Hilfe gebeten. Was ist los mit dir?«
»Es liegt wohl an Mitzi Brunner. Sie redet dauernd davon, dass nur noch Gott uns beschützen kann.«
»Die sozialdemokratische Mitarbeiterin in der Arbeiterbibliothek?«, fragte Anton. »Ist sie sicher, dass sie in der richtigen Partei ist?«
»Es ist wohl mehr eine Floskel«, meinte Ernestine. »Aber Mitzi hat recht mit ihren Sorgen. Der Prozess polarisiert wie kein Ereignis zuvor. Die Christlichsozialen reden von Notwehr, was absurd ist.«
Anton lachte humorlos auf. »Wogegen hätten sie sich denn im Wirtshaus wehren müssen? Gegen die paar Demonstranten, die sich davor versammelt hatten? Gegen ein unbewaffnetes Kind und einen alten Kriegsinvaliden?«
»Die Sozialisten waren aber bewaffnet«, gab Ernestine zu bedenken. »Und die Versammlung war eine bewusste Provokation. Man wusste, dass sich die Heimwehr im Wirtshaus trifft. Die Stimmung war höchst aufgeladen.«
»Und du meinst, provokatives Verhalten rechtfertigt zwei feige Morde?« Anton stand auf und fing an, die schmutzigen Frühstückshäferl auf ein Tablett zu räumen. Die ersten Wespen schwirrten bereits herum. Er verscheuchte die lästigen Viecher.
»Du weißt genau, wie ich dazu stehe.« Ernestine schüttelte den Kopf, dabei rutschte ihr eine der grauen Locken in die Stirn. Sie schob sie zurück hinters Ohr. »Natürlich verurteile ich Gewalt. Und ich hoffe, dass die Gerechtigkeit siegen wird. Aber sicher bin ich mir nicht. Und wenn die Männer freigesprochen werden, fürchte ich die Wut der Sozialisten. Unsere Demokratie ist ein zartes Pflänzchen, das genährt werden muss und nicht getreten.«
»Für gewöhnlich sind das meine Worte.«
»Ich weiß.« Ernestine grinste. »Und sie gefallen mir so gut, dass ich sie gerne übernehme.«
»Hm.« Zu jedem anderen Zeitpunkt hätte Anton sich geschmeichelt gefühlt. Aber im Moment bereiteten ihm Ernestines ungewohnt düstere Überlegungen Sorgen. »Seit du in der Bücherei arbeitest, wechseln wir die Rollen. Du wirst zur Pessimistin. Das ist nicht gut. Denn ich bin als Optimist lang nicht so gut wie du.«
»Ich werde mich wieder bessern«, versprach Ernestine.
»Redet ihr über den Schattendorf-Prozess?« Erich war durch den Garten zu ihnen gekommen, sie hatten ihn beide nicht bemerkt. Die Geburt seines Sohnes hatte Erich zu einem Mann gemacht, der sich völlig geräuschlos bewegen konnte, und das trotz der Verletzung aus dem Krieg. Zur Abwechslung sah Erich relativ ausgeschlafen aus, die Ringe unter seinen Augen waren nicht ganz so dunkel wie sonst. Das bedeutete wohl, dass Juli in dieser Nacht gut geschlafen hatte und mit ihm auch seine Eltern.
»Guten Morgen«, sagte Ernestine. »Bist du denn nicht gespannt, wie der Prozess ausgehen wird? Bestimmt wird auch unter den Kriminalbeamten darüber geredet.«
»Natürlich bin ich neugierig, und ich gehe von einem Sieg der Gerechtigkeit aus«, sagte Erich. »Wobei ich zugeben muss, dass ich mich momentan nur wenig mit den tagesaktuellen Nachrichten beschäftige. Meine Gedanken kreisen um einen Sohn, der durchschlafen soll.«
»Was heute der Fall gewesen zu sein scheint. Du siehst erholt aus«, meinte Ernestine.
»Die Nacht war eine Wohltat.« Erich seufzte. »Wir sind alle ausgeschlafen und bereit für den Ausflug in den Messepalast. Heide und Rosa freuen sich schon.«
»Du etwa nicht?«, wollte Anton wissen.
Erich verzog den Mund. »Wenn ich ehrlich sein soll, wäre mir ein ruhiger Nachmittag am Donaukanal oder in den Praterauen, irgendwo im Schatten eines großen Baumes, lieber gewesen. Aber seit das Prospekthefterl vom Planetarium bei uns im Wohnzimmer herumkugelt, redet Rosa von nichts anderem mehr.« Er warf Ernestine einen vorwurfsvollen Blick zu. »Hätte es nicht ausgereicht, wenn du darüber erzählst?«
»Auf gar keinen Fall!« Belehrend hob Ernestine den Zeigefinger. »Sowohl die Ausstellung als auch die Vorführung im Planetarium sind einzigartig. So etwas hat es in der Stadt noch nie gegeben. Wir werden eine Reise zu den Sternen und Planeten unternehmen. Ist das nicht aufregend?«
Erich wandte sich hilfesuchend an Anton, doch der senkte bloß den Kopf und schwieg.
»Wann geht es los?«, fragte Erich leidend.
»Kurz nach dem Mittagessen. Zuerst sehen wir uns die Ausstellung an, dann machen wir eine Pause im Kaffeehaus, und danach gehen wir ins Planetarium. Die Vorführung beginnt um fünf Uhr. Die Präsentationen sind seit Wochen ausverkauft. Und wir haben Spezialkarten für eine kleine Privatvorführung mit Büfett ergattert.«
»Wie bist du zu den Karten gekommen?«, fragte Erich.
Ernestine lächelte geheimnisvoll. Doch dann gab sie zu: »Mitzi Brunner hat sie mir gegeben. Sie kennt einen Techniker von Zeiss, von dem hat sie die Karten. Entweder hat er sie aus Versehen verschenkt, oder es war ihm egal, dass es sich um eine geschlossene Veranstaltung handelt. Auf alle Fälle haben wir sie jetzt. Mitzi konnte damit nichts anfangen.«
»Wird man uns denn hineinlassen, wenn jemand den ganzen Saal für sich gebucht hat?«
»Ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind, die nicht zum Unternehmen Faber gehören«, meinte Ernestine.
Erich sah sie an. »Sind das die Herrschaften, die das Planetarium für sich haben wollen?«
»Ja.«
»Nun, lassen wir uns überraschen«, sagte Anton. »Vielleicht sind die Ausstellungen so ermüdend, dass Erich und ich ohnehin lieber im Kaffeehaus bleiben. Es ist doch nicht notwendig, dass wir alle den Sternenhimmel ansehen und zu den Planeten reisen, oder?« Er gab sein Bestes, um seinen Schwiegersohn zu retten, aber Ernestine blieb unerbittlich.
»Das werdet ihr nicht tun!« In deutlich versöhnlicherem Ton fügte sie hinzu: »Bei der Spezialvorstellung gibt es eine musikalische Begleitung am Klavier. Und davor werden ein kleiner Imbiss und Getränke gereicht.« Sie richtete sich an Erich. »Heide und Rosa reden seit Tagen von nichts anderem! Sie wären sehr enttäuscht, wenn du nicht dabei wärst.«
»Ich weiß.« Erich hob entschuldigend beide Hände. »Du hast völlig recht. Es wird ein gemütlicher Familienausflug, und Fritzis Mutter wird unseren kleinen Juli bestens versorgen.«
»Ganz bestimmt.« Dann widmete Ernestine sich dem restlichen Frühstücksgeschirr und schlichtete es auf Antons Tablett, das sie ihm abnahm.
Auch Erich ging zurück zum Haus, und als beide verschwunden waren, griff Anton nach Minnas Leine.
»Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast«, flüsterte er. »Hunde sind im Messepalast nicht erlaubt.« Die Cockerspanieldame antwortete mit einem Schwanzwedeln. »Du kannst den ganzen Nachmittag im Garten schlafen …« Anton kraulte Minna hinter den Ohren.
Doch er war nicht leise genug gewesen, schon streckte Ernestine den Kopf zur Terrassentür heraus. »Das hab ich ganz genau gehört!«
Um weiteren Diskussionen auszuweichen, brach Anton rasch zum Hundespaziergang auf.
Für gewöhnlich brauchte man von der Kirchengasse zum Messepalast am Ring zu Fuß zehn Minuten. Da Rosa und Fritzi es aber nicht erwarten konnten und vor Aufregung förmlich rannten, waren sie bereits nach sechs Minuten am Ziel. Anton schwitzte unter seinem sommerlichen Strohhut, und auch Ernestine und Heide waren außer Atem. Nur Erich schien das Tempo gewohnt. Trotz seines bewegungseingeschränkten Beins – ein Andenken an den großen Krieg – war er gut zu Fuß unterwegs.
Schon von Weitem konnte man das Spektakel hören und sehen. Von überallher strömten die Gäste auf das Messegelände. Vor dem Messepalast hatte man mehrere Ausstellungspavillons aufgebaut. Ein provisorischer Heuriger und ein Kaffeehaus lockten mit Köstlichkeiten für die Besucher, aber die Hauptattraktion war das Planetarium. Ein Neubau, der wegen des achtseitigen, pyramidenförmigen Dachs auffiel. Seit Wochen war diese Attraktion Gesprächsstoff in der Stadt. Kaum jemand in Wien, der das astronomische Lehrtheater nicht besuchen wollte. Wer noch keine der begehrten Karten ergattert hatte, musste sich vorerst mit einem Blick auf das Gebäude von außen begnügen.
Am Eingang zum Messepalast hatte sich eine beachtliche Warteschlange gebildet. Ernestine, Anton und die anderen reihten sich am Ende ein.
»Oh, das dauert ja ewig«, raunte Rosa. »Da hätten wir uns nicht so beeilen müssen.«
»Das hab ich wiederholt gesagt«, erinnerte Anton.
Das Mädchen stellte sich auf die Zehenspitzen, um über die Köpfe der Wartenden zu schauen, aber das gelang ihr nicht.
»Wenn wir drinnen sind, kaufen wir ein Eis«, versprach Anton.
»Gibt es denn welches?«, fragte Heide.
Anton holte das Programmheft aus seinem leichten Sommersakko aus Leinen und zeigte auf die Rückseite. »Hier steht es.«
Rosa rief: »Ich will Schokolade und Zitrone!«
»Und ich Erdbeere«, meinte Fritzi. »Oder vielleicht Vanille? Oder Erdbeere und Vanille?«
Die Vorfreude auf das Eis verkürzte die Wartezeit enorm, und schon standen sie beim Schalter. Ernestine wies die Karten vor.
»Passen S’ gut darauf auf«, warnte sie der Mann in Uniform. »Im Planetarium müssen Sie sie noch einmal herzeigen.«
»Werde ich machen.« Ernestine nahm die abgerissenen Karten wieder entgegen.
»Gestern haben drei Leut ned reindürfen, weil sie ihre Karten verschmissen haben.«
»Keine Sorge, die Billetts sind schon wieder weggesteckt.« Ernestine klopfte auf ihre Handtasche.
Hinter ihnen wurde die Schlange der Wartenden immer länger. »Hörts auf zum Plaudern und tuats weiter!«, forderte eine ungehaltene Frau mit auffallend großem Hut.
»Immer mit der Ruhe. Hier wird ordentlich gearbeitet und ned gehudelt«, schrie der Mann am Schalter zurück.
Ernestine bedankte sich bei ihm und winkte die anderen mit sich.
»Kein Wunder, dass man so lange warten muss«, raunte Anton leise. »Wenn der Mann mit allen Leuten einen kleinen Tratsch beginnt, zieht sich die Schlange bald den ganzen Ring entlang.«
»Ist doch freundlich, dass er uns darauf hingewiesen hat, auf die Karten gut achtzugeben. Auch wenn ich sie ohnehin aufgehoben hätte. Es ist ja ganz klar, dass man sie auch im Planetarium vorweisen muss.«
»Dahinten gibt es das Eis!« Rosa zeigte zu einem Verkaufsstand auf Rädern mit einem rot-weiß gestreiften Dach. Der Eisverkäufer trug einen Strohhut und eine weiße Schürze und füllte Stanitzel mit der gefrorenen Süßigkeit.
Ernestine drehte sich suchend einmal im Kreis. »Woher kommt die Musik?«
»Von dort hinten«, meinte Heide. »Da wird gerade ein Konzert gegeben. Sollen wir uns aufteilen? Ich habe keine Lust auf Eis.«
»Das ist eine sehr gute Idee«, stimmte Anton seiner Tochter zu. Wieder holte er das Programmheft hervor, und sie beratschlagten, wer wohin gehen wollte.
Ernestine zog es zur Musikbühne und zu den Operettenstücken, Heide und Erich interessierten sich für einen Stand über technische Innovationen im Haushalt. Und Anton wollte sich zuallererst ein Eis mit den Kindern gönnen.
»Treffen wir uns kurz vor fünf beim Planetarium«, schlug Ernestine vor.
Damit waren alle einverstanden.
Rosa schnappte sich Antons rechte Hand, Fritzi seine linke, und beide Kinder zogen ihn zum Eisstand. Heide hakte sich bei Erich unter. Auch wenn der Tag als Familienausflug geplant war, schienen die beiden es zu genießen, ein paar Stunden als Paar unterwegs zu sein.
Ernestine folgte ihrem Gehör. Sie drängte sich an Ausstellungsständen vorbei zur Festbühne, wo ein sechsköpfiges Orchester ein Stück aus der »Lustigen Witwe« von Franz Lehár zum Besten gab. Ein junger Mann in Frack und Zylinder sang höchst ambitioniert, aber mit ein paar Misstönen in der Stimme: »Heut geh ich ins Maxim!« Einige der Zuschauer verließen kopfschüttelnd ihre Plätze, weshalb Ernestine sich aussuchen konnte, wo sie sich hinsetzte. Sie sah dem Künstler die kleinen Fehler nach. Es war nicht leicht, am frühen Nachmittag einen Mann zu mimen, der sich auf einen Besuch in einem Revuetheater vorbereitete. Ihr gefiel die Melodie, und so entschied sie sich für eine der ersten Reihen, wo gerade ein Pärchen das Weite suchte. Ernestine machte es sich bequem, stellte die Handtasche auf ihrem Schoß ab und zog den Strohhut tiefer in die Stirn, damit die Sonne sie nicht blendete. Voller Vorfreude wollte sie sich dem Musikgenuss hingeben, doch hinter ihr tuschelten zwei Besucher so laut, dass sie den Sänger mit dem überschaubaren Stimmvolumen nicht gut hören konnte.
»Ist es nicht eine Schande, dass man solche Dilettanten engagiert? Bestimmt kassiert der Mann eine Menge Geld, und die wirklich guten Musiker lässt man im Planetarium Begleitmusik spielen.« Die Stimme war weiblich, und sie klang nicht nur jung, sondern auch sehr verärgert.
»Es ist lieb, dass du in mir einen guten Musiker siehst«, antwortete eine ebenso junge männliche Stimme. »Aber ich will mich wirklich nicht beklagen. Für den Auftritt heute Nachmittag zahlt man mir so viel, wie ich sonst in einer Woche bekomme. Und wenn alles gut geht, darf ich auch in den kommenden Tagen bei den Vorführungen Klavier spielen.«
»Du gehörst auf eine große Bühne und nicht in den Hintergrund bei einem Vortrag über den Sternenhimmel, wo niemand deine Musik würdigt!«
»Du weißt ja gar nicht, ob man sie nicht doch schätzt. Es ist gar nicht so einfach, einen Vortrag zu begleiten. Stell dir vor, ich würde zu laut oder völlig falsch spielen. Dann könnten sich die Gäste nicht auf die Vorführung konzentrieren, und das ganze Sternentheater wäre nur halb so schön.«
Die Frau ging nicht auf die Worte ein, sondern schimpfte weiter: »Du spielst um so vieles besser, als dieser Tölpel auf der Bühne singt!«
»Pst, Rosi, sei leise. Die Leute schauen schon.«
Auch Ernestine drehte sich kaum merklich um. Gerade so weit, um die Menschen zu den Stimmen zu sehen. Das Paar hinter ihr war eine Spur älter, als sie gedacht hatte, sie schätzte die beiden auf Ende zwanzig. Sie waren modern, aber ärmlich gekleidet. Die Frau trug ein geblümtes Sommerkleid mit passendem Hut, doch selbst der flüchtige Blick verriet Ernestine, dass der Stoff des Kleides an manchen Stellen geflickt und ausgebleicht war. Sie nahm an, dass die Trägerin ein altes Modell abgeändert hatte, damit es pfiffiger aussah. Der Mann hatte einen hellen Sommeranzug an. Als er sich an der Lehne ihres Sessels abstützte, um aufzustehen, sah Ernestine, dass die Ärmel des Sakkos abgestoßen waren.
»Lass uns gehen«, sagte er. »Ich will noch einmal kontrollieren, ob das Klavier gestimmt ist und die Noten vollständig vorhanden sind.«
»Du hast schon vor einer Stunde den Klang des Klaviers überprüft«, sagte die Frau. »Aber ich will ohnehin nicht mehr bleiben. Dieses Gekrächze ist nicht auszuhalten.«
»Du bist zu streng. Ich selbst singe auch nicht besser.«
»Unsinn, Richard, du weißt, dass du ein begnadeter Musiker und auch Sänger bist. Eigentlich solltest du allein auf dieser Bühne stehen, die Leute würden sich um einen Platz in einer der ersten Reihen prügeln.«
»Danke, Rosi! Du bist so lieb!« Ernestine bemerkte aus den Augenwinkeln, wie er die Hand seiner Begleiterin zum Mund führte und küsste. »Ich gehe ins Planetarium. Musst du nicht auch schon mit den Vorbereitungen beginnen?«
»Ich bin bloß fürs Servieren der Getränke zuständig«, sagte sie. »Es reicht, wenn ich kurz vor Beginn meine weiße Schürze umbinde.«
»In dem Kleid willst du servieren?«
»Ich habe noch ein anderes dabei, ein dunkles. Aber ich komme mit dir mit.«
»Pst!« Ein erbostes Zischen neben Ernestine forderte Ruhe ein. »Wenn Sie sich unterhalten wollen, gehen Sie woandershin. Ich bin wegen der Musik hier.«
»Pah, von wegen Musik. Das ist Katzengejammer«, sagte die Frau und stand ebenfalls auf.
»Rosi, hör auf!« Der Mann fasste seine Begleitung an der Hand, entschuldigte sich und drängte sich gemeinsam mit ihr an den Sitzenden vorbei.
Ernestine hatte nicht mitbekommen, dass der Künstler nicht mehr vom Maxim sang, sondern jetzt ein Lied aus einer Strauss-Operette zum Besten gab. Leider klang auch dieses Lied nicht so, wie Ernestine es gewohnt war. Der Großteil des Publikums schien sich nicht daran zu stören, was vielleicht dem Grünen Veltliner und dem Gemischten Satz geschuldet war, die beim Heurigen nebenan ausgeschenkt wurden. Einige der Zuschauer hatten kleine Weingläser mit grün aufgemalten Weinreben in den Händen, die typischen Wiener Fasslbecher. Auch Ernestine verspürte mit einem Mal Durst. Seit dem Mittagessen hatte sie nichts mehr getrunken, und Antons Eiernockerl waren heute außergewöhnlich stark gesalzen gewesen. Sie beschloss, sich lieber etwas zu trinken zu besorgen. Selbst als eingefleischte Operettenliebhaberin versäumte sie hier nicht allzu viel.
Kurz darauf befand sie sich erneut in einer Warteschlange, diesmal stand sie für ein Himbeerkracherl an.
»Ich schwöre dir, man hat mir die Karten fürs Planetarium gestohlen.« Die Frau, die vor ihr wartete, durchwühlte aufgeregt eine kleine schwarze Handtasche, die der von Ernestine zum Verwechseln ähnlich sah.
»Wie kann das sein? Wenn jemand den Schnappverschluss geöffnet hätte, wäre dir das doch aufgefallen!« Der Mann neben ihr schenkte seiner Frau kaum Beachtung, sein Interesse galt der Schiefertafel beim Ausschank. Dort waren die angebotenen Getränke samt den Preisen aufgelistet. Sein begehrlicher Blick richtete sich auf den Grünen Veltliner, von dem drei verschiedene zur Auswahl standen. Einer von einem Winzer am Nussberg, einer vom Cobenzl und einer aus Klosterneuburg.
»Aber wenn ich dir doch sage, dass die Karten weg sind. Jemand muss uns beobachtet und sie mir nach dem Eingang gestohlen haben.«
»Unsinn!«
Das Ehepaar war nun an der Reihe, seine Bestellung aufzugeben. »Was willst du trinken?«
»Die Karten fürs Planetarium sind weg!«
»Einen Grünen Veltliner? Oder lieber einen Gemischten Satz?«
»Hörst du mir eigentlich jemals zu?« Die Frau wurde lauter. Ihre blond gefärbten Strähnen, die einen unnatürlichen Gelbstich aufwiesen, hatten sich aus ihrem Haarband gelöst. Verschwitzt klebten sie ihr an der Stirn. »Ich habe mich so gefreut, dass ich Karten für die Ausstellung und die Vorführung im Planetarium bekommen habe. Das war keine Selbstverständlichkeit. Diese Karten sind etwas ganz Besonderes. Ich habe sie bloß ergattert, weil ich Beziehungen habe.«
»Ich nehme dir auch einen Gemischten Satz. Der soll gut sein.«
»Ich pfeif auf den Wein«, schrie die Frau jetzt so aufgebracht, dass auch ihr Mann von ihr Notiz nahm.
»Sag, hast du narrische Schwammerl gegessen? Was ist los mit dir?«
»Jemand hat mich bestohlen. Die Karten waren im Außenfach meiner Handtasche. Bei der Kassa hat man mich gewarnt, ich soll darauf aufpassen. Darum hab ich beide Karten dort stecken lassen. Und jetzt sind sie weg. Jemand anders wird jetzt das Himmelstheater sehen.«
Der Bursche beim Ausschank, er war gerade mal fünfzehn oder sechzehn Jahre alt, sah seine Kunden fragend an. »Was darf’s sein?«
Die Frau schüttelte den Kopf, ihr war die Lust auf Wein vergangen. Was ihren Mann nicht daran hinderte, zwei Gläser vom Gemischten Satz vom Nussberg zu bestellen. Sobald er bezahlt hatte, war Ernestine an der Reihe. Sie orderte ihr Himbeerkracherl, das sie gleich darauf in der Hand hielt.
»Brauchen Sie Hilfe?«, fragte sie die Frau, die den gesamten Inhalt ihrer Handtasche auf einen der Stehtische gekippt hatte. Eine Geldbörse lag neben einem Kamm, einem Lippenstift, einem Taschenspiegel, einem Taschentuch und mehreren Zitronenzuckerln in knallgelbem Papier. Eintrittskarten waren keine dabei.
»Jemand hat mir die Karten für die Vorstellung im Planetarium aus der Tasche gezogen«, wiederholte die Frau aufgebracht. Ihr Hals war mit roten Flecken übersät.
»Kann es sein, dass Sie die Karten in Ihre Westentasche gesteckt oder Ihrem Mann gegeben haben?«, überlegte Ernestine. Sie dachte darüber nach, wo sie Dinge hinsteckte, wenn sie in Gedanken versunken war.
»Nein, das kann nicht sein«, meinte die Frau. »Ich habe sie ganz bestimmt in meine Tasche gegeben. Und zwar hierhin.« Sie zeigte auf das Außenfach. »Ich kann mich ganz genau daran erinnern.«
»Sei nicht traurig, Grete. Hier, trink einen Schluck«, meinte ihr Mann tröstend. »Ich versprech dir, dass wir an einem anderen Tag ins Planetarium gehen. Heute gibt es noch so viele schöne Attraktionen, es wird uns gewiss nicht langweilig. Die Sonne scheint warm, da wollen wir doch nicht in einem abgedunkelten Raum sitzen.« Er selbst hatte sein Glas auf einen Zug fast geleert.
»Ich wollte aber ins Planetarium«, beharrte die Frau. Sie klang nicht mehr ganz so verzweifelt und nahm das angebotene Glas Wein entgegen. Auch sie trank einen kräftigen Schluck. Der Rebsaft zeigte rasch Wirkung. Ihr Gesicht hellte sich auf, und sie räumte die Tasche wieder ein.
»Sie könnten zum Planetarium gehen«, riet Ernestine. »Wenn zwei Plätze frei bleiben, ist klar, dass es sich um Ihre handelt. Dann haben Sie die Karten bloß verloren. Bestimmt würde man Ihnen den Eintritt nicht verwehren.«
»Ich habe die Karten nicht verloren«, erklärte die Frau voller Überzeugung. »Jemand hat sie gestohlen. Und dieser Jemand wird sie gewiss nicht wieder hergeben.«
»Ich dachte, du hättest die Karten unter der Hand bekommen und nichts dafür bezahlt«, sagte der Mann. »Wir haben also kein Geld verloren. Das ist doch schon mal gut.«
»Ich habe mich so darauf gefreut.«
»Komm, Gretchen!« Ihr Mann legte seinen Arm um die breite Hüfte seiner Frau und zog sie mit sich. »Wir holen uns ein zweites Glaserl Wein und suchen uns ein lauschiges Platzerl unter einem der Sonnenschirme in der Nähe von der Musik.«
Die Frau trank einen weiteren Schluck und ließ sich von ihrem Mann wegziehen.
Ernestine sah den beiden kurz nach, dann versicherte sie sich, dass ihre eigene Handtasche zu war. Die Karten waren in Sicherheit, und das war gut so. Würde man sie ihr stehlen, dann würde sie sich nicht so schnell mit einem Glas Wein zufriedengeben, sondern beim Planetarium einen Wirbel machen. Gerade bei dieser Vorstellung sollte es ein Leichtes sein, herauszufinden, wer hineindurfte und wer nicht. Schließlich waren nur wenige Karten ausgegeben worden.
Nun, die Frau hatte ihren Rat in den Wind geschlagen. Doch die Karten des Ehepaars waren nicht Ernestines Problem, und sie hatte auch nicht vor, es zu ihrem zu machen. Gut gelaunt wandte sie sich einem Schild zu, das mit einem Pfeil zur Ausstellung wies. »Die moderne Wienerin«, stand darauf. Neugierig folgte Ernestine dem Hinweis in den Messepalast.
Hier tummelten sich noch mehr Besucher als in der Sonne vor dem Gebäude, und das, obwohl die Luft deutlich schlechter und der Lärm größer war. Ernestine schlenderte dennoch durch den Saal und hielt Ausschau nach Informationen über Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Frauen. Als sie den Stand der »Modernen Wienerin« erreicht hatte und vor einer Palette mit Haar- und Hautpflegeprodukten stand, rümpfte sie die Nase. Eine ganze Traube interessierter Damen hatte sich dort eingefunden. Alle wollten die Wässerchen und Salben ausprobieren, die Schönheit versprachen.
»Darf ich Ihnen unsere belebende Haarseife vorstellen?« Eine junge Frau, deren Augen mit einem Kohlestift umrandet waren, hielt Ernestine einen Tiegel mit einer senffarbenen Creme entgegen.
»Was, bitte schön, soll an glänzendem Haar und faltenfreier Haut modern sein?«, fragte Ernestine.
»Die Produkte sind einzigartig. Schon nach ein paar Anwendungen wird auch Ihr graues Haar in einem völlig neuen Glanz erstrahlen.«
»Danke, mein Haar glänzt auch so.«
Irritiert sah die Verkäuferin Ernestine an. »Ich gebe Ihnen eine kostenlose Probe mit.«
»Und ich verzichte.«
»Ich nehme die Probe!« Die Frau, die hinter Ernestine stand, reckte gierig die Hand nach der winzigen Tube. Zwei weitere Kundinnen drängten sich nach vorne, um die Produkte in Augenschein zu nehmen. Es handelte sich wohl um Mutter und Tochter, beide waren ausgesprochen attraktiv und hatten weder Haarglanzmittel noch Hautstraffungscreme nötig. Ernestine suchte das Weite.
Am nächsten Stand wurden zeit- und platzsparende Küchengeräte für die moderne Hausfrau angepriesen. »Erledigen Sie den Haushalt in der Hälfte der Arbeitszeit, um mehr Zeit für Ihren Mann und Ihre Kinder zu haben!«
Ernestine drehte sich nach allen Seiten. Warum hatten die Arbeiterbibliotheken hier keinen Stand? Im allerhintersten Eck fanden sich endlich Informationen über die beruflichen Möglichkeiten der modernen Frau. Schreibmaschinenkurse wurden angeboten. »Lernen Sie, mit dem Zehnfingersystem flink und geschickt zu tippen. Werden Sie eine fleißige Sekretärin und die Stütze eines erfolgreichen Chefs.«
Fassungslos starrte Ernestine das Plakat an.
»Stimmt was nicht?« Sie zuckte zusammen. Heide und Erich hatten sie entdeckt. Die beiden kamen eben von dem Stand mit den Küchengeräten, aber mit leeren Händen. Sie schienen nichts gefunden zu haben, womit sie den Haushalt in der Hälfte der Zeit erledigen konnten.
»Könnt ihr mir verraten, warum junge Frauen bloß die Stütze von erfolgreichen Männern werden sollen?«, schimpfte Ernestine. »Eine wirklich moderne Forderung wäre, dass sie in Zukunft in die Chefetagen aufsteigen.«
Bevor sie sich in Fahrt reden konnte, kamen Rosa und Fritzi auf sie zugelaufen. Mit etwas Abstand folgte Anton.
»Das Eis war köstlich«, schwärmte er. »Ihr habt etwas versäumt.« Mit gerunzelter Stirn sah er von einem ernsten Gesicht zum anderen. »Stimmt was nicht?«