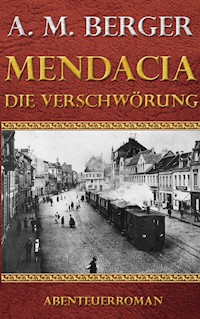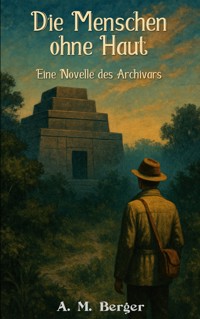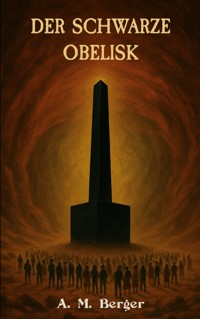Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Aus dem Archiv der Universität Thurikon
- Sprache: Deutsch
In diesem zweiten Band der "Aus dem Archiv der Universität Thurikon"-Reihe werden erneut absonderliche Kuriosa dargelegt, die in den Tiefen des Archivs der ominösen Universität Thurikon beherbergt sind. Geschichten im Stil der Weird Fiction, welche uns einen flüchtigen Blick auf das Groteske gestatten, das jenseits unserer vermeintlichen Realität auflauert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
V
ORWORT
U
MBERTO
D
IE VERLORENE
P
YRAMIDE
D
AS
H
AUS DES
A
LCHEMISTEN
D
IE ALTE
K
IRCHE
A
US DER
F
RÜHZEIT DER
U
NIVERSITÄT
T
HURIKON
D
ENOTH
VORWORT
War die Wissenschaft einstmals ein Werkzeug, um Licht ins Dunkel der Unwissenheit zu bringen, so hat sich der Sinn der verschiedenen Disziplinen zur Gewinnung neuen Wissens nun zum Erbauer eines schützenden Walls gewandelt, welcher uns davor bewahrt, dass die Realität, die wir gleich einem Kartenhaus für uns errichtet haben, nicht vom Wind der widersprüchlichen Einblicke zu Fall gebracht werde. Als aufwendiges Geflecht wird diese Realität aufgespannt und soll uns als Auffangnetz dienen, als dass wir nicht in die Tiefen des Zweifels und der Ungewissheit fallen.
Diese Realität wird von ihren Bewohnern gar gewaltsam verteidigt werden, denn es handelt sich dabei um die metaphysische Festung, die den wichtigsten Schutz vor gnadenlosen Angriffen auf die Wahrnehmung, die Erkenntnis und letztlich auch den Geist selbst erbringt. Die Fragen der Realität sind mitnichten Fragen von Logik und Erkenntnis, sondern ein Schlachtfeld, in welches ganze Armeen unter ihrem jeweiligen Banner zum Kampf marschieren.
Die kleine, oft unbeachtete, oft belächelte Universität Thurikon ist ein Réduit der Suche nach der immerzu schlüpfrigen Erkenntnis, welche, einstmals gefasst, sich nicht selten wieder verflüchtigen wird. In ihrem Archiv beherbergt die Universität Thurikon zahllose Aufzeichnungen, von sachlichen Berichten bis zu wirren Manuskripten, welche in irgendeiner Weise einen Anhaltspunkt auf das Wesen dieser Realität zu geben vermögen.
Es ist nicht die Leugnung der Unzulänglichkeiten in der menschlichen Wahrnehmung, welche am Ursprung dieses selbstauferlegten Forschungsauftrages stand, sondern das genaue Gegenteil, nämlich die Anerkennung dieses menschlichen Makels und die daraus resultierende Akzeptanz, dass die einzige Gewissheit letztlich die der Ungewissheit ist.
Während die Welt sich immer mehr in ihren weichen Kokon bequemer Gewissheiten verspinnt, keimt in der Universität Thurikon einer der wenigen verbliebenen Samen des Wissens; Samen, welche in den lang vergangenen Zeiten des Erwachens gelegt wurden, wohl nur deshalb, weil nicht abzusehen war, welch bittere Früchte dieser Baum tragen würde.
Hier nun weitere Geschichten aus dem Archiv der Universität Thurikon.
UMBERTO
1
Plötzlich stand er vor mir, der Mann, den ich nur als Umberto kannte. In seinen Händen hielt er ein schwarzes, ledergebundenes Buch, welches er mir gebracht hatte. Ungläubig schaute ich abwechselnd auf ihn und auf das Buch, welches zu finden ich ihm einige Wochen zuvor aufgetragen hatte, ohne eine ernsthafte Erwartung, es jemals tatsächlich vor mir zu haben.
Ein hämisches Lächeln zeichnete sich auf Umbertos zähem, schlecht rasierten Gesicht ab. Ein Gesicht, wie es nur einmal existieren konnte, zugleich jugendlich aber auch gealtert durch die Erfahrungen von jemandem, der alles andere als ein normales Leben führte; jemand, der seit er denken konnte nur daran war, jeden Rahmen des Gewöhnlichen und Alltäglichen zu durchbrechen und neue Horizonte anzuvisieren. Die Oberfläche von diesem Gesicht war gegerbt vom Wind und Wetter der seltsamsten Winkel dieser Welt, und jede der kleineren und grösseren Narben darauf schien eine eigene Geschichte erzählen zu wollen.
Ebenso eigensinnig war seine Kleidung, angefangen bei einem bunten Hemd mit Blumenmuster von zweifelhaftem Geschmack, dessen sommerliche Erscheinung in krassem Gegensatz zu dem grauen Jackett aus rauer Wolle stand, welches er darüber trug. Doch die buchstäbliche Krönung dieses Auftretens war der fast schon lächerlich erscheinende beige Sonnenhut, der allenfalls zu einem handelsüblichen Touristen gepasst hätte als zu diesem exzentrischen Charakter.
Überhaupt war Umberto ein Unikat, ein Mensch, wie er im 21. Jahrhundert gar nicht mehr existieren sollte, ein waghalsiger Abenteurer, stets umgeben von einer Aura des Geheimnisvollen, wie sie nur eine Person mit sich tragen konnte, die schon in die unglaublichsten Situationen gekommen war, die unbeschreiblichsten Ereignisse erlebt und die seltsamsten Sujets betrachtet hatte; allesamt Erfahrungen, von denen er wusste, dass er wohl als Geisteskranker weggesperrt würde, wenn er sie allen Ernstes von sich gäbe. In dieser Welt, in welcher man alles bereits bekannt und erforscht gemeint hätte, machte sich Umberto daran, immer wieder Neues zu entdecken.
Ich wandte mich an Umberto, wann immer ich auf der Suche nach den bizarrsten Kuriosa war, welche nicht einmal bei den geheimen Schwarzmärkten, auf denen Kunstwerke oder seltene Artefakte gehandelt wurden, anzutreffen waren. Und so war es ein offenes Geheimnis an der Universität Thurikon, dass meine Fakultät für arkane Anthropologie ein ausserordentlich grosses Budget für sogenannte Ermessensausgaben besass. Letztlich wusste jeder, dass nur über zweifelhafte Kanäle gewisse Gegenstände zu erhalten waren. Und schlussendlich war es die Ambition dieser kleinen, oft übersehenen Fakultät im Nordosten der Schweiz, sich ungeachtet sonstiger herrschender Auffassung oder Zeitgeist jedwedem Erlangen neuer Erkenntnisse hinzugeben.
Viele der absonderlichsten Artefakte, die über die Jahre in die Sammlung der Universität Thurikon gekommen waren, hatte Umberto ausfindig gemacht: Die einzig bekannte Photographie der über drei Meter grossen Riesenmenschen, welche sechs Finger an jeder Hand und sechs Zehen an jedem Fuss besassen, aufgenommen bei der einzigen ethnologischen Expedition, welche den ansonsten kaum studierten Malecha-Stamm im Dschungel von Yukatan erreichte, ein Stamm der kurz nach seiner Entdeckung im Jahre 1876 von einem verheerenden Flächenbrand vernichtet wurde. Auf dem Bild war dieses Ungetüm zu sehen, welches auf den ersten Blick wohl den Eindruck eines normalen Menschen gemacht hätte, wenn es nicht umgeben von normalgrossen Personen gewesen wäre, welche im Vergleich so klein wie für jede normale Person ein kleines Kind erschienen.
Das Notizbuch, welches dem Alchemisten Johann Gabriel von Hohenklingen zugeschrieben wurde, worin dieser im frühen 19. Jahrhundert seine Forschungen aufgezeichnet hatte an den gespenstischen Erscheinungen, die man gewöhnlich als Woüti bezeichnete, und von welchen über den ganzen Alpenraum hinweg seit Jahrhunderten berichtet wurde. Doch nur Johann Gabriel von Hohenklingen hatte sich jemals daran gemacht, den Versuch eines wissenschaftlichen Traktates zu unternehmen, und seine Erkenntnisse, wenn auch unvollständig, waren bei weitem die umfangreichsten.
Ein metallenes Artefakt in Form einer perfekt runden Scheibe, um die vier Finger dick und dem Durchmesser eines Tellers, welches in einer abgelegenen Höhle in Japan nach einem Einsturz entdeckt wurde und welche sich, trotz ihres Alters und der Verschüttung, in absolut makellosem Zustand befand. Gemäss der Forschung des Aloysius Nepomuk Burgmüller, einem eigenwilligen Forscher, welcher im frühen 20. dank der Unterstützung der Universität Thurikon diverse Expeditionen unternehmen konnte, und dessen Entdeckungen zu gewisser Notorietät in der Presse der Zeit führte, würde es sich dabei um das Herzstück einer arkanen Gerätschaft handeln ähnlich einer, welche er selber einstmals entdeckt und der Öffentlichkeit vorgeführt hatte. Jedoch verschwand diese Gerätschaft zusammen mit ihm und seiner ganzen Expedition im Jahre 1909. Verschiedene Experimente mit elektrischen Schwingungen hatten eine messbare Reaktion durch das Artefakt erzeugt, jedoch konnte weder Sinnhaftigkeit noch Zusammensetzung bisher geklärt werden.
Solche Objekte, die allesamt unserer Wissenschaft und Historiographie widersprechen, welche gar überhaupt nicht existieren dürften, hatte Umberto für mich ausfindig machen können. Ich scherte mich wenig darum, ob dieser Unsinn, der sich Geschichtsschreibung schimpft, von dem schon Napoleon sagte, es sei nur ein Haufen Lügen auf den man sich geeinigt hatte, nun verändert wurde oder nicht. Als Mann der Wissenschaft ging es mir nur darum, neue Erkenntnisse zu sammeln, und mich der Wahrheit, so es irgendwie möglich war, zu nähern. Eine dieser Erkenntnisse war es wohl auch, dass die meisten Menschen in einer konstanten, unermesslichen Angst leben, welcher sie sich selber kaum bewusst sind, und folglich all das, was auch nur im Mindesten an ihrem Konstrukt der Realität rütteln würde, mit aggressiver, gar gewalttätiger Vehemenz abgelehnt würde.
Und so stand nun Umberto vor mir in meinem winzigen Büro, nachdem ich ihm eine Aufgabe gestellt hatte, von der ich eigentlich gemeint hatte zu wissen, dass er sie niemals würde erfüllen können. Umberto legte einen unheimlichen Wert auf seine Ehrenhaftigkeit, und nahm jegliche Bezahlung, samt Spesen, erst in voller Menge nur bei Erfüllung des Auftrages entgegen. Dem musste ich jetzt gerecht werden, doch ich tat es ohne Ärgernis oder Ressentiment, denn mir dieses Buch beschafft zu haben, war jeden letzten Rappen wert.
Ich war bei meinen Forschungen auf einen äusserst seltsamen Bericht von 1948 gestossen, in welchem von einem Einbruch in der Zürcher Villa eines Herrn Helbling, einem reichen Rentier, die Rede ist, und wobei seltsamerweise kaum irgendwelche seiner zahlreichen und wertvollen wie auch seltenen Sammlungsstücke entwendet wurden, mit der explizit erwähnten Ausnahme von einem „schwarzen Buch“, wie der Bericht Helbling zitiert. Ich machte mir nicht viel aus diesem Bericht, bis ich ihn mit einer alten Zensurkarte der Cantonalpolizeywache von 1842 in Verbindung brachte, auf welcher neu herausgegebene Bücher eingetragen wurden, die nach ihrer Prüfung entweder freigegeben oder zensiert worden waren. Ein Titel sprang mir sofort ins Auge: Unaussprechlichen Kulten, mit Angabe des Autors Junzt, F. W. von; freigegeben mit Vorbehalt.
Ich recherchierte weiter und brachte in Erfahrung, dass der sonst weitgehend unbedeutende Herausgeber von Flugblättern und Lokalzeitungen Druckwerke J. J. Grünlich im Jahr 1842 tatsächlich eine Ausgabe für den schweizerischen Markt von Von Junzts Unaussprechlichen Kulten veröffentlicht hatte. Den Kreis schloss schliesslich ein Pamphlet aus den 50er Jahren, betitelt Chronik des Schwarzen Buches in der Schweiz und dessen Verbleibes, welches ich in den Tiefen der zahllosen Kisten im Keller des Archivs der Universität Thurikon gefunden hatte, worin sich all die Dokumente befanden, welche noch nicht indiziert waren. Auf diesem Pamphlet, welches wohl von Forschungen aus der Universität selber stammte, wurde das Schicksal aller verkauften Exemplare der Grünlich-Version nachverfolgt. Ein kurzer Text, denn es waren gerade mal eine Handvoll verkauft worden. Die meisten davon gingen schon sehr früh verloren oder wurden zerstört, bis schliesslich nur von einem Exemplar bekannt ist, dass es bis ins 20. Jahrhundert erhalten blieb. Dieses Exemplar war in der Sammlung eines Herrn C. J. Helbling.
Im Gegensatz zu der berüchtigten englischen Bridewall Übersetzung von 1845 sowie der stark gekürzten amerikanischen Ausgabe der Golden Goblin Press von 1909 sollte es sich, gemäss Dokumenten des Herausgebers, um eine vollständige Version des Originals von 1839 handeln. Hierfür wäre ein mutmasslicher Erbe des Autors auf Grünlich zugekommen, um das Werk in der Schweiz mit Hoffnung auf weniger strikte Kontrollen erneut veröffentlichen zu können. Der Herausgeber schien hier wiederum seine Gelegenheit gesehen, in den Buchdruck zu expandieren. Als sich später jedoch herausstellte, dass diese Person lediglich ein Hochstapler sei, der in den Besitz einer der Erstausgaben des Unaussprechlichen Kulten gekommen war, wurde der Druck nach nur einigen Dutzend Exemplaren eingestellt. Die darauffolgenden finanziellen Probleme infolge der vorangegangenen Investition trieben Druckwerke J. J. Grünlich in den Ruin.
Die Möglichkeit, eine gänzlich der Erstausgabe entsprechende Version des Unaussprechlichen Kulten in ursprünglich deutschsprachiger Fassung zu erhalten, schien mir wie ein Wunschtraum, wenn auch zugleich weniger ätherisch, als die Möglichkeit, an eine tatsächliche Erstausgabe zu kommen, welchem ich schon seit langem entsagt hatte. Und so gab ich meine Forschungsergebnisse an Umberto weiter, mit dem Auftrag, dieses Buch ausfindig zu machen, und mich stets in der vermeintlichen Sicherheit wägend, dass dies sein Knackpunkt sein würde; die Aufgabe, bei welcher er schliesslich mit aller Demut vor mir auftreten müsste, um zu sagen, dass es ihm unmöglich gewesen war.
Denn es war inzwischen fast schon wie ein Spiel geworden, worin Umberto mir ein seltenes Artefakt besorgte, und ich ihm ein anderes, noch selteneres in Auftrag gab, immer unter der Betrachtung, ob er dieser neuen Herausforderung wohl auch gerecht werden könnte, oder letztlich daran scheitern würde. Und so hatte ich nun vor mir das sagenumwobene schwarze Buch, von welchem ich mir nie hätte träumen lassen, es jemals in Händen zu halten.
Einige Wochen zuvor hatte ich Umberto losgeschickt, dürftig ausgerüstet mit Faksimiles der Zensurkarte von 1842, der Chronik des Schwarzen Buches in der Schweiz und dessen Verbleibes und des Zeitungsberichtes von 1949 über den Einbruch bei Herrn Helbling.
Eine solche Kriminalgeschichte aus längst vergangenen Zeiten war für Umberto wie geschaffen, um sich den Rat von seinem altem Freund Fedor heranzuziehen. Auch für ihn hatte Umberto immer wieder seltene Artefakte und Dokumente aus der Kriminalgeschichte besorgt, jedoch nicht wie bei mir im Austausch für ein Entgelt, sondern im Gegenzug zu Fedors verlässlichem Rat bei allen Fragen, die Kriminalgeschichte betrafen.
Fedors kleines Haus, malerisch in der Nähe des Greifensees gelegen und vom Rest der Welt durch ein kleines Waldstück abgeschottet, beherbergte ein so seltsames wie morbides Sammelsurium der Kriminalgeschichte. Viele Regale standen voll mit Bändern, welche unterschiedliche Kriminalakten zusammentrugen. Statt Bildern hingen an der Wand eingerahmte Zeitungsausschnitte, welche über berühmte Kriminalfälle berichteten. Und in einer Vitrine fanden sich alte Beweisstücke und sogar die eine oder andere Mordwaffe.
Selbst Umberto wusste nicht, wie Fedor zu seiner ungewöhnlichen Besessenheit gekommen war. Er wusste nicht einmal, worin Fedor beruflich tätig gewesen war bevor er, wie er selbst sagte, Frührentner geworden war. Doch Umberto hegte den Verdacht, dass es womöglich nicht gerade eine Tätigkeit seitens der Bekämpfung des Verbrechens gewesen wäre.
„Ah ja, der Einbruch bei Helbling im ’49, der kommt mir gleich bekannt vor“, sagte Fedor als er den Zeitungsausschnitt überflog, den Umberto ihm präsentiert hatte. „Dieser Zeitungsbericht ist noch ganz zu Beginn der Ermittlung, einige Zeit später begann man schon anzunehmen, dass es das Werk vom berüchtigten Zwyssig gewesen war.“
„Zwyssig?“,fragte Umberto.
„Fastolf Zwyssig, eine kleine Legende unter den Einbrechern der Nachkriegszeit“, erklärte Fedor, „er begann während des Krieges mit einer zusammengewürfelten Verbrecherbande Militärgüter zu stehlen. Nach Ende des Krieges verselbständigte er sich und war vor allem als Einbrecher in Häusern der reichen Herrschaften tätig. Der Einbruch bei Helbling ist interessant, insofern kaum etwas wertvolles entwendet wurde, obwohl da so einiges herumlag, was sich gelohnt hätte mitzunehmen. Es scheint, er hatte es auf ein spezifisches Objekt abgesehen.“
„Ein Buch“, sagte Umberto. „Hat man Zwyssig dann gefasst?“
„Ja“, sagte Fedor, „das heisst, viele Jahre später. Bei diesem Fall gab man bald schon auf, nach Zwyssig zu suchen. Die Spuren führten alle ins Leere.“
„Dann blieb der Fall ungelöst?“
„Die Ermittlung war nicht ganz unergiebig“, antwortete Fedor, „die Polizei ging der Spur einiger seiner Komplizen nach, bis man sie in einer kleinen Berghütte im Alpstein ortet. Aber dort findet man nur noch ihre halb verwesten Leichen. Sie hatten sich vor dem Winter dort versteckt, aber die Vorräte haben nicht gereicht als der Schnee kam. Sie sind wohl erfroren oder verhungert. Oder beides.“
„Schauderhaft“, sagte Umberto, ohne eine Miene zu verziehen, „und was wurde aus Zwyssig?“
„Nun, Zwyssig wurde einige Jahre später aufgegriffen, nachdem ein anonymer Anruf bei der Polizei einging, der seinen Standort verriet. Wahrscheinlich ein vergraulter Komplize, man sieht ja, wie er mit denen umging. Die Polizei stürmt das alte Lagerhaus, wo er sich verstecken soll, und findet ihn seelenruhig an einem Tisch sitzend beim Abendessen. Ohne irgendeinen Widerstand, ohne Fluchtversuch, können sie ihn festnehmen. Völlig ungewöhnlich für einen Kriminellen, der für seine energische Art bekannt war, und der mehrmals der Polizei entkam, als diese ihn schon umzingelt hatte.“
„Und seine Beute?“, fragte Umberto.
„Nichts hat man im Lagerhaus gefunden, nicht einmal ein paar Münzen. Man hat natürlich versucht, in der Vernehmung etwas über das Diebesgut herauszubekommen, aber er hat nichts von sich gegeben, was irgendwie relevant wäre. Tja, und dann...“
„Ja?“, fragte Umberto gespannt.
„Und dann stirbt Zwyssig urplötzlich in der Untersuchungshaft“, sagte Fedor, „angeblich an einem Herzinfarkt.“
„Wie passend“, spottete Umberto.
„So stand es zumindest im Bericht“, meinte Fedor hämisch, „aber jetzt pass auf: Es wurde zwar damals nie in Betracht gezogen, aber aus den Dokumenten lässt sich entnehmen, dass es womöglich gar nicht der echte Zwyssig war, den sie festgenommen haben, sondern ein Hochstapler.“
„Und der hat sich einfach als Zwyssig ausgegeben, als dass man ihn ins Gefängnis stecke, anstatt den Echten zu verpfeifen? Ach komm“, sagte Umberto.
„Die Sache ist die, und es ergibt einen Sinn: Zwyssig hatte den Ruf eines Hypnotiseurs“, erklärte Fedor, „mehrmals hat er Komplizen dazu gebracht, irgendwelchen Stumpfsinn zu machen, den niemand freiwillig tun würde.“
„Also hat er irgendeinen armen Teufel an seiner Stelle ans Messer geliefert?“, fragte Umberto.
„So sieht’s aus“, sagte Fedor.
„Grausig“, sagte Umberto, „und der echte Zwyssig?“
„Wer weiss“, meinte Fedor, „wenn das tatsächlich nur ein Hochstapler war, dann wurde der echte Zwyssig nie gefasst.“
„Und so endet also die Geschichte von Fastolf Zwyssig, ohne dass wir jemals erfahren konnten, was aus dem gestohlenen Buch wurde“, sagte Umberto.
„In der Tat“, sagte Fedor, „aber ich sage dir ja, man hat bei diesem Einbruch auch nicht gerade eine Grossfahndung gemacht. Für die Polizei war es wegen dem geringen Wert der erbeuteten Güter wohl nicht lohnenswert. Helbling hatte da eine ziemlich andere Meinung, die er den Zeitungen gegenüber nicht verschwieg. Wenn du versuchen willst, etwas dazu herauszufinden, solltest du bei den toten Komplizen anfangen. Das war für die Polizei damals Grund genug, den Fall zu schliessen.“
2
Am Vormittag vom Tag darauf erreichte Umberto das Dorf Weissbad, gelegen am Fusse des Appenzeller Alpsteins. Das regnerische Herbstwetter raubte der sonst so einladend grünen Umgebung ihre Farbe, und bedeckte das Dorf in einem Mantel von grauem Nebel und geisterhafter Stille, die nur durch das Rauschen des stark gewachsenen Bachs durchbrochen wurde.
Im Gegenzug aber war die Dorfwirtschaft umso belebter. Es schien das ganze Dorf war dort zusammengekommen, um beim grosszügig fliessenden Bier zu lachen, zu jassen oder einfach über Gott und die Welt zu plaudern.
Als Umberto in die Wirtschaft eintrat, verstummten sogleich alle Stimmen im Raum, und die Köpfe drehten sich zu ihm, als wäre ein Geist durch die Tür gekommen. Grinsend hob sich Umberto seinen kleinen Sonnenhut vom Kopf und machte eine übermässig dramatische Verbeugung.
„Grüezi die Herrschaften, ich bitte um Herberge. Und ein Bier, wenn es geht.“
Sofort brach Gelächter aus. Umberto besass etwas, wovon ich nur hätte träumen können, nämlich eine angeborene Art, auf die Menschen freundlich und nicht bedrohlich zu wirken, sodass sie sich ihm schnell öffneten. Vor allem in diesen eigenbrötlerischen Bergdörfern war das eine wahrlich bemerkenswerte Gabe.
Umberto setzte sich zu einer Gesellschaft alteingesessener Herrschaften und konnte sich schon nach einer kurzen Weile ihre Sympathie für sich gewinnen. Als die Konversation in Richtung alter Anekdoten aus vergangener Zeit wandelte, nutzte Umberto die Gelegenheit, um den Fall von Zwyssig anzusprechen.
„Wissen sie, ich habe ja einstmals eine ganz spannende Geschichte mitbekommen, sie haben doch ganz bestimmt mal davon gehört“, sagte Umberto in die Runde, „als man den Räuber Fastolf Zwyssig hier gesucht hat, in den 40er Jahren.“
Einer der Herren, wohl um die achtzig Jahre alt, mit einem buschigen weissen Vollbart, welcher bisher wenig gesagt hatte, sondern eher nur an seinem Bier genippt und seine Pfeife geraucht hatte, meldete sich daraufhin zu Wort. Er sprach mit einem urigen Dialekt, der für Umberto schwer zu verstehen war, doch er liess sich nichts anmerken.
„Ich erinnere mich an diese Geschichte“, sagte der Alte mit Ehrfurcht in der Stimme, „ich war ein kleiner Bub von acht, neun Jahren damals. Die Polizei hat damals das ganze Dorf durchsucht, das hat den Leuten hier natürlich gar nicht gefallen. Dann sind sie weiter hinauf in die Berge, zur Tobelhütte. Die ist weit oben in den Bergen, in Richtung vom Säntis. Was dort gefunden wurde, wollten uns die Eltern damals gar nicht sagen. Aber wir Buben haben dann die Gerüchte aufgeschnappt, dass dort drei Leichen gefunden wurden. Die Eltern wollten nie darüber reden. Mein Vater hat mir eine saftige Ohrfeige gegeben, wo ich mal am Tisch gefragt habe, was denn passiert war.“
„Das muss wirklich ein einprägsames Ereignis gewesen sein“, sagte Umberto, als der alte Mann seine Ausführungen beendet hatte. „Hat denn die Polizei irgendetwas dort finden können? Ausser der drei Leichen, natürlich.“
Der alte zog einige Male an seiner Pfeife.
„Die Polizei hat gar nichts gefunden“, sagte er, „oder zumindest hat sich das so herumgesprochen.“
„Sie sind einfach wieder gegangen?“, fragte Umberto.
„Sie haben die Leichen mitgenommen. Das war keine dankbare Arbeit, diese Hütte zu putzen. Das durften natürlich die Leute aus dem Dorf machen. Aber. Diese Polizisten, die haben ja gar nicht richtig gesucht. Denn bei Putzen hat eine der Frauen aus Brülisau, die gekommen war zum Helfen, ein Notizbuch gefunden. Das wollte man der Polizei übergeben, aber als man nach Zürich telefoniert hat, da hiess es, der Fall sei ja längst abgeschlossen, und es täte ja nichts mehr zur Sache.“
„Tatsächlich“, sagte Umberto, grosse Faszination vorspielend, „und was haben sie dann mit dem Notizbuch gemacht?“
„Man wollte es nicht wegwerfen, also hat man es hier im Ortsmuseum versorgt. Das liegt sicher bis heute in einer der Kisten im Keller.“
„Kann man das denn ansehen?“, fragte Umberto, „ich finde diese Kriminalgeschichten unheimlich spannend, wissen sie.“
Der Alte zog an seiner Pfeife und nickte.
„Läuten sie mal beim alten Heiri, der wohnt im Haus neben dem Ortsmuseum. Der kann ihnen das sicher mal zeigen. Heute interessiert das ja sowieso niemanden mehr.“
Umberto folgte dem Rat des alten Mannes, und machte sich an diesem Nachmittag auf in Richtung des Dorfmuseums, welches nur einen kleinen Fussweg entfernt auf der anderen Seite vom Bach lag. Es hatte inzwischen aufgehört zu regnen, doch noch immer flossen erstaunliche Wassermassen durch den kleinen Bach.
Umberto lief die Hauptstrasse noch ein Stück weiter, bis zu dem Ort, wo man ihm gesagt hatte, er das Ortsmuseum finden könnte. Dieses war in einem unscheinbaren kleinen Haus untergebracht, kaum zu erkennen, ausser durch das kleine Schild am Zaun davor, auf welchem „Ortsmuseum Weissbad“ stand, geöffnet immer sonntags von 10 bis 16 Uhr. An dem Tag war zwar Donnerstag, aber, wie man ihm gesagt hatte, könnte der alte Heiri ihm helfen.
Umberto lief einige Schritte weiter zum nächsten Haus, in welchem gemäss dem Schild an der Klingel ein H. Keller wohnte. Umberto läutete, woraufhin ein kleiner, aber dafür umso breiterer älterer Herr aus dem Haus erschien. Umberto bat ihn, etwas im Ortsmuseum in Augenschein nehmen zu können, und nach einigem Flehen gab der alte Heiri nach, und holte aus dem Haus den Schlüssel für das Museum.
Das Innere des Museums war in etwa so, wie man es für ein solches Ortsmuseum erwartet hätte: Viele alte Photographien waren entlang der Wand aufgehängt, mit Erklärungen über die Wandlung des Dorfes. Viel altes Werkzeug aus der Landwirtschaft war ebenfalls ausgestellt, und in einer Vitrine waren an zwei Schaufensterpuppen die traditionellen Trachten der Region zu bestaunen.
Heiri machte grosse Augen, als Umberto ihn nach dem Notizblock aus der Tobelhütte fragte. Es störte ihn keineswegs, dass er dieses betrachten wollte, eher nur, dass heute sich noch jemand dafür interessieren sollte. Sie liefen in den Keller hinunter, wo viele Kisten voll mit alten Papieren und Dokumenten aller Art herumstanden. Dinge, die weder interessant genug waren, ausgestellt zu werden, noch nichtig genug, um sie zu entsorgen.
Aus einer der Kisten grub der alte Heiri ein kleines, gebundenes Notizbuch hervor, die Seiten völlig vom Alter vergilbt. Er nahm es mit nach oben, wo es einen kleinen Tisch gab, an welchen sich Umberto setzen konnte, um es zu lesen. Dieser blätterte durch einige Einträge und sonstiger Notizen bis zum allerletzten Eintrag:
27. November 1948
Hierzu ist es nun also gekommen. Jakob und Samuel sind tot. Sie haben es nicht lange ausgehalten, dieser aussichtslosen Situation ins Auge zu blicken. Ihre Wut und Verzweiflung sind schnell zu Wahn geworden, schliesslich gingen sie aufeinander los, mit allem, was sie kurzerhand als Waffe zweckentfremden konnten. Anfangs habe ich noch versucht sie zu beruhigen, einen Ausweg zu finden. Aber ich wusste selbst, dass das nur Wunschdenken war. Am Ende habe ich nur noch versucht sie davon abzuhalten, etwas Wahnwitziges zu tun. Und auch das konnte ich nicht auf ewig abwenden.
Was ich hier schreibe, wird sicherlich das letzte sein, was ich von mir gebe. Ich kann den Stift kaum noch halten. Meine Hände zittern, ich weiss nicht, ob wegen der Kälte oder dem Hunger. Der Schnee steht schon meterhoch draussen, ich bekomme nicht einmal die Türe mehr auf. Und selbst wenn, wäre es unmöglich, das Tal zu erreichen.
Wir sind hierhergekommen, um uns über den Winter zu verbergen. Zu spät haben wir aber bemerkt, dass es kaum Vorräte gab. Die wenigen Vorräte waren so aufgestellt worden, dass sie nach viel mehr aussahen, wodurch wir gar nicht bemerkten, wie knapp alles eigentlich war. Doch hinter den vorderen Holzstücken gab es nichts mehr, und die hinteren Kisten und Fässer sind auch alle leer. Als wir das bemerkt haben, war es schon längst zu spät.
Fastolf Zwyssig, du elendiger Hurenbock. Du hast uns ausgespielt. Erst sagtest du, wir sollen uns hier oben verstecken, während du dieses verfluchte Buch loswirst. Und hier war alles schon so ausgelegt, dass wir viel zu spät bemerken, dass wir festsitzen. Mit meinem letzten Atemzug verfluche ich dich, dich und diesen genauso elendigen Emil Walenburger, der uns diesen gottverdammten Auftrag gab. Euch alle soll der Teufel holen. Mich aber wird er wohl schon viel früher aufsuchen.
Die darauffolgende Seite war leer.
Umberto war bestürzt von dem, was er gelesen hatte, das grauenvolle Schicksal dieses Mannes, in seiner eigenen Handschrift festgehalten, und die Abgebrühtheit von Zwyssig, seine Komplizen so zu verraten.
„Düstere Geschichte“, sagte Umberto und schlug das Notizbuch zu. Der alte Heiri nickte nur. Doch ein wichtiger Hinweis war in diesem Text zu finden gewesen: Zwyssig hatte das Buch also im Auftrag eines gewissen Walenburger gestohlen. Das, so dachte Umberto, könnte auf den Verbleib des Buches hinweisen. Doch zuerst musste er herausfinden, wer Walenburger überhaupt war.
„Walenburger, sagst du?“, fragte Fedor am Telefon, „in der Akte zum Einbruch bei Helbling wird er nicht erwähnt. Wie kommst du darauf?“
Umberto sass in seinem Auto, einem alten, dunkelroten Citroën 2CV, im Volksmund auch „Ente“ genannt, und telefonierte mit Fedor während der Regen auf die Scheibe prasselte. Die Strassen von Weissbad waren menschenleer, oder zumindest hätte man das meinen sollen. Doch Umberto schaute immer wieder um sich, mit dem seltsamen Gefühl, beobachtet zu werden, obgleich er nichts erkennen konnte, was diese Vorstellung bestätigt hätte.
„Ich habe das Notizbuch von einem der Komplizen lesen können“, sagte Umberto.
„Wirklich?“, sagte Fedor erstaunt, „aber es steht doch nichts von einem Notizbuch in der Akte.“
„Die Polizei war damals nicht sehr gründlich gewesen“, erklärte Umberto, „offenbar sind sie gekommen, haben die Leichen abtransportiert, und damit war fertig. Das Notizbuch haben die Einheimischen beim Putzen gefunden, und die Polizei hatte gar kein Interesse mehr daran.“
„Unfassbar. Man könnte fast meinen, sie hätten den Fall gar nicht lösen wollen“, meinte Fedor. „Ich habe hier übrigens was von wegen Walenburger, aus einem alten Telefonbuch von der Zeit. Er war damals als Professor für Archäologie an der Universität Zürich eingetragen. Vielleicht findest du im Stadtarchiv etwas heraus.“
Die Computer, welche im Stadtarchiv für Recherchen zur Verfügung standen, machten es ein Leichtes, herauszufinden wer dieser Walenburger gewesen war. Dieser war seit den 30er Jahren Professor für Archäologie gewesen und hatte sich an zahlreichen Ausgrabungen in den Alpen beteiligt. Mit den Jahren, offenbar in Konsequenz seiner Forschungsergebnisse, wandelte sich sein Schwerpunkt auf die Forschung des extremen Altertums.
Er formulierte Theorien, welche besagten, die Menschheit sei viele hunderttausende Jahre älter, als es die konventionelle Geschichtsschreibung erkenne, und folglich sei die ganze vermeintliche Entwicklung der menschlichen Zivilisation in Frage zu stellen. Diese Behauptungen stützte er mit einer Fülle an Artefakten und körperlichen Überresten, welche er bei Ausgrabungen entdeckt hatte.
Walenburgers Theorien kamen in seinem Feld nicht gut an, wenngleich auch kein Forscher seine Ergebnisse jemals widerlegen konnte. Während jeder Andere, der solche Ideen verbreitet hätte, schnell als Wirrkopf abgetan worden wäre, so erlaubte Walenburgers vorangehendes Prestige, dass er für diese unorthodoxen Ideen trotz allem gewisses Gehör fand.
Im Jahre 1951 nimmt seine Tätigkeit allerdings ein jähes Ende, als ihn eine geistige Erkrankung völlig unzurechnungsfähig macht. Innerhalb kürzester Zeit wandelt sich der eloquente und respektierte Professor zu einem völligen geistigen Wrack, sodass er letztlich in eine geschlossene Anstalt eingeliefert werden muss, wo er seine restlichen Jahre als hoffnungslos wahnsinniger verbringt.
Unter den Dokumenten, auf welche Umberto im Archiv zugreifen konnte, befanden sich auch einige Filmaufnahmen, welche 1954 in der Psychiatrie entstanden mit dem Zweck, den seltsamen Fall von Walenburger zu dokumentieren. Er spielte diese sogleich ab.
Der Vorspann war nüchtern gestaltet, mit lediglich einem weissen Text auf schwarzem Grund: FALLSTUDIE NR. B-837: PATIENT E. WALENBURGER. VERMUTETE PARANOIDE SCHIZOPHRENIE
Nach einigen Sekunden dieser Titelkarte, schnitt der Film auf ein schwarzweisses Bild von einem kargen Zimmer mit vergitterten Fenstern. Links unten im Bild war ein Mann in weissem Kittel zu sehen, der mit gekreuzten Beinen auf einem Stuhl sass. Vor ihm Stand ein anderer Mann von mittlerem Alter, mit grauen, zerzausten Haaren, in einer Art Schlafanzug gekleidet. Die Kamera hielt starr auf dieses Bild ohne irgendeine Bewegung.
„Wie geht es ihnen heute, Herr Walenburger?“, war vom Mann im Kittel zu hören. Der Mann drehte sich einige Male und schaute um sich, als suche er den Ursprung der Stimme, die er soeben gehört hatte.
„Wie geht es ihnen heute, Herr Walenburger?“, wiederholte der Mann im Kittel.
„Sie beobachten mich“, sagte Walenburger in leiser, zittriger Stimme, die nur schwer durch den rauschenden Ton der alten Aufnahmen zu hören war. „Sie schauen mich immer an. Überall.“
„Wer beobachtet sie?“, fragte der Mann im Kittel mit ruhiger Stimme.