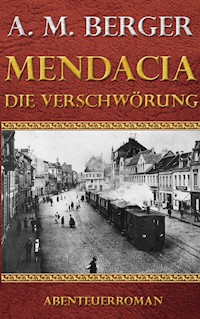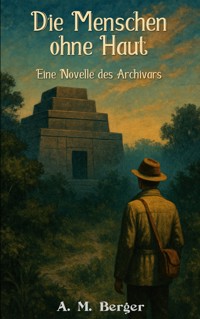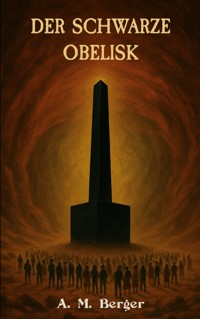Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Aus dem Archiv der Universität Thurikon
- Sprache: Deutsch
Erschreckende Ereignisse in den Bergen, eine seltsame Statuette, Teufelsbeschwörungen oder ein Videospielkabinett, das sind einige der Elemente die sich in den Erzählungen finden, welche die ominöse Universität Thurikon in ihrem Archiv beherbergt. Vier Geschichten dokumentieren bizarre Vorfälle, die die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn verschwimmen lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist H. P. Lovecraft gewidmet.
INHALTSVERZEICHNIS
V
ORWORT
D
AS
U
NHEIL VON
B
RÜNIG
D
ER GEFALLENE
E
NGEL
D
IE OSMANISCHE
A
THENE
P
OLYBIUS
VORWORT
Vor kaum etwas sträuben wir uns so sehr, wie vor einer Einsicht, die unsere Erkenntnis der Realität auf den Kopf stellen könnte. Solch ein Einblick zieht uns den Boden unter den Füssen weg und entreisst uns den Haltepunkt unserer Wahrnehmung eines unüberschaubaren Universums.
Der Mensch eignet sich mit stetig wachsender Geschwindigkeit neues Wissen an, doch zugleich wächst auch das Bewusstsein darüber, wie viel wir eigentlich nicht wissen. Anstatt dass die Urangst vor dem Unbekannten bezwungen werde, schleicht sie sich an uns heran, um dann, wenn wir es am wenigsten erwarten, über uns herzufallen wie ein Raubtier, uns keinen Ausweg vor der grauenvollen Erkenntnis zu lassen, dass wir wie ein Schiff im Nebel segeln, uns nach einem Leuchtturm sehnen, aber nur Irrlichter finden.
Zugleich wächst unsere Hybris zu meinen, dass wir die Herren über Himmel und Erde sind, dass wir in dieser Realität das letzte Wort haben, und umso grösser wird die Verzweiflung, wenn das Universum uns eines Besseren belehrt, und uns unserer Bedeutungslosigkeit und Unwissenheit ermahnt.
Die Erkenntnisse, welche nicht existieren sollten, werden tief vergraben, auf dass sie, wenn sie aus unserer Wahrnehmung verbannt werden, auch aus der Realität verschwinden.
In der unscheinbaren Universität Thurikon, im gleichnamigen Dorf des Nordostens der Schweiz gelegen, beherbergt das Archiv einige Berichte und Beschreibungen von schwer einzuordnenden Vorfällen. Es sind Erzählungen, die die Grenzen unserer Kapazität, die Realität zu begreifen, überschreiten, und uns mit dem überwältigenden Gedanken konfrontieren, dass diese Realität womöglich viel weitreichender, komplexer und erschreckender ist, als dass wir es uns jemals hätten vorstellen können. Es ist ein unausgesprochener Pakt unter den hellen Geistern, dass diese Geschichten verborgen bleiben, auf dass sie nicht an unserer Realität, oder zumindest an dem, worauf wir uns als vermeintliche Realität geeinigt haben, zerren können.
Hier nun sind vier dieser Geschichten aus dem Archiv der Universität Thurikon.
DAS UNHEIL VON BRÜNIG
1
Ich sortierte den Nachlass von Samuel Reber Willemsen, welcher im Dachboden meiner kürzlich bezogenen Wohnung liegen geblieben war, als durch einen Zufall das ominöse Manuskript in meine Hände fiel. Ich wusste nicht viel von Herrn Reber Willemsen, ausser, dass er einstmals Journalist gewesen und in ebendieser Wohnung an einer unbenannten Krankheit gestorben war. Seine letzten Monate wären nicht nur der Krankheit wegen voller Pein und Kummer gewesen, und wie ich diese, seine Niederschrift las, war mir letztlich nachvollziehbar, wie dies wohl hatte zu Stande kommen können, obgleich ich wohl niemals mit Genauigkeit werde aussagen können, ob all dies sich nun tatsächlich so, wie es beschrieben wurde, zugetragen hatte, oder ob es alles nur ein Auswuchs eines pathologischen Geistes gewesen sei. Aus diesem Grund ist es sicherlich das Angemessenste, wenn ich die Zeilen von Herrn Samuel Reber Willemsen selber sprechen lasse, welche hier nun wiedergegeben sind:
Aufzeichnungen zum Vorfall am Brünigpass im Jahre 1996, von Samuel Reber Willemsen.
Ich hatte nicht vor, meine Erlebnisse niederzuschreiben, denn ich meine, dass kein Mensch, der bei klarem Verstand ist, mir diese Erzählung glauben würde. Doch nun wie ich durch die seltsame Erkrankung, die aus diesem Zwischenfall hervorging, beinahe vollkommen an mein Bett gefesselt bin, so habe ich entschieden, meine Erinnerungen doch noch festzuhalten, auf dass sie der Nachwelt, falls diese einstmals daran Teil haben wollte, erhalten blieben.
Dass ich dazu kam, den Vorfall am Brünigpass aus der Nähe verfolgen zu können, begann mit meiner Anstellung bei der Schaffhauser Zeitung, einem kleinen Blatt mit zugegeben begrenzten Mitteln, welches in dieser nördlichen Gegend der Schweiz gelesen wurde. Als gebürtiger Zürcher war es schon fast eine Peinlichkeit, bei einer kleinen, unbedeutenden Regionalzeitung im urigen Schaffhausen tätig zu werden, und erntete mir nicht wenig Spott von meinen einstigen Studienkollegen, deren Ambition es war, in den grossen Medien unseres Landes, oder sogar des benachbarten Deutschlands tätig werden zu können, um mit ihrer Berichterstattung die Medienlandschaft zu prägen. Ich möchte sagen, dass mir diese Arbeit bei einem regionalen Medium eine wichtige Erfahrung bedeuten sollte, doch bin ich selber nicht sicher, ob dies nun wahrheitsgetreu wäre, oder ob es nur eine Bewältigung meiner Situation gewesen wäre, worin ich auf die Arbeitsofferten bei den anderen, grösseren Medienhäusern verzichten musste, da diese zumeist nur ein Praktikum oder Volontariat anboten, während ich, im Fehlen eines familiären Umfeldes, welches mir finanzielle Unterstützung bieten könnte, auf einen vollwertigen Lohn angewiesen war. Und die Schaffhauser Zeitung war die beste Offerte, die mir einen Solchen bieten konnte.
Auch die Schaffhauser spotteten über diesen Zürcher Journalisten, der nun zu ihnen gestossen war, und ich konnte nicht immer genau erkennen, ob dieser Spott nur gutgemeinter Spass oder tatsächliches Ressentiment war, doch ich entschloss mich die Sprüche und Witze zu ignorieren und mich stattdessen voll und ganz meinem Metier zu verschreiben. Ich weiss bis heute nicht, ob der Chefredaktor mir schliesslich aus Vorliebe, weil er meine Arbeit schätze, oder Verachtung, weil er mich loswerden wollte, den Auftrag gab, der mich fern von Schaffhausen in die Zentralschweiz führte.
Es war um die Zeit, dass ein ambitiöses Bauprojekt gestartet wurde, das eines Scheiteltunnels unter dem Brünigpass für die zwischen Luzern und Interlaken verlaufende Nationalstrasse A8. Diese hätte zu einer neuen zusätzlichen Hauptachse des Strassenverkehrs in der Schweiz werden sollen, die, parallel zur Autobahn A1 verlaufend, diese entlastet hätte. Bekannterweise wurde dieses Projekt nicht nur niemals realisiert, sondern wurde auch jeder Hinweis darauf, dass es überhaupt jemals umgesetzt werden sollte, ausradiert. Massgeblich waren die unheilvollen Geschehnisse, welche ich dort erleben musste, dafür mitverantwortlich, obgleich sicherlich nicht ein einziger Beamter, Politiker oder Strassenbauingenieur ausfindig zu machen wäre, welcher dies offenkundig zugeben würde.
So also machte ich mich einstmals auf in Richtung des Brünigpasses, einer der wahrlich weniger notorischen Bergpässe der Schweiz, welcher den höchsten Punkt auf dem direkten Weg zwischen Luzern und Interlaken darstellte. Ich fuhr bis Luzern, wo ich auf die Brünigbahn umsteigen musste, die Schmalspurbahn, welche sich mithilfe mehrerer Zahnradabschnitte in vergleichsweise gemächlichem Tempo über den Brünigpass quälte. Ich hatte etwa genauso viel Fahrzeit von Zürich bis Luzern wie von Luzern bis Lungern, einem Dorf am Fusse der Brünigpasshöhe, von welchem aus ich die Bauarbeiten des Tunnels erreichen würde. Lungern, am gleichnamigen Lungernersee gelegen, war ein erbärmliches kleines Bergdörfchen, ohne den Charme der Dörfer am Zuger- oder Vierwaldstättersee, ohne gar einen erkennbaren Dorfkern, welches zwischen der Strasse und der Bahnlinie gewachsen war. Hier fand ich bei einer entfernten Verwandten von einem der Redaktoren der Schaffhauser Zeitung eine Bleibe, und ich ahnte, dass einer der Hauptgründe für meinen unüblichen Auftrag für die sonst eher regional ausgerichtete Zeitung der gewesen war, dass eine unentgeltliche Unterkunft zur Verfügung gestanden hatte.
Frau Hartmann, eine unendlich liebenswürdige alte Witwe, in deren geräumigem Landhaus, nicht weit von der Bahnstation, ich ein Zimmer für die Zeit meines Aufenthaltes beziehen sollte, grüsste mich herzlichst als ich ankam. Sie war eine kleine, etwas stämmige ältere Dame, wohl um die siebzig Jahre, mit einem runden Gesicht und grauem Haar, und sie bot mir für den Abend meiner Ankunft ein herzhaftes Nachtessen an, welches ich, ohne zu zögern, annahm. Lediglich Frau Hartmann, ihre Nichte, welche in Luzern studierte und folglich jeden Tag die langwierige Bahnfahrt auf sich nehmen musste, und ich sassen an diesem Abend zu Tisch, die einzigen Bewohner dieses grossen rustikalen Anwesens. Am nächsten Tag würde ich frühmorgens schon aufbrechen, um die Bauarbeiten aufzusuchen, und die Recherchen zu meiner Berichterstattung zu beginnen.
Die Region um den Brünigpass, im Herzen des Kantons Obwalden gelegen, schien gänzlich vom Rest der Welt vergessen zu sein. Obgleich dieser Ort im Zentrum der Schweiz gelegen war, genau auf dem Weg zwischen zwei der grossen Touristenpole, Luzern und Interlaken, so schien es, dem Auge eines Sturms ähnlich, Abseits jeglicher bedeutenden Aktivität, und verlieh mehr noch das Gefühl eines vergessenen Tals in den Bergen als so manche Region der Alpen, welche aufgrund der Touristischen Nachfrage inzwischen weitgehend erschlossen und bebaut worden waren. Und so wäre von diesem Ort, aus der rein geographischen Betrachtung, nicht unbedingt zu erwarten gewesen, dass er ein Hort von eigensinnigem Bergvolk sei, welche ungewöhnliche, teils sogar vorchristliche Traditionen und Bräuche am Leben erhalten würden, oder sich seltsame Legenden und Sagen erzählen. Jedoch fand ich genau eine solche geschlossene Gemeinde vor. Die Art von Dorf, wo die Menschen einen Fremden auf der Strasse unverhohlen anstarren, aber nur widerwillig grüssten; sich zurückziehen und die Fensterläden schliessen, wenn Aussenseiter sich dorthin verirren. Immer mit einer Stimmung, als würden sie uralte Geheimnisse hüten, von denen sie meinten, dass die Fremden diese entweihen würden, wenn sie in das Allerheiligste des Dorfes vordringen sollten. Dorfgemeinden, die sich wie ein Igel verschlossen, wenn sie eine solche Gefahr witterten, und deren wahres Leben niemals den Fremden preisgegeben würde.
Ich wollte den Einheimischen allerdings ihr Verhalten nicht übel nehmen, denn ich teilte nicht die kosmopolitische Überlegenheit der Flachländer, welche meinten, ihre gottlose, hedonistische, dekadente Lebensweise mache sie zu etwas Besserem, sondern meinte nachvollziehen zu können, dass diese Leute erkannten, welchen Wert ihre Abgeschiedenheit darstellte, fern vom Verderben der seelenlosen Moderne, die, so bin ich bis heute überzeugt, nichts anderes ist, als ein durch Bedeutungslosigkeit aufgefülltes Fehlen jeglicher Transzendenz oder Verbindung mit dem Land auf welchem man lebt, welches man Bepflanzt, oder auf welchem man das Vieh weidet.
Und so hielt ich es den Einheimischen auch nicht entgegen, dass sie mir aus dem Weg gingen, als ich mich am nächsten Morgen auf die kurze Wanderung bis zum Objekt meines professionellen Interesses aufmachte, dem Ort, wo sich der Fortschritt buchstäblich einen Weg durch die Ewigkeit der Berge zu bahnen versuchte. Mein Weg führte mich entlang der Hochebene, wo sich das Tal ausbreitete und rund um den Lungernersee weitläufig fruchtbaren Boden preisgab, und welche verborgen lag in einer Umgebung von Bergspitzen und Felswänden, als ob sich inmitten der abweisenden Felsen ein kleiner Paradiesgarten aufgetan hätte, bis hin zur erneuten Verengung dieses Tales, von wo aus sich die Strasse bis zur Passhöhe hinauf schlängelte. Meinen Anweisungen folgend, welche mir detailliert erklärt worden waren, verliess ich die asphaltierte Nebenstrasse in Richtung eines unbefestigten Weges, welcher sogleich in den Wald hineinführte. Hier hatte ich ein weiteres Stück dem noch ebenen Weg zu folgen, bis zur verborgenen Felswand, in welche der Tunnel gebohrt werden sollte.
Der Lärm von mächtigen Dieselmotoren, wie auch die Reifenspuren von Baugeräten im Boden deuteten darauf hin, dass ich auf dem richtigen Weg war, und tatsächlich tat sich mir sogleich nach einer Wegbiegung das Spektakel des rauen, nackten Fortschrittes auf, ein ganzer Ameisenhaufen von Bauarbeitern mit ihren Maschinen und Baustellencontainern, welche wie auf einer Bühne vor dem Hintergrund des bereits angefangenen Tunnelportals standen. Wie man die ganze Ausrüstung bis hierher transportiert hatte, war mir gleichwohl ein Geheimnis, da es keine grössere Zufahrtsstrasse zu geben schien, sondern nur den engen Weg, den ich gelaufen war.
Ich fragte den ersten Bauarbeiter nach meiner Kontaktperson, der treffend genannten Ingenieurin Laura Bergmann, und der Mann deutete, ohne ein Wort zu sprechen, auf einen der Bürocontainer, die in unmittelbarer Nähe des Tunnelportals aufgestellt waren. Als ich mich näherte, sah ich sogleich eine junge Dame, die von ihrem Schutzhelm abgesehen alltägliche Kleidung trug, und lautstark mit einem Bauarbeiter, scheinbar einem Vorarbeiter, diskutierte. Ich konnte allerdings unter dem Lärm des Motors eines leerlaufenden Kippfahrzeuges nicht ausmachen, was gesprochen wurde. Ich näherte mich, und nutzte den Moment, als die Diskussion endete, um auf die Dame zuzugehen. Ich wurde sogleich angeschnauzt, was ich auf der Baustelle zu suchen hatte, der Ton wurde aber etwas sanfter, als ich erklärte, dass ich der Journalist von der Schaffhauser Zeitung war. Ich wurde in den Bürocontainer geführt, wo Frau Bergmann mir erst mal einen Schutzhelm in die Hände drückte, welchen ich jederzeit zu tragen hatte. Anschliessend wurde ich hastig in der Baustelle herumgeführt, wo mir der Fortschritt und die Schwierigkeiten dieses Unterfangens erklärt wurden. Einzelheiten, welche ich nicht mehr im Sinn habe, da sie für mich schon damals nicht von grossem Interesse waren. Ich hatte mit in den Kopf gesetzt, dass diese Reportage in Form einer Allegorie über den Fortschritt, welcher sich rücksichtslos bis in die abgelegensten Regionen seinen Weg bahnt, präsentiert werden sollte. Dies würde ich meiner Gastgeberin natürlich nicht gerade unter die Nase reiben, stattdessen liess ich sie mir den Bau in allen Details präsentieren.
Die Bauarbeiter seien teils Italiener, wurde mir erklärt, aber auch einige Einheimische aus den umliegenden Dörfern, welche sich als Konsequenz einer deprimierten Wirtschaftslage zur Arbeit im Bau entschieden hätten. Die Arbeit kam bis zu diesem Zeitpunkt nur schleppend voran, da sich der Fels als erheblich härter als ursprünglich erwartet herausgestellt hatte. Aus diesem Grund hatte man sich dafür entschieden, Sprengungen vorzunehmen. Und genau an diesem Tag war die erste Sprengung vorgesehen, also war ich, so Frau Bergmann, gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Die ganze Baustelle bereitete sich nur noch darauf vor, den Sprengstoff, der bereits in den Felsen eingelegt worden war, zu zünden. Frau Bergmann wies die Arbeiter darauf an, ihre Positionen einzunehmen. Ich wurde gewarnt, dass jetzt gleich gesprengt würde. Einer der Bauarbeiter blies in eine kleine Trompete mit vier Hörnern als plötzlich aus dem Wald Rufe zu hören waren.
„Halt, ufhöre! Halt!“, rief eine männliche Stimme. Zwischen den Bäumen erschien ein Mann, wohl um die sechzig Jahre alt, von der altmodischen Aufmachung ohne Zweifel ein Einheimischer der umliegenden Dörfer oder Bauernhöfe.
„Nicht das schon wieder“, rief Bergmann aus und legte das Gesicht in die Hände. Es schien wohl, dass diese Art von Situation keineswegs neu war. Sie rief den Arbeitern zu, dass die Sprengung gehalten werde, während der Mann direkt auf sie zukam.
Dieser Mann sprach in einem für mich schwer verständlichen Dialekt, aber was ich von seinem aufgebrachten Gerede ausmachen konnte, war, dass die Bauarbeiten aufhören mussten, um wohl den Berg nicht zu stören, da sonst ein schreckliches Unheil über uns alle kommen sollte. Der Mann war fast hysterisch in seinem Verhalten, Bergmann aber blieb ruhig, griff ihn an den Schultern und führte ihn von der Baustelle weg. Der Mann gab bald nach, er sah wohl, dass seine Warnrufe vergebens waren, und beliess es dabei, im Weglaufen weiterhin seine Mahnungen zu proklamieren. Bergmann besprach derweil mit dem Vorarbeiter, ob die Sprengung endlich gezündet werden konnte. Nach einem kurzen Moment bejahte dieser schliesslich.
Erneut erklang ein erster Ton des Warnhorns, dann zweimal nacheinander. Anschliessend betätigte ein Arbeiter den Zünder, indem er an einem kleinen Kästchen eine Kurbel drehte. Kurz darauf waren mehrere dumpfe Knalle aus dem Berg zu hören, welche die Erde beben liessen, und eine Rauchschwade schoss sogleich aus dem Tunnelportal heraus, die uns alle umnebelte.
Als sich nach einer Weile die Staubwolke verzogen hatte, begann der Ameisenhaufen dieser Baustelle wieder zum Leben zu erwecken. Mehrere Arbeiter liefen hin und her, wohl um zu prüfen, dass alles richtig gelaufen sei. Frau Bergmann bot mir an, sie zur Prüfung der gesprengten Stelle zu begleiten, was ich trotz gewisser Vorbehalte letztlich nicht ablehnte.
Eine kleine Gruppe die aus Frau Bergmann, dem Vorarbeiter Urs, zwei Sprengmeistern und mir bestand, betrat den noch immer von Staub und Rauch befüllten Tunnel, und hatten um die hundert Meter zu laufen. Mir fiel auf, dass es schon nach wenigen Metern überraschend warm war, wo doch das Herbstwetter draussen ziemlich frostig war. Ich fragte Bergmann, ob die Wärme am Sprengstoff liege, doch sie verneinte, und erklärte, dass es wahrscheinlich Erdwärme war. Ich erkannte an ihrer Stimme aber, dass sie selber nicht von dieser Erklärung sehr überzeugt war, zumal ich auch meinte, ein Tunnel von kaum hundert Metern Tiefe könne unmöglich solche Mengen an Erdwärme freisetzen.
Der Nebel wurde immer Dichter wie wir uns an die gesprengte Stelle näherten, und machte das Atmen schwer. Wir hielten uns Tücher vor Mund und Nase, um nicht allzu viel der Schadstoffe einzuatmen. Bald waren vor uns viele Steinbrocken zu erkennen, die auf dem Boden lagen, offensichtlich aus dem Berg gesprengt. Mit unbestreitbarem Stolz schauten Bergmann und ihre Vorarbeiter auf ihr Werk, die Sprengung war phänomenal gelungen, und hatte ein ganzes Stück freigelegt. Nun müsste nur noch der Schutt abgetragen werden, und man könnte die nächste Sprengung angehen. Bergmann wollte mir gerade erklären, wie die Sprengungen gehandhabt wurden, als ich plötzlich aus dem Augenwinkel sah, was nach einer grossen Stichflamme aussah. Ich drehte mich sofort um, und sah nur noch, wie einer der Sprengmeister von Flammen umhüllt war. Er versuchte noch ein paar Schritte zu laufen, nur um kurz darauf völlig verkohlt hinzufallen.
Erst Bergmanns Rufe holten mich aus meiner Schockstarre: „Gas! Alle raus, sofort!“
2
Ich rannte so schnell ich konnte durch den noch vernebelten Tunnel nach draussen, und während ich lief meinte ich plötzlich im Vorbeirennen eine seltsame Erscheinung gesehen zu haben: Es schien wie ein Strohballen, vielleicht etwas weniger als einen Meter hoch, doch lag es nicht reglos am Boden, sondern schien sich tänzelnd hin und her zu bewegen, und die losen Strohhalme, aus denen es bestand, flatterten mit jeder Bewegung herum. Diese Erscheinung begleitete mich mit ihren tänzelnden Bewegungen kurzzeitig, und obgleich ich zweifelte, ob ich tatsächlich im Nebel und der Dunkelheit des Tunnels etwas gesehen hatte, so schien es mir vollkommen real und klar definiert, als dass es nur ein Gespinst von mir gewesen wäre.
Draussen hatte sich unter den anderen Arbeitern bereits ein kleiner Aufruhr gebildet, da sie die Rufe gehört hatten, und anschliessend sahen wie unsere kleine Gruppe aus dem Tunnel gerannt kam. Der Vorarbeiter Urs, der mit uns im Tunnel gewesen war, war ein Mann um die vierzig Jahre und von türmender Grösse, wohl fast zwei Meter hoch und mit breiten Schultern, der einem buschigen Vollbart trug. Er nahm langsam einige Schritte in Richtung der versammelten Gruppe, welche sogleich ihren Blick auf ihn richtete, als wüssten sie, dass er etwas Wichtiges zu sagen hatte. Er sah in die Gesichter der Arbeiter und sagte schliesslich nur: „S'isch a Woüti.“
Die Reaktion fiel unterschiedlich aus, einige Arbeiter schienen nicht zu wissen, wovon der Mann sprach, doch andere hingegen waren wie versteinert, liessen ihr Werkzeug fallen und liefen langsam zurück, als stünde etwas Schreckliches vor ihnen. Ich bemerkte, dass es die einheimischen Arbeiter waren, die so reagierten, während die Italiener eher unbeeindruckt schienen und in Unverständnis Blicke austauschten. Auch war ich überrascht, dass dieser Mann nichts über den soeben verstorbenen Arbeiter sagte, ganz so, als wäre das von geringerer Bedeutung gewesen.
Bergmann versuchte die Gemüter zu beruhigen, indem sie erklärte, dass sie lediglich auf eine Gasblase gestossen waren, und alle notwendigen Messungen baldigst durchgeführt würden, doch es war der Vorarbeiter selber, der ihr nun sagte, dass dieser Bau nicht fortgeführt werden könne. Eine Aussage, die auf völlige Verständnislosigkeit traf, doch er bestand immer und immer wieder darauf, dass sie den Berg nicht stören dürften. Der Vorarbeiter blieb in der Diskussion standhaft, und nach kurzer Zeit liessen alle einheimischen Arbeiter, von ihrem Vorarbeiter angeführt, alles stehen und liegen, und liefen von der Baustelle fort, wodurch nur noch die italienischen Arbeiter zurückblieben.
Ich fragte Bergmann, was es mit dieser Sache auf sich hatte, und sie erklärte mir, dass dieses „Woüti“ eine Legende unter den Schweizer Bergvölkern sei, eine Art geisterhafte, unförmige Erscheinung, die sie als Vorbote für etwas Schlimmes sehen. Alles nur altertümlicher Aberglaube rückständiger Bergvölker, versicherte mir Bergmann. Zugleich zog mich aber dieser Aufprall zwischen dem Vorstoss der Moderne und dem altmodischen Aberglauben sehr an, ich empfand es als gerade die Art von Metapher für die Auswirkung des Fortschrittes, nach welcher ich gesucht hatte, und nahm mir vor, diesen Legenden und vor allem den Leuten, die sie am Leben hielten, weiter nachzugehen. Unter einem Vorwand verliess ich die Baustelle und lief so schnell ich konnte in Richtung Dorf, in der Hoffnung noch die anderen Arbeiter zu erreichen.
Ich konnte den Vorarbeiter Urs, den ich an seiner Grösse und Kleidung auch von hinten erkannte, einholen, sah aber keinen der anderen Arbeiter. Sie hatten sicherlich bereits ihre eigenen Wege eingeschlagen. Urs lief in Richtung des westlichen Seeufers des Lungernersees, welches gegenüber des stärker besiedelten Ostufers lag. Ich entschied mich erst mal ihm diskret zu folgen, und lief eine ganze Weile in grosszügigem Abstand hinter ihm her, entlang des malerischen Uferweges, der am See entlangführte. Das westliche Ufer des Sees war im Gegensatz zum Östlichen, welches ein Plateau bildete, direkt am Berghang.
Nach einer Weile aber flachte auch auf dieser Seite das Gelände etwas ab, und eine kleine Siedlung von kaum mehr als einem Dutzend Häusern wurde sichtbar. Als ich die hübsche kleine Kapelle dieses Dorfes erreichte, welche direkt an dem Weg gelegen war, den ich entlangkam, hatte ich plötzlich Urs aus den Augen verloren. Ich lief etwas schneller voran, in der Annahme, dass er vielleicht schon um die nächste Kurve gegangen und mir deshalb aus dem Blick gefallen war. In dem Moment sprang er hinter der Kapelle hervor, griff mich an den Oberarmen, und presste mich gegen die Wand. Ich erschrak fast zu Tode.
„Wer bist du, warum läufst du mir nach?“, fragte er mich.
„Reber, Samuel Reber“, stammelte ich, „ich bin Journalist.“
„Journalist?“, wiederholte Urs und stiess mich erneut an die Wand, „ihr seid doch alle ein Pack, wollen wohl über uns herziehen, irgendwelche Lügen verbreiten.“
„Überhaupt nicht, es ist nur...“, ich versuchte angemessene Worte zu finden, die ihn überzeugen könnten, „was sie an der Baustelle gesagt haben. Dieses Woüti. Ich meine, dass ich es auch gesehen habe.“
Nun lockerte sich sein Griff, und er liess mich kurz darauf los, blieb aber bedrohlich vor mir stehen.
„Sie haben das Woüti gesehen?“, fragte er mit zusammengekniffenen Augen.
„Ich... vielleicht. Es war eine seltsame Erscheinung, wie ein Strohballen. Ich habe es nicht genau gesehen, aber es war etwas Unwirkliches.“
Als ich den Strohballen erwähnte, weiteten sich Urs' Augen und er nahm einen Schritt zurück.
„Also doch ein Woüti...“, murmelte er für sich selber.
„Was ist dieses Woüti?“, fragte ich.
„Das ist schwer zu erklären. Es ist... es ist besser, wenn sie gehen. Weit weg von hier“, sagte Urs. Dann machte er sich weiter auf den Weg in Richtung des Dorfes. Ich lief ihm nach und fragte mehrmals erneut nach diesem Woüti, worauf er mich, ohne ein Wort zu sagen, abwinkte. Ich stellte mich irgendwann direkt vor ihn und bestand darauf, dass er mir antworte. Er sah mich eine Weile an und seufzte. Dann bat er mich, ihm zu folgen, und führte mich zu seinem Haus.
Wir liefen einen Weg, der den Hang hinaufführte, entlang, bis zu einem Holzhaus, ähnlich den anderen dieser kleinen Siedlung, allerdings kleiner als die meisten, und er bat mich hinein. Ich betrat ein altmodisches, spärlich eingerichtetes Heim, einfache Holzmöbel richteten eine kleine Stube ein, und am Fenster stand ein rustikaler kleiner Holztisch mit vier Stühlen, wo Urs mich bat, mich zu setzen. Er setzte sich mir gegenüber, nahm dann seine Pfeife und eine Dose mit Tabak hervor, stopfte sich erst mal die Pfeife, und zündete diese dann an. Es schien, er brauchte dieses kleine Ritual, um sich zu fassen für das, was er mir sogleich vortragen wollte.
„Das Woüti“, begann er, „ist wie ein Geist, oder eine Erscheinung. Schwer zu erklären, auf jeden Fall ist es etwas Übernatürliches. Meistens erscheint es als eine unförmige Masse, ohne klare Definition oder Gesicht. Wir haben seit eh und je Legenden gehört, die in den Dörfern der Berge weitergegeben werden.
Wissen sie, hier in den Bergen gelten gewisse andere Regeln. Wir waren schon immer sehr abgeschottet vom Rest der Welt, oftmals waren wir sogar monatelang vollkommen abgeschnitten von jeder sonstigen Zivilisation. Das Überleben war für uns nichts Selbstverständliches, und oft sind bis in späte Epochen Menschen gestorben, wenn sie im Winter von den Normen der Bergvölker abgekommen sind. Nicht etwa, weil wir irgendwie dagegengestemmt haben, aber weil diese Normen aus dem hervorgingen, was für das Überleben in solchen Orten notwendig war. Das, was andere als Legenden bezeichnen, als Ammenmärchen, das sind für uns Überlieferungen, denen wir viel Wert erteilen.
Zugegeben, ich selber und viele andere meiner Generation, nehmen diese Geistergeschichten nicht sehr ernst. Es ist ja nicht das Gleiche, wenn es darum geht, genügend Vorräte und Feuerholz für den Winter zu haben, oder dass die Hütte richtig gebaut wird, oder wenn man über solche Phantasmen erzählt. Aber irgendwo bleibt das dann trotzdem im Hinterkopf. Mir hat meine Grossmutter solche Sachen erzählt, und ich würde mich niemals trauen, all das einfach in den Wind zu schlagen. Und dann das Woüti so klar zu sehen, vor mir, dort im Tunnel...“ Er schauderte sichtlich bei diesem letzten Satz.
„Aber was ist denn dieses Woüti nun genau?“, fragte ich. Trotz seiner Ausführungen konnte ich nicht ganz begreifen, warum ihn diese Erscheinung so erschreckte, und konnte nur annehmen, dass diese irgendeine Gefahr oder Vordeutung barg.
„Wie ich sagte, ich kann ihnen nicht sagen, was es genau ist.“
„Aber warum erschreckt es sie dann so sehr?“
„Das Woüti ist ein Vorbote für ein kommendes Unheil, es kann ein Unfall sein, eine Krankheit oder... etwas schlimmeres.“
„Etwas schlimmeres?“, hakte ich nach.
„Es sind alte Legenden, ich weiss nicht, was sie tatsächlich bedeuten“, wich Urs mir aus. Ich merkte, er wollte mir nicht sagen, woran er tatsächlich dachte. Er schaute durch das Fenster neben dem Tisch, draussen dämmerte es. Einige Leute, nicht wenige, liefen draussen vorbei, was mir auffällig erschien, zumal beim Ankommen in dieser kleinen Siedlung niemand zu sehen gewesen war. Nun liefen mehrere Leute vorbei, ich bemerkte, dass sie Brennholz mit sich trugen.
„Es wird spät“, sagte Urs plötzlich, „sie müssen jetzt gehen, damit sie den Weg bis Lungern schaffen.“
Er stand auf, in der offensichtlichen Absicht, mich nach draussen zu führen. Ich war unzufrieden, dass Urs mir nicht alles erzählt hatte, was er wusste, doch ich befand es für zwecklos, weiter nachzufragen. Ich würde später wieder auf ihn zukommen, denn ich wusste, dass man oftmals über wiederholte Treffen mehr von jemandem herausbekam, als wenn man sich zu sehr aufdrängte. Die Gewohnheit machte einen zu einem bekannten Gesicht, und führte den anderen dazu, sich weiter zu öffnen.
Urs begleitete mich nach draussen und lief mit mir runter ins Dorf, und dann ein Stück den Weg am See entlang aus dem Dorf hinaus, in die andere Richtung als von der wir zuvor hergekommen waren. Erneut fielen mir die Leute auf, die mit Brennholz in den Armen an mir vorbeigingen. Sie schienen in Richtung der Kapelle zu laufen, und starrten mich im Vorbeigehen an, als wäre ich eine Art von Ungetüm, welches sie noch nie zuvor gesehen hatten. Als wir das letzte Haus hinter uns gelassen hatten, zeigte er mir den Weg zurück nach Lungern, um den See herum, und ging anschliessend wieder zurück.
Ich erwog kurzzeitig, folge zu Leisten und zu meiner Unterkunft zurückzulaufen, doch die Verwunderung über die Dorfbewohner, welche ich nun gesehen hatte, mehr und mehr Brennholz zur Kapelle bringen, liess mich nicht los, denn ich kam nicht um den Verdacht herum, dass sich etwas Bedeutsames dahinter verbarg. Wieso sonst, würde man einfach Brennholz irgendwo mitten im Dorf hinlegen? Was aber nun genau damit erreicht werden sollte, von der höchstwahrscheinlichen Verbrennung dessen abgesehen, war mir ganz und gar schleierhaft.