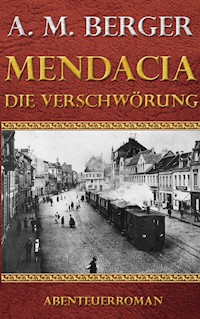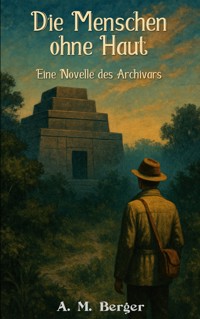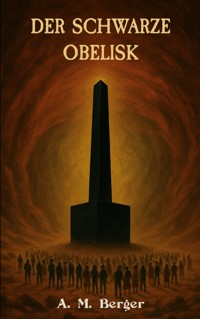Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Aus dem Archiv der Universität Thurikon
- Sprache: Deutsch
Im dritten Band der "Aus dem Archiv der Universität Thurikon"-Reihe kommen die Schüler des Professor Grebenschtschikow zu Wort, mit den Geschichten der bizarren Erlebnisse, welche ihnen auf der unaufhörlichen Suche nach neuen Erkenntnisse widerfahren sind. Eine neue Sammlung von sieben seltsamen und haarsträubenden Erzählungen im Stil der 'weird fiction'.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
DER ALMANACH
HINTER DEM EISWALL
FEUERTEUFEL
DAS EINSAME SCHIFF
AUF DER SPUR DER SKRIBENTEN
DIE BESTIEN IM BERG
VOM KULT DES ENLIL
VORWORT
Eine bedrückende Tatsache der modernen Welt ist, dass die grossen Fortschritte, welche der Mensch in Wissenschaft und Technik getätigt hat, und welchen man in der Hoffnung auf die Antworten zu den wesentlichsten Fragen von Existenz und Realität nacheiferte, schlussendlich anstatt zu diesen Antworten nunmehr zu viel zahlreicheren und komplexeren Fragen geführt haben. Die Tragik der Moderne ist es, dass man sich bei der Bestrebung, aus der Unwissenheit zu entkommen, wie man sich aus einem Treibsand zu befreien versucht, schlussendlich nur noch tiefer darin versinkt.
Die neuen Fragen, die sich dort auftun, wo man das Ende des mühseligen Weges vermutete, führen in Richtungen, die man womöglich nicht erwartet hatte, und nachdem man bereits eine derartige Distanz zurückgelegt hat, fällt es umso schwerer zu akzeptieren, dass es diesen neuen Weg zu erkunden gibt, und umso mehr möchte man auf dem gleichen Kurs beharren, gleichwohl mehr als derjenige, der erst neu dieser Unternehmung zugestossen wäre. So liegt eine Stärke im Unwissen, nämlich das Potenzial, nicht von den bisherigen Erkenntnissen voreingenommen zu sein.
Es ist nicht selten, dass wenn ein Weg lang und beschwerlich ist, man alsbald vergessen hat, weshalb man sich überhaupt auf diesen Weg gemacht hat, und welches Ziel man ursprünglich verfolgte. Und so mag die Suche nach neuem Wissen einstmals nur noch als praktische, materialistische Auslegung verstanden werden, wodurch sie in das enge Korsett der Suche nach dem bekannten Unbekannten gezwängt sah. Die bequemste aller Positionen, welche sich zugleich der Gewinnung neuer Erkenntnisse verschrieben meint, jedoch ohne den ausgemachten Pfad jemals zu verlassen.
An der Universität Thurikon, unscheinbar und so oft unbeachtet, war es der exzentrische Professor Grebenschtschikow, der sich den Sinnspruch erdachte: Cognitio pro scientia. Wissen für das Wissen. Die Wissenschaft als Selbstzweck in der Suche nach neuen Erkenntnissen, nicht bloss als Antwort auf die im Vornherein ausgedrückten Fragen, sondern auch als eine ergebnisoffene Forschung nach Fragen, von welchen man gar nicht wusste, dass man sie überhaupt stellen vermochte.
Es ist der Mut, nicht nur neue Erkenntnisse zu erfassen, sondern Ausschau zu halten nach Arten der Erkenntnis, welche man zuvor gar nicht für möglich gehalten hatte, oder gar einen neuen Rahmen der Erkenntnis zu identifizieren, den man gar nicht für möglich hielt, ja von welchem man nicht einmal die Ebene der Realität, auf welcher er existiert, erwägt hatte.
Mit dieser Auffassung als Grundlage würden die Schüler des Professor Grebenschtschikow in die Welt hinausziehen, um sich dieser Herausforderung, welche sich zwischen den tiefsten Urängsten wie auch der wesentlichsten Bedeutung des Menschseins erstreckt, zu stellen.
Hier nun weitere Geschichten aus dem Archiv der Universität Thurikon.
DER ALMANACH
1
Womöglich ist es eine evolutiv bedingte Eigenschaft, dass der Mensch sich an die mutmassliche Gewissheit seiner Erkenntnisse heftet, um nicht auf ewig dem Drang zum neuen Wissen nachzugehen, welcher ihn einstmals ins Verderben stürze. Es scheint mir durchaus unwirklich, wenn ich darauf zurückblicke, wie ich völlig unwissend in diese aberrante Situation gestolpert bin, welche ich über die Welt gebracht habe, und von welcher ich annehmen muss, dass sie unweigerlich ein grauenvolles Ende nehmen wird.
Ich selbst habe seither meinen Rückzug im Kapuzinerkloster von Rapperswil gefunden, einer der wenigen Orte, an welchen ich noch Geborgenheit finden konnte von dem Unheil, welches ich selber verursachte. Der Aussenwelt abschwören war mir infolgedessen ein Leichtes, doch da ich in Kürze das zeitliche Gelübde ablegen werde, möchte ich nun meine Erlebnisse festhalten, um sie in dieser Niederschrift endgültig abtreten zu können. Ich bete, dass mir meine Verfehlungen einstmals vergeben werden.
Es begann, als ich mit einer Tätigkeit beschäftigt war, welche wohl harmloser nicht hätte sein können, nämlich der Digitalisierung historischer Buchbänder aus dem Bestand der Stiftsbibliothek von St. Gallen. Diese edlen Werke waren zumeist schon viele hunderte Jahre alt, manches erreichte sogar ein Alter, welches über das Jahrtausend hinausging. Es brachte gleichwohl seltsame Gedanken in mir hervor, wenn ich mir versuchte vorzustellen, in welcher Welt diese Werke geschrieben worden waren, und welches zeitgeschichtliche Geschehen schon an ihnen vorbeigezogen war.
Diese stillen Zeugen der Vergangenheit hatte ich nun auf einem Tisch vor mir liegen, daneben meine Apparatur bestehend aus einem Buchständer, einigen Lampen, welches ein sanftes Licht abgaben, als dass die Seiten nicht zusätzlich beschädigt würden, einer digitalen Photokamera und einem Computer, auf welchem ich die Schnappschüsse speichern und ordnen sollte. Dieses Verfahren mit einem Buchständer und einer Photokamera war aufwendiger als mit einem handelsüblichen Scanner, doch da es sich um Bücher von hohem Alter und unschätzbarem Wert handelte, war dies die beste Möglichkeit, diesen Vorgang so schonend wie möglich anzugehen.
Ich muss, wenn auch angesichts meiner letztendlich desaströsen Situation mit etwas gemischten Gemüt, an Professor Grebenschtschikow gedenken, welcher mir anschliessend meines Studienabschlusses im Fach der Kunstgeschichte zu dieser Arbeit verholfen hatte, und mit einem Abschluss von so zweifelhaftem praktischem Nutzen wie dem Meinen war es in der Tat kein Leichtes, an eine angemessene Tätigkeit zu kommen. Doch ich gebe zu, diese Sorge war für mich von Beginn an zweitrangig gewesen, da ich meinem Studium rein aus Leidenschaft nachgegangen war und nicht, weil ich mir davon einen praktischen Nutzen erwartete.
Denn so sehr in unserer heutigen gottlosen Welt der Materialismus zum Kredo und der Reichtum zum Götzen erhoben worden ist, und jegliches Streben nach Erkenntnis und Erleuchtung lediglich in Funktion des materiellen Ertrages gesehen wird, welchen es erzeugen könnte, so führe ich wohl die Seele eines altmodischen Romantikers in mir, welcher den geistigen Reichtum doch noch höher wertet als den Materiellen.
Und so störte ich mich auch nicht im Geringsten an der wahrlich dürftigen Entlohnung für meine Arbeit, da es für mich von viel grösserem Wert war, meine Zeit mit dieser ehrfurchtgebietenden Sammlung menschlichen Wissens verbringen zu können.
Die Bücher, welche ich im Zuge meiner Tätigkeit sichtete, hatten recht unterschiedliche Inhalte, es gab natürlich nicht wenige Bibeln, wie es bei einer Stiftsbibliothek zu erwarten war, und hinzu kamen zahlreiche theologische Werke und Abhandlungen. Die wissenschaftlichen Traktate waren durchaus interessant, womöglich nicht wegen der aus moderner Sicht simplen Erkenntnisse, aber um die Entwicklung der wissenschaftlichen Methoden ersehen zu können, was mir auch bedeutsame Rückschlüsse auf die menschliche Natur erlaubte. Entgegen dessen, was viele wohl gerne meinen wollen, hat sich der Mensch in diesen vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht im Geringsten in seinem Wesen gewandelt, und das Phänomen der Furcht davor, etabliertes Wissen in Frage zu stellen, zieht sich kontinuierlich und bis hin zum heutigen Tage durch die ganze Geschichte der menschlichen Zivilisation.
Als ich einige der Werke von der Ablage zu meinem Tisch brachte, fiel mir eines besonders ins Auge. Es war ein weisser Einband, oder zumindest muss er im Ursprung weiss gewesen sein, bevor er in seinem jetzigen Ausmass beschädigt und verfallen war. Selbst der Titel war unleserlich, und in der Auflistung der Bücher war es nur mit dem Titel „Almanach“ eingetragen, wohl im Fehlen irgendeines Hinweises auf den tatsächlichen Titel.
So sehr zog dieses unscheinbare, vergammelte alte Buch meine Aufmerksamkeit auf sich, dass ich, noch während ich daran war, ein anderes Werk abzulichten, vorsichtig durch diesen Almanach zu blättern begann. Die Seiten hiervon waren ebenso beschädigt wie der Einband, und der Text nicht immer vollständig lesbar. Mir fielen die zahlreichen Zeichnungen auf, die zumeist Landkarten abzubilden schienen, mit welchen ich allerdings nichts anfangen konnten, da keine davon irgendeinen Landstrich wieder gab, der mir bekannt vorkäme.
Trotz des aufgrund des Zerfalls unvollständigen Textes, konnte ich nach und nach einen Sinn aus diesem Buch, welches von Hand niedergeschrieben worden war, stiften. Immer wieder wurden sogenannte Ahnen erwähnt, mit welchen offenbar Individuen gemeint waren, welche viele Jahrhunderte bevor dieses Buch verfasst wurde, eine grosse Bedeutung gehabt hatten, wohl die Herrscher über viele Länder und Menschen gewesen seien, deren Herrschaft aber unbarmherzig und tyrannisch war.
Den Ursprung dieser Ahnen deutete das Buch auf ein Land jenseits des Firmamentes, erneut eine Erwähnung, die sich immer wieder wiederholte. Jenseits des Firmamentes hausten diese Ahnen, und sie begaben sich über die ozeanischen Wege vom dunklen Tempel zu den Menschen hin, um über sie zu verfügen. Die Menschen wiederum waren für sie nur Untertanen oder gar Sklaven, welche ihren Anordnungen unter Androhung schwerer Strafen Folge zu leisten hatten.
Wie gebannt starrte ich Stundenlang auf die vergilbten und verwesten Seiten dieses Buches, und versuchte weitere Einzelheiten aus den Überbleibseln dieses Textes zu interpretieren. Ich konnte mir nicht vorstellen, was wohl der Ursprung dieses Textes gewesen sei: War es ein Märchen, welches jemand aus Jux und Tollerei verfasst hatte? Womöglich der Fiebertraum eines Schreibers, der dem Delirium tremens verfallen war? Oder, und dies war die erschreckendste Überlegung, konnte dieses arkane Buch vielleicht, so verzerrt es auch verfasst war, tatsächliche Begebenheiten wiedergeben?
Der Frust einerseits darüber, dass ich keinen logischen Sinn aus diesem Text oder den Zeichnungen interpretieren konnte, aber auch über die Schwierigkeit, den Text auf den schwer beschädigten Seiten zu entziffern, und vor allem, dass mein Vorgesetzter Raphael Rabe mich auf meinen langsamen Fortschritt beim Ablichten der bedeutsameren Bücher aufmerksam machte, brachte mich schliesslich dazu, das Werk beiseitezulegen und mich erneut meiner eigentlichen Aufgabe zu widmen.
Erst Wochen später, als ich meinen seltsamen Fund fast gänzlich aus meiner Erinnerung verdrängt hatte, sprang mir ein Bericht in einer Zeitschrift über Archäologie, Anthropologie und Kunstgeschichte ins Auge, welche ich in einer Wirtschaft auffand, die nahe der Universität von St. Gallen gelegen war, wo Studenten oftmals solche Fachzeitschriften liegenliessen.
Der Bericht erwähnte seltsame Strukturen aus Stein, mehrere Meter tief im Mittelmeer, nur ein kurzes Stück weit von der Küste Maltas entfernt. Auffällig daran seien vor Allem zahlreiche parallel verlaufende Furchen, sogenannte Schleifspuren, die an die Furchen von Wagen erinnerten, wobei es keinen Sinn ergab, dass solche sich tief unter dem Meer und in hartem Steinen befinden sollten.
In dem Moment konnte ich es nicht vermeiden, an das verwitterte alte Buch zu denken, welches von ozeanischen Wegen sprach, und hierzu eine Karte aufzeigte, welche mich zwar stark an die Mittelmeerregion erinnerte, jedoch vielerorts die abgezeichneten Landmassen keineswegs den tatsächlichen entsprachen, mit einer Abweichung, die viel zu gross war, als dass dies nur auf ungenaue Kartenzeichnung zurückzuführen wäre.
Eine Graphik in der Zeitschrift zeigte, wo die bekannten Furchen ungefähr verliefen. Ich eilte mit aller Hast zurück zu meinem Arbeitsplatz nahe der Stiftsbibliothek und holte das weisse Buch hervor. Vorsichtig suchte ich diese Karte, und verglich sie mit der Graphik der Zeitschrift. Tatsächlich, die Verläufe der entdeckten Strukturen waren fast deckungsgleich mit den ozeanischen Wegen, die im Buch erwähnt wurden und auf der Karte eingezeichnet waren.
Ein kalter Schauer lief mir den Rücken hinunter. Wie konnte es sein, dass dieses wohl mindestens eintausend Jahre alte Buch diese abstrusen Strukturen erwähnte, welche erst in jüngster Zeit von der Wissenschaft entdeckt, oder genauer gesagt wiederentdeckt worden waren?
Ich nahm die Zeitschrift an mich und wollte noch an diesem Tag die Graphiken darin mit den Karten im Almanach vergleichen, doch als ich zu meinem Arbeitsplatz zurückkehrte, konnte ich diesen nicht mehr auffinden, so sehr ich auch die Menge an Büchern durchsuchte, wo ich es ursprünglich zurückgelassen hatte, schien es wie vom Erdboden verschluckt.
2
Die Tür zu Professor Grebenschtschikows Kämmerlein war einen Spalt breit offen, also trat ich ein, klopfte dabei aber noch an die Tür. Grebenschtschikow brütete über irgendwelche Papiere und hob nur kurz den Blick als er mich eintreten hörte.
„Kommen rein, junger Mann. Können sich setzen“, sagte er in seinem starken russischen Akzent, während er weiter die Dokumente auf seinem Schreibtisch betrachtete.
Es war nicht ganz einfach mir einen Weg bis zum hölzernen Stuhl zu bahnen, welcher einsam vor dem massiven Schreibtisch stand. Das ganze Büro war ein einziges Chaos: Es stapelten sich überall Kisten und Schachteln, aus welche Papiere aller Art hervorblickten. Dahinter waren an den Wänden einfache hölzerne Regale, bei welchen nicht wenige Ablagen unter dem Gewicht zahlreicher Bücher und Mappen eingebrochen waren. Nichts davon schien den Greis zu stören, tatsächlich schien es sogar, als würde er diese ganze Unordnung in seinem Forschungseifer gar nicht wahrnehmen.
Ich setzte mich und sagte nichts, so lange wie der Professor noch auf das Blatt Papier starrte. Er bewegte ein wenig die Lippen, während er las, was dort geschrieben war. Derweil erklang aus einem kleinen Radiogerät auf seinem Schreibtisch das Klavierkonzert von Edvard Grieg.
„Das ist eine Brief aus Italien, Pompeji“, sagte er nachdem er fertig gelesen hatte, „haben sie dort gefunden seltsame Inschrift an Grab. Habe ich gesehen vorher schon solche Zeichen. Aber ich kann sagen ihnen, wenn ich das diese Leute erkläre, dann wird es sein wie wenn ich nie hätte erklärt. Sind Zeichen die wurden auch bei Ureinwohner in Australien gefunden. Sie sehen, das wird nicht passen in Verständnis von Geschichte. Und Archäologen immer haben Angst, wenn sie sagen etwas, was Regierungen nicht wollen hören. Darum sie nur sagen, was man will hören. Poka.“
Er zerknüllte das Papier und warf es in einem übervollen Papierkorb neben dem Schreibtisch.
„Wie kann ich ihnen helfen, Junger Mann?“, fragte er mich anschliessend. Er sprach die Studenten immer als „junger Mann“ an, weil er sich ihre Namen nicht merken konnte.
Ich begann eine langatmige Erklärung darüber, wie ich auf das verwitterte weisse Buch gestossen war, was darinstand und schliesslich, wie ich die Karten, die darin enthalten waren, mit unterschiedlichen modernen Karten verglichen hatte, um die seltsamsten Übereinstimmungen zu finden. Ich hatte die ganze Information sorgfältig in einem Dossier zusammengetragen, welches ich Professor Grebenschtschikow übergab. Eine ganze Weile schaute er dieses durch.
„Das ist wirklich faszinierend, haben sie gute Arbeit geleistet, junger Mann“, sagte Grebenschtschikow, „aber warum sie machen so viel Arbeit für etwas, was die Fachwelt nicht wird annehmen auch nicht in hundert Jahren?“
„Nun, Professor“, antwortete ich, „ich habe bei ihnen gelernt, dass wir unsere Forschung nicht machen sollten, um irgendeine Fachwelt zu beeindrucken, sondern weil wir Forscher sind. Cognitio pro scientia.“
Grebenschtschikow lachte. „Sie haben erinnert das Motto, das ich einmal habe erfunden für mein Unterricht.“
„Ganz in diesem Sinne würde ich gerne mehr darüber herausfinden, wie dieses Buch entstehen konnte, und wer diese Ahnen waren, welche immerzu erwähnt werden“, sagte ich.
„Würde ich gerne einmal anschauen diesen Almanach“, sagte Grebenschtschikow, „klingt sehr interessant das alles.“
„Das ist die Sache, Professor“, stammelte ich, „ich kann das Buch nicht mehr finden. Es war Teil einer ganzen Reihe an Büchern, die ich ablichten sollte, und zu welcher eigentlich niemand sonst Zugang hatte. Auch mein Vorgesetzter, Herr Rabe, sagte mir, er könne kein Buch unter dieser Bezeichnung oder mit der Kodierung finden.“
Grebenschtschikow kraulte sich einen Moment lang nachdenklich seinen weissen Bart. Griegs Klavierkonzert war inzwischen zu Ende und Dvoraks 9. Sinfonie „Von der neuen Welt“ begann zu ertönen. Der Professor hob plötzlich den Finger, als wollte er mir sagen, dass ihm etwas eingefallen sei. Er erhob sich von seinem Sessel und wollte hinter dem Schreibtisch hervorkommen, doch die Unordnung stand ihm im Weg. Er seufzte und lehnte sich kurz mit gesenktem Blick an den Schreibtisch.
„Bitte junger Mann, dort hinten, sie sehen das blaue Mappe auf Regal“, sagte Grebenschtschikow und deutete auf einen der zahlreichen Ordner. Ich sprang auf und lehnte mich über das Schlachtfeld von Kisten und Papieren, um gerade so in einem Balanceakt an die gewünschte Mappe zu kommen. Es war eine einfache dunkelblaue Kartonmappe, welche völlig überfüllt war. Ich drehte sie kurz um auf der vergeblichen Suche nach einer Beschriftung. Ich übergab sie dem alten Mann, welcher sie auf den Schreibtisch legte und sich auf seinem Sessel fallen liess.
„Sie haben gesagt war Buch mit Nummer G-506, ja?“, fragte Grebenschtschikow.
„Ja, kein Titel und nur als ‚Almanach’ bezeichnet“, antwortete ich, „aber selbst das Datenblatt dazu konnte ich nicht mehr ausfindig machen. Es ist, als hätte ich mir das Buch nur eingebildet, aber sie müssen mir glauben, dass dem nicht so ist.“
Grebenschtschikow nickte leicht, während er eine ganze Weile durch den Inhalt des blauen Ordners blätterte, welcher offenbar nur aus endlosen Auflistungen bestand, welche ich aber aus meiner Position nicht genau erkennen konnte. Ebenso wenig wagte ich es, den erhabenen Professor mit solchen Fragen zu unterbrechen, obwohl ich keineswegs das Gefühl hatte, dass sich dieser Mensch dadurch irritieren lassen würde. Ich hatte wohl noch nie so viel mit meinem ehemaligen Professor konversiert wie an diesem Tag, und je länger dieses Treffen andauerte, umso freundlicher und offener schien mir dieser Mann, der sonst nach aussen hin den Eindruck eines alten Grantlers machte.
„Ist seltsam, sehr seltsam jawohl“, brummte er vor sich hin, nachdem er dutzende Seiten mit langen Listen durchgeblättert hatte. „Das hier ist Index von alle Bücher die sollten digitalisiert werden, aber finde ich nicht G-506. Ist wie wenn nicht existiert. Sie sind sicher von Nummer?“
„Ohne jeden Zweifel“, antwortete ich. Erneut kraulte Grebenschtschikow seinen Bart.
„Ist vielleicht Fehler, wer weiss. Aber nicht schlimm, was ich wissen wollte, hier steht. Nummerierung ist von ganze Reihe von Bücher die kommen aus Einsiedlerkloster Prüsfa.“
„Einsiedlerkloster Prüsfa?“, fragte ich, „wo liegt denn die, davon habe ich noch nie gehört.“
„Heisst nicht wirklich so, aber wir wissen nicht wie geheissen hat“, erklärte Grebenschtschikow, „ist eine Ruine bei Fluss Ri di Prüsfa, tief in die Berge. Dort vergraben in Ruine hat man gefunden viele alte Bücher, daraus man konnte wissen, dass es gewesen kleine Kloster oder so ähnlich. Aber nicht viel mehr, wissen nicht wie geheissen oder wer dort gelebt. Bücher waren in zwei Truhen, die bei ein Erdrutsch verschüttet worden. So haben sich Bücher vor Plünderung gerettet und blieben erhalten.“
„Wurde diese Ruine nicht weiter studiert?“, fragte ich.
„Nein“, antwortete der Professor, „weil Ruine wurde entdeckt 1941 bei Bau von Bunker dort in der Nähe, wegen grosser Krieg, sie wissen. Man hat gerettet Bücher, aber wegen Krieg wurde nicht viel weitergeforscht. Danach fiel in Vergessenheit, der Bericht aus die Zeit hat auch gesagt dass nicht viel dort übrig war, ausser die Truhen. Wahrscheinlich alles geplündert.“
Professor Grebenschtschikow holte aus der blauen Mappe ein kleines Bündel Seiten, welche mit zwei Klammern zusammengeheftet waren, und drückte sie mir in die Hände. Darauf waren die wenigen Erkenntnisse ausgeführt, welche man über das Einsiedlerkloster hatte in Erfahrung bringen können. In den bekannten Quellen wurde der Ort nur sehr selten erwähnt, und meist nur sehr beiläufig. Die erste Erwähnung stammte aus dem Jahr 836, berichtet wird darin nur sehr kurz über eine kleine Kapelle, in welcher ein Einsiedlermönch lebte, und welche wohl Vorläufer des Klosters war.
Die einzige etwas detailliertere Beschreibung, wenn man das überhaupt so bezeichnen konnte, stammte aus einer Chronik aus dem Jahr 1245, welche von der „Kapelle der Ahnen“ spricht, die aber aufgrund der geographischen Beschreibung eindeutig auf die Einsiedelei zurückgeführt werden kann. Zu diesem Zeitpunkt lebten sechs Mönche als Eremiten dort. Die Chronik besagt, dass sie die Hüter der Gräber der Ahnen sind, und sich niemand aus der umliegenden Region auch nur in die Nähe dieser Kapelle traute. In einer Erwähnung aus dem Jahre 1402 hingegen wird bereits eine Klosterruine beschrieben.
Nach dem 2. Weltkrieg gab es, angetrieben durch den Fund von 1941, sporadische Unternehmungen, die Ruine zu erforschen. Der Heimatschutz untersagte allerdings jedes Mal die Erlaubnis, den Ort auf irgendeine Weise zu beschädigen, was folglich auch eine Ausgrabung ausschloss. Grebenschtschikow konnte hierzu nur den Kopf schütteln. Die Ruine sei wenig mehr als ein Paar Steine, kaum von den Felsen in der Umgebung zu unterscheiden. Wenn es etwas von Wert für die Wissenschaft dort geben sollte, dann seien es bestimmt nicht die Überreste der Grundmauern.
„Was ich würde empfehlen ist, dass sie gehen und schauen, ob noch etwas zu finden ist dort. Bestimmt noch eine Information die in vierziger Jahre übersehen. Ich wollte schon lange hin, aber bin alt, kaputt, ich schaffe nicht. Problem ist auch das keine Erlaubnis von Regierung, wegen Heimatschutz.“
Ich hatte allerdings gar nicht vor, mir von einem spiessigen Bürokraten, der sich hinter seinem Schreibtisch versteckt, verbieten zu lassen, diesen Ort genauer unter die Lupe zu nehmen, vor allem angesichts der Tatsache, dass auch sonst seit der Entdeckung keinerlei Massnahmen ergriffen worden waren, um diese Stätte irgendwie zu erhalten. Ich ergriff die Gelegenheit des guten Wetters, welches noch einige Tage in der Gegend herrschen würde, und machte mich mit meiner Zeltausrüstung auf zur Ruine.
Wie so oft in der Schweiz war dieser recht abgelegene Ort doch mit relativer Einfachheit zu erreichen. Anschliessend einer Bahnfahrt bis Biasca, wo ich erstmal übernachtete, trat ich am Tag darauf die zwei Busfahrten an, nach welchen ich nur noch wenige Stunden Fussmarsch brauchte, um die Ruine des Einsiedlerklosters von Prüsfa zu erreichen. Vor allem der letzte Abschnitt hatte sich dabei allerdings ziemlich mühselig gestaltet, einen steilen Hang hinauf ohne einen rechten Pfad. Ich musste mir mit grosser Vorsicht einen Weg über Stock und Stein bahnen, um nicht abzustürzen.
Die Ruine befand sich auf einer kleinen Ebene, welche sich zwischen den Berghängen neben dem kleinen Bach auftat. Selbst Grebenschtschikows Beschreibung als Ruine schien mir übertrieben, hätte ich nicht gewusst, um diesen Ort die einstige Stätte der Einsiedelei zu erwarten, wäre ich davon überzeugt gewesen, dass es nur eine zufällige Felsformation sei. Die wenigen Überreste waren dermassen überwuchert, dass sie sich inzwischen vollkommen in die Landschaft einfügten. Nur bei genauerem Hinschauen waren einige Abflachungen an den Steinen zu erkennen, welche daraufhin deuteten, dass es Überreste eines Bauwerks waren.
Ungefähr in der Mitte dieser Stätte bemerkte ich etwas Seltsames am Boden, kreisrund war eine Holzplatte auf den Boden gelegt, welche durch die Abwesenheit des sonst allgegenwärtigen Pflanzenwuchses auffiel. Die Holzbretter waren morsch und von Moos und Flechten bedeckt. Ich riss eines der Bretter ab, und entdeckte darunter eine Falltür aus Stahlgitter, welche mit einem alten, rostigen Vorhängeschloss verschlossen war. Darunter konnte ich steinerne Stufen erkennen, die hinunter in die Dunkelheit führten. Sofort war mir klar, dass darunter der Ort sein musste, wo die Bücher gefunden worden waren.
Ich riss mühelos die restlichen Holzbretter weg und gab die Falltür frei. Diese bot mir trotz des Alters und des Rostes grösseren widerstand als die Bretter, doch ich konnte, indem ich mit einem schweren Stein auf das Vorhängeschloss schlug, dieses schliesslich aufbrechen. Mit einem lauten Quietschen öffnete ich das Stahlgitter und gab den Eingang frei.
3
Mit meiner Taschenlampe in der linken Hand betrat ich vorsichtig das arkane Gewölbe, welches unter den Ruinen des einstigen Klosters seit langen Jahren in kalter Dunkelheit schlummerte. Eine steinerne Treppe, welche direkt in den Felsen gemeisselt war, führte hinunter in eine kleine Kammer. Ich konnte nicht ausmachen, inwiefern dieser Ort den natürlichen Ursprung einer Höhle hatte, von Menschenhand gegraben worden war, oder gar eine Mischung davon darstellte, eine Höhle, die später erweitert worden war.
Während die erste Kammer, welche nebst etwas Geröll völlig leer war, weitgehend den Anschein einer Höhle aufwies, mit groben, unregelmässigen Wänden und erdigem Boden, so besass sie allerdings auch zwei Durchgänge, deren Form, wenn auch etwas asymmetrisch doch zu exakt schien, um auf natürliche Weise entstanden zu sein. Einer dieser Durchgänge war wohl von einem Einsturz verschüttet, ein Haufen von Steinen und Geröll füllten ihn von der anderen Seite her bis ganz oben auf. Der andere Durchgang, gerade gross genug, dass ich mich leicht bücken musste, um ihn zu durchqueren, war offen und bot mir Zugang zu einer weiteren Kammer.
Dieser nächste Raum war merkbar anders als der Erste, nicht mehr Wände von rauem, gezacktem Fels, sondern glatt gemeisselt. Ich meinte, auf den Wänden Überreste von Zeichnungen erahnen zu können, doch zu schlecht erhalten, als dass ich die Bildnisse identifizieren könnte. Zu sehr hatten die Feuchtigkeit und das Moos dem ganzen Ort zugesetzt. Ich schaute mich mithilfe der Taschenlampe in diesem ebenfalls kahlen Raum um, und bereute in dem Moment, nicht in Erfahrung gebracht zu haben, wo genau denn die Bücher gefunden worden waren, denn so überschaubar, wie ich es erwartet hatte, war dieser Ort keineswegs.
Als ich, nachdem ich einen Moment lang versucht hatte, die Reste der Malereien zu erkennen, mich zur Wand zu meiner Rechten drehte, überraschte mich der Anblick eines weiteren Durchgangs, welcher aber mit einer reichlichen, tempelartigen Verzierung versehen war. An den Seiten waren Säulen in den Stein gemeisselt worden mit abstrakten Mustern, die mich an Reben erinnerten, ebenso war über den Durchgang ein Schrägdach in den Stein gemeisselt. Es war nicht zu übersehen, dass diese Pforte zu einem Ort von grosser Bedeutung führen musste.
Ich fuhr mit den Fingern vorsichtig über diese Ornamente in der Wand. Die Qualität dieser Schnitzereien war erstaunlich, trotz des offensichtlichen Alters war die Sorgfalt, mit welcher sie in den Stein graviert worden waren, nicht zu übersehen, und auch ein unwirklicher Kontrast zum Rest dieses Ortes, welcher bestenfalls primitiv bearbeitet worden war, wenn überhaupt.
Ich betrat den Gang jenseits dieses Portals und kam in einen langen Korridor, welcher schräg nach unten führte und dessen Wände und gewölbte Decke ebenfalls mit auffälliger Perfektion bearbeitet waren, absolut gerade und ohne die Unregelmässigkeiten, welche die vorherige Kammer aufwies. Sie glänzten beinahe im Licht meiner Taschenlampe.
Mehrere hundert Meter muss ich wohl diesen Korridor entlanggelaufen sein, die völlige Abwesenheit jeglicher Art von unterscheidendem Merkmal machte es schwer, die Distanz einzuschätzen und die Orientierung zu erhalten. Dann allerdings konnte ich einen Raum am Ende des Gangs erahnen. Ich erwartete eine weitere kleine Kammer, wie es die bisherigen Räume gewesen waren, doch ich fand mich völlig überwältigt in einer enormen Halle wieder. Die Decke musste mindestens zehn Meter hoch sein, denn das Licht meiner Taschenlampe konnte sie kaum noch erhellen. Entlang der Halle standen steinerne Gebilde, welche mich an Tische oder Regale erinnerten. Konnte es sein, dass hier die alten Bücher gefunden wurden?
Ich schaute mich in diesem Raum um, doch konnte auch hier nichts wirklich Weiterführendes finden. Es gab keine Schriften oder Malereien an den Wänden, keine Symbole, und erst recht keine Artefakte, die irgendetwas über diesen geheimnisvollen Ort verraten hätten. Erst hatte ich spekuliert, dass es sich um eine unterirdische Kapelle handeln könnte, da solche keineswegs unerhört sind, doch nichts machte den Anschein, dass dies ein Ort des Gebets sei. Keine Bänke, kein Altar, kein Kreuz oder sonstige christliche Symbolik. Es machte eher den Eindruck eines Lagerraums.
Als ich die Wände inspizierte, fielen mir zahlreiche der tempelartigen Verzierungen auf, welche ich beim Eingang in den vorherigen Korridor bemerkt hatte, jedoch besassen diese keine Tür, sie waren scheinbar grundlos in regelmässigen Abständen in den Stein gemeisselt. Ich tastete die Wände bei einem dieser Ornamente ab, ob es vielleicht einen verborgenen Durchgang gäbe, doch es schien alles solide Steinwand zu sein.
Erst am hinteren Ende des Raumes fand ich das scheinbar einzige andere Tor, nebst dem, durch das ich hierher gelangt war. Es führte in eine viel kleinere Kammer, in welcher mir sofort eine Reihe von vier grossen, parallel aufgestellten steinernen Quadern auffiel, die wiederum auf steinernen Sockeln ruhten, und die von der Form und Grösse her markant an Särge denken liessen.
Ich sah mich ein Wenig in diesem Raum um und bemerkte erstmals Zeichnungen an den Wänden. Erst meinte ich, es seien Dekorationen, doch bei näherer Betrachtung schien es sich um Karten zu handeln. Ich erkannte einige der Territorien, den Umriss Europas und Nordafrikas, doch dort, wo eigentlich Meer und Ozean sein sollten, erstreckten sich ebenfalls kleinere, verästelte Landmassen. Ich musste an die Karten denken, welche im seltsamen weissen Buch abgebildet waren, ich meinte sogar, dass es Teils die gleichen Regionen zeigte, welche zumindest heute gar nicht mehr existierten.
Mit einem kleinen Photoapparat knipste ich Bilder von den Zeichnungen an den Wänden, dann wendete ich mich den steinernen Gebilden zu. Als ich diese aus der Nähe betrachtete, so erkannte ich, dass die obere Leiste tatsächlich ein Deckel war. Ich versuchte diesen ein Wenig zu bewegen und obwohl schwer, gab er tatsächlich nach.
Mein Herz raste. Es schien mir unwahrscheinlich, dass die ursprünglichen Entdecker dieses Ortes bis hierher vorgedrungen waren, da diese Sarkophage oder was auch immer sie waren, völlig unberührt schienen. Wider jede archäologische Orthodoxie entschied ich mich, diesen zu öffnen, um den möglichen Inhalt zu inspizieren. Was auch immer darin zu finden wäre könnte vielleicht Aufschluss darüber geben, was es mit diesen bizarren Gewölben auf sich hatte.
Mit grosser Sorgfalt, als dass der steinerne Deckel dieses Behälters nicht runterfalle, begann ich ihn zu öffnen, ich hob ihn leicht an und schob ihn zur Seite, dann tat ich es am anderen Ende ebenso, sodass der Deckel quer auf diesem Gebilde liegen bliebe. Da ich beide Hände benötigte, legte ich die Taschenlampe auf einen anderen der Sarkophage und liess sie nach oben leuchten. So war es gerade hell genug, dass ich erkennen konnte, was ich machte.
Nachdem ich den Deckel weit genug verschoben hatte, nahm ich die Taschenlampe an mich und bediente mich ihrer, um erstmals ins Innere dieses seltsamen Behälters zu blicken. Ich erschrak kurz, als ich im Inneren ein menschliches Skelett erblickte, oder zumindest schien es mir menschlich. Ich hatte zwar bereits die Erwartung gehabt, menschliche Überreste aufzufinden, trotzdem aber wirkte der Anblick auf mich bestürzend.
Ich starrte eine Weile wie gebannt auf den Schädel dieses Skeletts. Nach jeder Metrik handelte es sich um ein menschliches Skelett, doch etwas am Anblick des Schädels war mir befremdlich, ohne dass ich hätte definieren können, was dies sei. Ich konnte nicht erkennen, was an diesem Schädel nicht richtig war, jeder Bestandteil einzeln entsprach genau dem, was man von einem menschlichen Schädel erwarten würde, trotzdem konnte ich mich nicht vom Gedanken losreissen, das etwas an diesem Anblick unheimlich war, verstörend.
Je länger ich in den steinernen Sarg hinein starrte, umso mehr überkam mich ein Gefühl des Grauens, welches mich daran hinderte, den Blick abzuwenden. Ich meinte, dass sich etwas aus dem Sarkophag erhob. Meine Augen waren überzeugt, dass dem nicht so war, wohl aber mein Geist. Was auch immer es war, ich konnte es, obgleich nicht sichtbar, nicht hörbar und nicht spürbar, trotzdem wahrnehmen. Ich bemerkte, wie es sich erhob und den ganzen Raum erfüllte.
In dem Moment ging meine Taschenlampe anschliessend eines kurzen Flackerns aus. Trotzdem aber konnte ich diese Präsenz weiterhin wahrnehmen, sie umgab mich vollkommen und strahlte den entsetzlichsten Grauen aus, den ich mir jemals hätte vorstellen können. Mir war, als hätte ich das Tor zur wahrhaftigen Hölle geöffnet.
Von da an spürte ich nur noch wie meine Beine und mein ganzer Körper schwach wurden, ich stürzte zu Boden und verlor das Bewusstsein.
4
Ich kam kurze Zeit später wieder zu mir und tastete im Dunklen nach meiner Taschenlampe, welche nicht weit von mir auf dem Boden lag. Nach ein wenig rütteln funktionierte sie tatsächlich wieder. Mir fiel ein Stein vom Herzen, dass ich nicht im Dunkeln den Weg aus diesen Gewölben suchen müsste. Ich stand auf und musste mich erstmal fassen. Was war überhaupt passiert? Womöglich nur meine Einbildung, vermischt mit der Einwirkung irgendeines Schimmels oder einer Fäulnis innerhalb des Sarkophags, welchen ich geöffnet hatte?