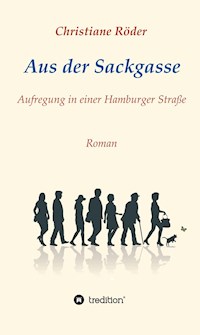
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Mensch braucht den Menschen. Ein feinfühliges Plädoyer für ein friedliches Miteinander in fremdenfeindlichen Zeiten. Was passiert, als die türkische Familie Özer ein Baugrundstück erwirbt, aber nicht alle damit einverstanden sind? Was passiert, als Uwe Hansen, ein obdachloser Mann, im Gartenschuppen von Ben und Timo Hoffmann Schutz vor dem Winter sucht? Mit diesen und anderen Ereignissen sehen sich Nanni Wolff, die Alberts, die Möllers, die Hoffmanns und Dr. Sperling konfrontiert. Sie werden aus ihrem Alltagstrott und dem anonymen Nebeneinander gerissen. Wer von ihnen stellt sich den Herausforderungen? Wie klappt es mit dem Weg aus der persönlichen Sackgasse?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Christiane Röder
Aus der Sackgasse
Aufregung in einer Hamburger Straße
Roman
© 2021 Christiane Röder
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-26925-5
Hardcover:
978-3-347-26926-2
e-Book:
978-3-347-26927-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Die einzigen wirklichen Feinde eines Menschen sind seine eigenen negativen Gedanken.
Albert Einstein
Prolog
Totalschaden würde man es bei einem Auto nennen. Ihr Heim brannte nieder, während die Schuberts zwei Straßen weiter völlig ahnungslos, nach einer vorzüglichen Ente süß-sauer, Zettelchen aus Keksen zupften und angeregt von einer der Prophezeiungen (Sie werden im nächsten Jahr im Ausland wohnen.) frei darüber fantasierten, wie es wohl wäre, wenn sie beide mit Mitte Fünfzig noch einmal ganz neu anfingen.
Unterdessen mühten sich die Feuerwehrmänner, dass für diese Fantasie keine passende Voraussetzung geschaffen würde. Vergeblich.
Zum Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, waren alle Anwohner außerhalb der Sackgasse. Die Möllers, an der Ecke, waren selten unterwegs, aber ausgerechnet an diesem Tag unternahmen sie einen Besuch auf den entfernt gelegenen Friedhof, und das war gut so, denn Wilhelm Möller hätte gewiss versucht, das Feuer eigenhändig zu löschen, und seine Frau Annegrete hätte ihn nicht davon abhalten können. Timo Hoffmann, von der gegenüberliegenden Ecke der Sackgasse, hing bei seinem Schulfreund Emre im Imbiss ab. Ben Hoffmann machte Überstunden, und sein Sohn hatte keine Lust, wieder allein zu essen. Sebastian Sperling, neben den Hoffmanns, hatte als ehrgeiziger Jurist einen Zwölf-Stunden-Tag und absolvierte danach noch einen Pflichtbesuch bei seinem Vater.
Marianne Wolff kam als Erste an besagtem Abend von einem kleinen Ausflug zu ihrer ehemaligen Arbeitsstelle am Hafen zurück. Aber da hatte sich das Feuer bereits bis in den Dachstuhl ausgebreitet. Mit zitternden Händen schaffte sie es, 112 zu wählen, und betete, dass das Feuer nicht auf ihr kleines Haus auf der einen Seite und das schöne neue Haus der Alberts auf der anderen Seite übergreifen würde. Miriam, Denis und Leonie Albert waren verreist.
Die Schuberts zogen fort und man hörte nie wieder etwas von ihnen.
1
Die Wölffin und die Alberts
Immer wieder zog es Leonie zu dem abgebrannten Haus. Miriam bemerkte es abends an den schmutzigen Schuhen ihrer Tochter. Es sei zu gefährlich dort, schimpfte sie jedes Mal, es habe seinen Grund, dass dort alles abgesperrt sei. Leonie sah das komplett anders. Schließlich war sie schon dreizehn und kein Baby mehr.
Zwischen notdürftig aufgestellten Bauzaunelementen schlüpfte sie geschickt hindurch. Luft anhalten – Bauch einziehen – und schon ging sie auf gruseligschöner, weicher Asche. Der Geruch von Verbranntem lag noch immer in der Luft, obwohl das schreckliche Ereignis schon Wochen zurücklag.
Leonie tastete sich vorsichtig an der zusammengeschmolzenen Eingangstür vorbei ins Innere. Heute war Mutprobentag. Zum ersten Mal betrat sie das Innere der Ruine. Licht zwängte sich durch das Dachgeschoss, vorbei an verkohlten Zündhölzern in Monsterformat, die dem Absturz trotzten. Ihr Herz pochte. Sie hielt sich eine Hand vor die Nase, atmete flach. Ein Lichtstrahl deutete wie ein Scheinwerfer auf eine kleine, fein berußte Dose, das Rosenmuster noch schwach erkennbar. Plötzlich ein Knarren. Bewegte sich eines der Riesen-Zündhölzer? Leonie stürzte hinaus ins grelle Licht des Sommertages, Luft anhalten – Bauch einziehen, zurück auf den Gehweg, ein rascher Blick in alle Richtungen – weiteratmen. Die schmale, kurze Sackgasse lag träge dösend in der Mittagshitze. Nur Strubbel schlich von einer Seite zur anderen, zwängte sich unter dem Gartenzaun von Dr. Sperling hindurch und verschwand. Mit dem Zipfel ihrer Bluse wischte Leonie die Rosen frei. Die Dose war leicht, war sie leer? Der Deckel klemmte. Mist.
»Na, da hast du wohl einen kleinen Schatz gefunden.«
Leonie sprang auf die Fahrbahn. Die Wölffin hatte sich angeschlichen und stand hinter ihrem Gartenzaun gleich neben der Ruine.
»Ist nur ´ne alte Dose.« Schwupps verschwand der Mutprobenfund hinter ihrem Rücken.
»Zeig doch mal her.« Die Wölffin öffnete ihre Gartenpforte.
Leonie blieb stehen. War ja klar, dass die Alte mal wieder ihre Augen überall hatte.
»Ich hab gutes Werkzeug, damit bekommen wir die Dose bestimmt auf.«
»Ich muss nach Hause. Meine Mutter wartet schon.«
»Deine Mutter ist bei der Arbeit, Leonie. Sie kommt doch erst am Abend nach Hause. Wenn du Lust hast, komm rein. Ich hab gerade frische Erdbeerschorle gemacht.«
Leonie spürte kleine Schweißperlen den Nacken hinunterlaufen. Geh auf keinen Fall zu der Wölffin rein, Leonie, hast du verstanden?
Warum wollte ihre Mutter das nicht? Gut, die Alte sah etwas merkwürdig aus mit ihren zauseligen grauen Haaren, dem T-Shirt mit BE-HAPPY-Aufdruck in ausgewaschenem Pink und Sandalen aus dem vorletzten Jahrhundert.
Die Erdbeerschorle lief jedenfalls prickelig frisch die Speiseröhre hinab, und das zweite Glas ebenfalls. Der Gartentisch war rau, kleine Splitter im farblosen Holz. Der Kater kam über den schiefen Gartenzaun am Ende des Grundstücks und strich Leonie um die Beine. Rasch zog das Mädchen die Füße hoch. Die Wölffin schenkte nach. »Da bist du ja, Strubbel, was treibst du dich bei dieser Hitze rum, leg dich zu uns in den Schatten, Herzchen.« Sie spannte den Sonnenschirm auf, kleine Löcher in verblassten Sonnenblumen. »So, jetzt hol ich mal das Werkzeug, wär doch gelacht, wenn wir die Dose nicht aufbekämen.«
Sie verschwand erneut in ihrem Hexenhäuschen mit dem windschiefen roten Dach, die Fenster so klein und schmal, dass jeder Einbrecher stecken bliebe. Was soll dort auch schon zu holen sein.
Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, um zu verschwinden.
Noch rasch einen Schluck. Da kam die Wölffin schon mit einem Schraubendreher. Im Nu war der Deckel locker, und die alte Frau gab ihr die Dose wieder, ohne hineinzuschauen.
Leonie hob vorsichtig den Deckel ab und entdeckte unzählige kleine bedruckte Zettelchen.
»Die kenn ich vom Chinesen, die sind aus den Glückskeksen.« Leonis Mundwinkel samt Schultern wanderten nach unten, trotzdem nahm sie ein Zettelchen heraus.
»Was steht drauf?« Die Wölffin beugte sich zu ihr. Sie roch nach Erdbeeren, gar nicht nach Muff, wie Mama behauptete.
»Da steht: An einem Dienstag wirst du Glück haben.«
»Das ist doch lustig, heute ist Dienstag, und wir beide lernen uns endlich mal kennen. Wenn das kein Glück ist! Schließlich wohnt ihr ja schon ein paar Monate hier.« Die Wölffin schaute ihr in die Augen. Hellblaue Augen, wie ein Husky. Sie hat so einen komischen Blick, Leonie, irgendwas stimmt mit der nicht. Mach einen Bogen um sie.
Leonie schloss hastig die Dose und schlüpfte in ihre Sandalen. »Ich muss jetzt gehen. Danke für die Erdbeerschorle.«
»Du kannst gern noch bleiben. Wir könnten Mensch-Ärgere-Dich-Nicht spielen. Hast du Lust?«
Miriam schloss die Haustür auf.
»Hallo Leo, bin wieder da. Leo?«
Warum antwortete sie nicht? Lag sie wieder mit Kopfhörern auf ihrem Bett? Bei diesem Wetter? Miriam stampfte die Treppe hinauf und klopfte an Leonies Tür. Kein Mucks. Auf dem Bett lag ihr Handy. Hatte sie sich doch mal wieder mit den Mädchen verabredet und vergessen, es ihr zu schreiben? Ein kurzer Anruf bei Emmas Mutter und Miriam erfuhr, dass die Mädchen-Clique im Schwimmbad war. Alle – außer Leo. Wo steckte ihre Tochter? Doch nicht wieder bei dem abgebrannten Haus? Miriam spürte, wie sich wieder eine dieser Hitzewellen in ihrem Körper ausbreitete und sie zum Glühen brachte. Rasch wischte sie sich den Nacken trocken und schlüpfte in ihre Sandalen. Zum Glück war das abgebrannte Haus gleich nebenan. Sie stellte sich an den Bauzaun und rief Leonies Namen. Im Nachbargarten regte sich etwas. Nur nicht hinschauen. Auf keinen Fall wollte sie mit dieser schrulligen Alten in Kontakt kommen.
»Hallo, Mama, hier bin ich.«
»Was machst du bei der W… Frau Wolff?«
»Erzähl ich dir gleich. Tschüs, Frau Wolff.« Leonie trat auf den Fußweg und umarmte ihre Mutter. Frau Wolff kam langsam ans Gartentor und winkte. »Tschüs, Leonie, bis zum nächsten Mal. Hallo, Frau Albert.«
»Hallo Frau Wolff, schönen Abend noch.« Miriam nahm ihre Tochter am Arm und schob sie schnellen Schrittes nach Hause.
»Mama, ich versteh nicht, was du gegen die Wölffin hast. Sie ist echt nett und sie riecht überhaupt nicht komisch.«
»Komm, Leo, iss deine Spaghetti, die werden sonst kalt.«
»Das ist keine Antwort, Mama.«
»Ich hab halt so ein komisches Gefühl. Sie lebt so … so anders und sieht auch nicht gerade gepflegt aus. Außerdem reden die Nachbarn auch so einiges über sie.«
»Wer? Herr Möller etwa? Der hat doch an allem und jedem was zu meckern. Bestimmt redet er auch über uns, weil Papa so oft weg ist und du so lange arbeitest.«
»Musst du noch Hausaufgaben machen?«
»Mama!«
»Ja, schau dir doch nur mal ihren Garten an. Unkraut, wohin man sieht, und das Haus ist völlig heruntergekommen. Sie hat doch seit Jahren nichts mehr machen lassen, und überall streunt ihre Katze rum.«
Leo schob mit Schwung ihren Teller von sich.
»Ah, Mama Perfect mit ihrer Tierphobie!«
»Leo, jetzt werd nicht gemein!«
»Ich geh rauf, bin müde. Die leckere Erdbeerschorle von Frau Wolff war bestimmt vergiftet, das sind die ersten Anzeichen.«
Miriam schaute ihrer Tochter nach und seufzte. Das war nun ihr Feierabend: ihre Tochter stocksauer, ihr Mann hunderte Kilometer weit weg und draußen das schönste Sommerwetter. Sie trat auf die Terrasse. Der Rasen musste gemäht werden, und das Unkraut zwischen den Terrassenfliesen wuchs drauflos, als wollte es einen Rekord brechen. War Denis das am Wochenende nicht aufgefallen? Immer blieben die stupiden Arbeiten in Garten und Haus an ihr hängen. Wie machte man eigentlich Erdbeerschorle? Im Internet fand sie ein Rezept mit frischen Erdbeeren, Pfefferminzblättern, Honig und Zitronensaft. Klang lecker.
Es klingelte an der Tür.
»Hallo, Frau Albert, meinem Strubbel geht es plötzlich schlecht. Könnten Sie uns zum Tierarzt fahren? Die Sprechstunde ist gleich vorbei, und ich hab doch kein Auto.«
Die Wölffin knetete ihre abgewetzte Handtasche. Neben ihr auf dem Boden im Transportkorb lag der Kater, flach und schnell atmend.
»Warten Sie, ich hol nur meine Schlüssel.«
»Oh, Gott, hoffentlich hat er kein Gift gefressen.« Die Wölffin schnallte sich an. »Es kam so plötzlich.«
»Der Arzt wird ihm schon helfen. Es ist ja nicht weit.” Miriam musste an die Fahrt ins Krankenhaus denken, als Leonie noch ein Baby war. Um Mitternacht waren sie mit ihr losgefahren, weil sie so schrie und überall Ausschlag hatte. Denis hatte damals die Ruhe bewahrt, während sie schluchzend die Kleine schaukelte.
Mist, sie hatte vergessen ihrer Tochter Bescheid zu geben, und das Handy nicht eingesteckt! Die Wölffin drehte sich immer wieder zu dem Kater auf der Rückbank um. Miriam nahm einen frischen Duft nach Pfefferminze wahr.
Als die Wölffin wenig später aus dem Sprechzimmer des Tierarztes kam, hatte sie gerötete Augen und suchte etwas in ihrer Handtasche. »Ich hatte doch Taschentücher.«
Miriam griff in ihre Rocktasche. «Hier, es ist noch unbenutzt.«
Langsam gingen sie die Fußgängerzone in Richtung Auto.
»Der Arzt sagt, dass Strubbel es vielleicht nicht schaffen wird. Er hat vermutlich Gift gefressen. Mein armer kleiner Strubbel. Ich wär so gern bei ihm geblieben, aber das ging nicht.«
»Sie werden sich bestimmt gut um ihn kümmern. Das ist ein sehr guter Tierarzt, hab ich gehört.«
Die Wölffin blieb stehen, kramte wieder in ihrer Handtasche und gab einer Frau, die auf dem Fußweg saß, ein paar Münzen. Miriam nahm die Frau mit ihren schmutzigen Händen erst jetzt wahr.
Sie gingen weiter.
»Ich kann einfach nicht vorbeigehen. Auch wenn´s mir noch so schlecht geht. Hab früher mit Obdachlosen gearbeitet.«
»Mmmh.« Miriam dachte an ihre Desinfektionstücher, die sie stets im Auto hatte, und fand den Gedanken daran plötzlich peinlich. War vielleicht was dran an Mama Perfect?
Die Wölffin schaute beim Einsteigen auf die leere Rückbank und seufzte. Als sie in die Sackgasse einbogen, standen die Möllers auf dem Fußweg. Miriam sah im Rückspiegel, wie sie hinter ihrem Auto her schauten.
Sie grinste. »Da haben die Möllers heute Abend ja richtig was zum Grübeln. Wir beide in einem Auto.«
»Wollen wir uns nicht duzen? Ich heiße Marianne, aber alle nennen mich Nanni.«
Als das Auto auf der Auffahrt zum Stehen kam, reichte sie Miriam die Hand, und die junge Frau griff zaghaft zu. »Ich heiße Miriam.«
»Danke, dass du mich und Strubbel gefahren hast, Miriam. Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn ich etwas vom Tierarzt höre.«
»Ja,… mach das gern …, Nanni.«
Miriam warf die Schlüssel auf die Kommode und schlüpfte aus den Sandalen. »Bin wieder da, Leo!«
»Wo warst du, Mama?” Das Mädchen kam aus dem Wohnzimmer geflitzt und umarmte sie. Miriam drückte ihre Tochter. Schön, dass ein Streit mit ihrer Dreizehnjährigen so schnell verflog, wie er gekommen war.
»Ich war mit Nanni beim Tierarzt. Strubbel geht es schlecht. Er hat vermutlich Gift gefressen.«
Leo sah sie mit zusammengekniffenen Augenbrauen an. Miriam musste lachen. »Welches meiner Wörter hast du nicht verstanden, mein Schatz?«
»Nanni?«
Einige Tage später …
»Bist du eigentlich mal wieder im abgebrannten Haus gewesen?« Nanni stellte Müsli und kalte Milch auf den Tisch.
»Nö, ich komm jetzt nachmittags lieber zu dir.« Das Mädchen füllte sich eine große Schale bis zum Rand.
»Das freut mich.« Nanni legte ihre Hand auf Leos Schulter.
»Und deinen Eltern ist es inzwischen auch recht?«
»Ja, Mama ist total entspannt, weil sie weiß, wo ich mich jetzt nachmittags rumtreibe.« Leo machte mit den Fingern Gänsefüßchen in die Luft. »Außerdem schwärmt sie jeden Tag von deinem Salbeitee, der ihr so gut hilft wegen ihrer Hitze. Papa weiß noch gar nicht so viel von dir, der ist auf einer Messe in München.«
»Morgen Nachmittag bin ich vielleicht noch nicht da, wenn du aus der Schule kommst. Ich will zu meinem alten Arbeitsplatz ins CaFée mit Herz.« Nanni kritzelte den Namen auf ein Stück Papier.
»Das ist ein schöner Name, Nanni. In CaFée steckt die Fee. Schade, dass ich nicht mitkommen kann. Blöde Schule. Warum heißt das so?« Leo schob den nächsten Löffel nach.
»Das CaFée ist für Menschen, die obdachlos sind. Sie können dort essen, duschen, Kleidung bekommen und klönen. Es ist wie ein Hafen für Menschen und eine gute Fee.«
»Warum gibt es eigentlich Obdachlose?« Leo wischte sich den Milchbart mit dem Handrücken ab.
»Ach, Herzchen, manch einer hat es schwer im Leben und gerät aus der Bahn. Er wird arbeitslos, kann die Miete nicht mehr bezahlen, die Familie bricht vielleicht auseinander. Ein Umzug in eine günstigere Wohnung ist schwierig, weil es davon zu wenig gibt. Tja, und dann hat man plötzlich kein Dach mehr über dem Kopf.«
»Papa sagt, dass niemand auf der Straße leben muss.«
»Glaub mir, das macht keiner freiwillig und gern.«
»Vielleicht werde ich später Bürgermeisterin und lass ganz viele Wohnungen bauen.«
»Toll, werd schnell erwachsen, dann wähle ich dich. Unsere Bürgermeister haben es bisher alle nicht geschafft. Aber dafür haben wir jetzt eine schöne Elbphilharmonie und eine Hafencity.« Nanni stand abrupt auf. »Ich schau mal, ob Strubbel an sein Fressen gegangen ist. So ganz der Alte ist er noch nicht wieder.«
»Wollen wir gleich noch ein Spiel spielen, Nanni?” Leo rief mit vollem Mund hinter ihr her. »Und du wolltest mir auch noch deine Duftdosen-Sammlung zeigen.« Ihr Handy summte.
Es war Papa. Er war eher zurückgekommen als geplant und saß schon im Taxi vom Flughafen nach Hause. Sie schrieb ihm, wo er sie finden könne, und drehte ihr langes blondes Haar um den Finger, wie immer, wenn sie aufgeregt war. Jetzt würden Papa und Nanni sich auch kennenlernen!
»Sagt mal, ihr zwei, was ist das eigentlich mit dieser Nanni? Ich hab sie ja vorhin das erste Mal gesehen … «
»Ja?« »Ja?« Leo und Miriam schauten von ihrem Nachtisch auf.
»… ich finde sie ziemlich … wie soll ich sagen … crazy. Ich weiß nicht, ob sie so der richtige Umgang für dich ist, Leo. Allein das Haus und ihre Kleidung, ganz zu schweigen von dem Garten – der geht ja gar nicht. Ich finde, sie sollte sich lieber auf den Anbau von Kräutern konzentrieren, statt sich um Nachbarskinder zu kümmern.«
Leo griff nach ihrem Haar und sah, wie ihre Mutter mit Schwung ihr Schälchen von sich schob, einen Schluck von dem Salbeitee nahm und tief Luft holte.
2
Die Möllers
»Annegrete, Salz!«
Sie zuckte zusammen und glitt mit dem Messer ab. Die Brotscheibe war nicht mehr zu retten. Sie schob sie ganz nach unten. Langsam schlurfte sie ins Esszimmer und stellte den Brotkorb auf den Tisch. Ihr Mann legte den Löffel neben den Teller und schaute sie an. »Und wo ist das Salz? Die Suppe ist wieder mal viel zu fade.« Seine Augenbrauen bildeten einen durchgehenden Balken über dem stechenden Blick.
»Ach, hab´s vergessen.« Auf dem Weg durch den Flur in die Küche schaute sie lächelnd auf ihre Handtasche. Gleich war Tagebuchzeit. Er musste nur erst richtig tief im Mittagsschlaf sein, damit sie die knarrende Treppe hinauf schleichen konnte, um in Ruhe zu schreiben. Ihr Herz stolperte kurz, als sie sich zu ihm an den Esstisch setzte.
»Was stöhnst du wieder, Annegrete?«
»Ach, das blöde Herz. Ist in letzter Zeit etwas schlimmer.«
»Komm jetzt nicht wieder mit der Idee, eine Putzfrau einzustellen.«
Er streute im hohen Bogen Salz in seine Suppe.
»Ich hab doch gar nichts gesagt, Wilhelm. Vielleicht könntest du ja ab und an mal ein wenig mit anpacken.« Ihr Herz stolperte wieder.
»Warum saß die Wolff eigentlich bei der Albert im Wagen neulich?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Na, ihr Frauen sprecht doch seit dem Brand ab und zu miteinander.«
»Ich hab nur gesehen, dass Leonie Frau Wolff nachmittags besucht hat.«
Sollte sie ihm sagen, woran es ihrer Meinung nach lag, dass man ihnen aus dem Weg ging? Nein, das war etwas für ihr Tagebuch. Sie musste auf ihr Herz Rücksicht nehmen.
»Übrigens ich werde den Hoffmanns noch einen zweiten Brief in den Kasten werfen. Danach schalte ich den Anwalt ein.«
»Ach, Wilhelm, warum musst du dich mit allen anlegen? Ist kein Wunder, dass niemand mehr mit uns spricht.« Jetzt war es doch rausgerutscht. Rasch griff sie hinter ihr Ohr und stellte die Hörgeräte leiser.
Wilhelm warf seinen Löffel in die Suppe. »Wie oft soll ich es dir noch sagen, dass man sich auf dieser Welt nichts gefallen lassen darf. Man muss kämpfen und darf sich nicht unterbuttern lassen.«
»Aber du hörst die Musik der Hoffmanns doch gar nicht, wenn du deine Hörgeräte abends rausgenommen hast.«
»Darum geht es nicht. Es geht um Rücksichtnahme und Gesetze.«
Sie erhob sich, stützte sich dabei auf dem Tisch ab, trug die Teller in die Küche und kam mit einem Wischtuch zurück. Schweigend entfernte sie die Suppenreste, während er vor dem Fenster stand und zu den Hoffmanns hinüberschaute. Die Arme vor der Brust verschränkt, beobachtete er Timo Hoffmann, der gerade sein Fahrrad über die Auffahrt schob. »Na, der Bengel hat schon wieder Schulschluss. Als ich in seinem Alter war, musste ich arbeiten. Nichts mit Abitur und so. Deutschland musste wieder aufgebaut werden.«
»Weiß ich doch, Wilhelm.«
Sie stellte sich neben ihn ans Fenster. »Guck mal, Timos Fahrradkette ist ab.«
»Das kann der doch nie im Leben selbst reparieren, geschweige denn sein Vater in seinem piekfeinen Anzug. Der macht sich doch nicht die Finger schmutzig.«
Wieder das Herz. Dieses Mal besonders heftig. Ihr wurde schwindelig. Druck, als würde jemand eine Gehwegplatte auf ihre Brust stemmen. Übelkeit stieg auf. Sie sank zitternd auf den Stuhl.
»Was ist mit dir?«
»Weiß nicht, grade ganz schlimm.« Sie fasste sich an den Brustkorb, rang nach Luft. Er stürzte zum Telefon, meldete Verdacht auf Herzinfarkt und forderte sehr laut einen Rettungswagen mit Notarzt. Gut, dass er alles darüber gelesen hatte. So lagerte er seine Frau auf dem Sofa mit aufrechtem Oberkörper und wärmte sie mit einer Decke. Ihre kalten Hände, die keine Ruhe fanden, nahm er in seine. Nach endlosen Minuten kam der Rettungswagen.
Sie hatten seine Annegrete auf die Intensivstation geschoben und ihn nach Stunden des Wartens nach Hause geschickt. Er könne jetzt doch nichts für sie tun. Da stand er nun, mitten im Wohnzimmer, in der Hand noch ihre Handtasche. Die Krankenkassenkarte war darin nicht zu finden gewesen, dafür dieses dicke Schreibheft, auf dem Tagebuch stand, und der silberne Stift, den Jakob ihr an ihrem letzten gemeinsamen Weihnachtsfest geschenkt hatte.
Er machte sich die restliche Suppe warm. Salzstreuer und Brot standen noch auf dem Tisch, daneben das zusammengeknüllte Wischtuch. Die Suppe schmeckte ihm nicht. Das Brot war schief geschnitten.
Als er auf die Terrasse trat, knipsten die Nachtkerzen gerade ihre Lichter an, wie Annegrete es nannte, wenn die Blüten in der Abenddämmerung gelb leuchtend aufsprangen. Nebenan klappte Frau Wolff ihre Gartenstühle zusammen. Er räusperte sich laut und wartete. Hatte sie ihn nicht gehört?
»Guten Abend, Frau Wolff.«
»Guten Abend, Herr Möller.« Frau Wolff räumte weiter zusammen.
»Meine Frau ist heute ins Krankenhaus gebracht worden.« Er stellte sich an die kleine Lücke in der Eibenhecke, die nicht zuwachsen wollte. »Verdacht auf Herzinfarkt.«
»Oh, das ist ja schrecklich.« Die Nachbarin trat an die Hecke. »Das tut mir leid, Herr Möller. Gute Besserung für Ihre Frau und viele Grüße.«
»Ja, danke, Frau Wolff, werde ich ihr ausrichten.« Er bückte sich und riss an der verflixten Ackerwinde, die hier immer wieder ihren Weg über die Hecke suchte, Teufelszeug. Es schwindelte ihn, als er wieder hochkam. Frau Wolff schloss gerade ihre Terrassentür.
Er hatte die Hörgeräte noch nicht abgelegt, da ging es los mit der lauten Musik. Wutentbrannt stürmte er hinaus und klingelte gegenüber bei den Hoffmanns. Nichts passierte. Kein Wunder, die Klingel war nicht zu hören bei dem Lärm. Mit der Faust schlug er gegen die Tür. »Ruhe!«
Gerade wollte er erneut ausholen, als Timo die Tür öffnete. Die Musik schwappte über ihn wie eine riesige Welle, er rang nach Luft, dann wurde alles schwarz.
»Herr Möller, hören Sie mich, hallo, Herr Möller?«
Er öffnete die Augen und sah Timo über sich. Harte, kalte Gehwegplatten unter ihm, aber sein Kopf lag weich, ein Kissen.
»Was ist passiert?«
»Ich glaub, Sie sind kurz ohnmächtig gewesen.«
»Die verdammte Musik hat mich umgehauen.« Er stützte sich auf den Ellenbogen, der schmerzte.
»Bleiben Sie doch liegen. Soll ich einen Notarzt rufen?«
»Blödsinn, mir geht´s wieder gut.« Ein stechender Kopfschmerz, als er aufstand, und sein rechtes Knie weich wie Pudding.
»Danke für das Kissen.«
»Tut mir leid wegen der Musik. Soll ich Sie rüberbringen?«
Er winkte ab.
»Ich hab gesehen, wie Ihre Frau vorhin abgeholt wurde. Ist sie im Krankenhaus?«
»Ja. Verdammt.«
Langsam wankte er über die Straße auf die offene Haustür zu.
»Ich klingel morgen mal bei Ihnen, Herr Möller.« Timo hob das Kissen auf und winkte zu ihm rüber.
Wilhelm Möller schloss die Tür. Heute Morgen war die Welt noch in Ordnung gewesen.
In der Nacht wälzte er sich von einer Seite auf die andere. Die Informationen aus dem Krankenhaus am späten Abend wiederholten sich wie in einer Warteschleife: Ihre Frau ist noch nicht über den Berg. Sie wird morgen voraussichtlich operiert. Bleiben Sie zu Haus und gehen Sie schlafen … bleiben Sie zu Haus … sie wird morgen operiert … noch nicht über den Berg …
Eine warme Honigmilch würde helfen. Welchen Topf nahm sie immer dafür? Er verbrannte sich die Zunge an der viel zu süßen Milch, und am Topfboden klebte am Ende eine hartnäckige braune Schicht. Verdammt.
Im Wohnzimmer lag noch ihr Tagebuch. Tagebücher waren eigentlich etwas ganz Persönliches. Er ließ die Seiten durch seine Finger gleiten und sah im Vorbeiziehen die schöne, gleichmäßige Handschrift seiner Frau. Wieso hatte er sie nie darin schreiben sehen? Er schluckte, die Zunge schmerzte noch.
Er erwachte mit einem stumpf-säuerlichen Geschmack im Mund, und die Sonne blendete ihn. Mit Schmerzen im Rücken und im Ellenbogen erhob er sich vom Sofa. Bei der Morgentoilette stieß er versehentlich ihr Eau de Toilette ins Waschbecken. Es verströmte seinen blumigen Duft. Er wollte ihr heute unbedingt ein paar Sachen vorbeibringen, und wehe die schickten ihn wieder weg!
Es klingelte an der Tür. Wer konnte das sein? Doch wohl nicht dieser Bengel. Er öffnete einen Spalt.
»Hallo, Herr Möller, ich wollte mal hören, wie es Ihnen heute geht?«
»Geht mir gut, danke.« Schnell den Spalt wieder zu.
Es klingelte. »Was ist denn noch?«
»Ich hab Ihnen zwei Brötchen mitgebracht.«
»Nein, danke, kein Bedarf.« Zack – zu den Spalt.
Brötchen! Womöglich noch diese Dinger mit den ganzen Körnern, die sich überall unter die Prothese setzten und so viel kosteten wie ein halbes Brot.
Wieder die Klingel. »Herr Möller, ich kann die Brötchen auch nicht essen, da ist Gluten drin.«
»Was ist da drin?«
»Gluten. Ist im Mehl. Krieg ich Durchfall von.«
»Ich hab die Brötchen nicht bestellt.«
»Ich weiß. Ich dachte, ich mach Ihnen eine Freude.« Timo schaute ihn nicht an und quetschte die Tüte durch den Türspalt.
»Mann, bist du hartnäckig. Dann bezahl ich dir die blöden Dinger eben, warte hier.«
Der Junge folgte ihm schnurstracks in die Küche. »Ist das angebrannte Milch?«
»Was?« Wilhelm holte etwas Kleingeld aus einer Dose.
»Na, das da im Topf.«
»Ja.«
»Einfach noch mal mit Wasser und Spülmittel aufkochen, dann geht´s leicht ab.«





























