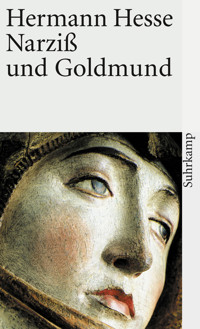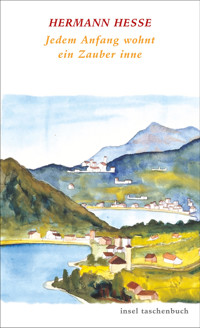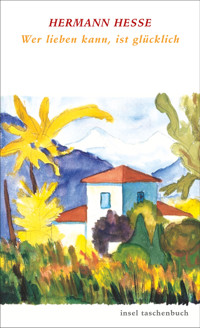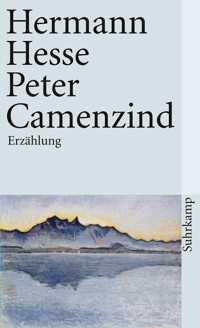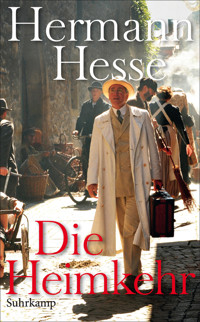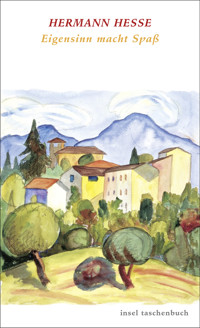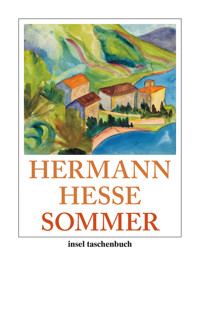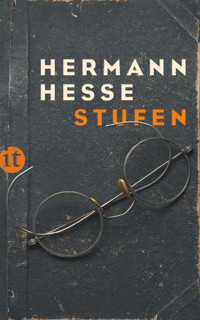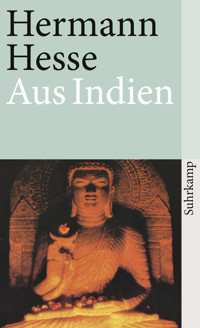
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Überdrüssig der allzulangen Seßhaftigkeit und Gebundenheit an sein erstes, 1907 in Gaienhofen am Bodensee gebautes Haus, begab sich Hesse, damals 34jährig und Vater von drei Kindern, auf die längste Reise seines Lebens. Das Reiseziel war Indien, das Land, in welchem seine Großeltern und Eltern zur Verbreitung des protestantischen Christentums missioniert hatten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Überdrüssig der allzu langen Seßhaftigkeit und Gebundenheit an sein erstes, 1907 in Gaienhofen gebautes Haus, begab sich Hermann Hesse auf die längste Reise seines Lebens. Das Reiseziel war Indien, das Land, in dem seine Großeltern und Eltern zur Verbreitung des protestantischen Christentums missioniert hatten. Für Hesse galt es, seine über die Familie vermittelten theoretischen Kenntnisse der Traditionen des geistigen Indien mit der Realität zu konfrontieren. So ernüchternd diese Konfrontation zunächst ausfallen mußte, war ihre Nachwirkung und Verarbeitung doch so intensiv und fruchtbar, daß sie den Dichter dazu befähigte, das missionarische Erbe seiner Vorfahren in einem umgekehrt wirkenden Religionsverständnis fortzusetzen und mit Büchern wie Siddhartha, Die Morgenlandfahrt und Das Glasperlenspiel einen west-östlichen Dialog anzuregen, einen gleichberechtigten Austausch zwischen den abenländischen und den asiatischen Polaritäten und Religionen, die sich für Hesse nicht ausschließen, sondern ergänzen.
Hermann Hesse, am 2. Juli 1877 in Calw/Württemberg geboren, 1946 ausgezeichnet mit dem Nobelpreis für Literatur, starb am 9. August 1962 in Montagnola bei Lugano.
Hermann Hesse
Aus Indien
Aufzeichnungen, Tagebücher, GedichteBetrachtungen und Erzählungen
Um Texte aus dem Nachlaß erweitertvon Volker Michels
Suhrkamp
Die 55 Abbildungen dieses Bandes stammen aus dem Bildnachlaß Hermann Hesses (Deutsches Literaturarchiv Marbch/Neckar und Schweizerische Landesbibliothek, Bern), aus dem Nachlaß Hans Sturzeneggers (Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen) sowie aus dem Archiv der Basler Mission.
Den Mitarbeitern dieser Institutionen gilt unser Dank.
eBook Suhrkamp Berlin 2013
Hinweise zur Textgrundlage:
Der vorliegende Text folgt der 15. Auflage 2012 der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 562.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Kay Maeritz/Look-foto
Umschlaggestaltung: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-73573-2
www.suhrkamp.de
Inhalt
Aufzeichnungen von einer indischen Reise
Gegenüber von Afrika
Nachts im Suezkanal
Abend auf dem Roten Meer
Ankunft in Ceylon
Die Nikobaren
Nachts in der Kabine
Abend in Asien
Der Hanswurst
Überfahrt
Fluß im Urwald
Pelaiang
Waldnacht
Pelaiang
Nacht auf Deck
Palembang
Kein Trost
Architektur
Wassermärchen
Die Gräber von Palembang
Sozieteit
Maras
Im malayischen Archipel
Augenlust
Nachtfest der Chinesen in Singapur
Spazierenfahren
Singapur-Traum
Bei Nacht
Indische Schmetterlinge
Tagebuchblatt aus Kandy
Spaziergang in Kandy
Pedrotallagalla
Vor Colombo
Rückreise
Reisende Asiaten
Drei Briefe
Chronologie der Reise nach Indonesien
Notizen von der Indonesienreise
Indische Weisheit
Chinesen
Erinnerung an Asien
Meisterwerke orientalischer Literaturen
Indische Märchen
Erinnerung an Indien
Keyserlings Reisetagebuch
Aus einem Tagebuch 1920/21
Aus Brahmanas und Upanishaden
Die Reden Buddhas
Exotische Kunst
Besuch aus Indien
Indisches
Hinduismus
Aus Indien und über Indien
Sehnsucht nach Indien
Über mein Verhältnis zum geistigen Indien und China
Blick nach dem Fernen Osten
Erzählende Schriften:
Legende vom indischen König
Die Braut
Robert Aghion
Der Waldmensch
Indischer Lebenslauf
Quellennachweise
Aufzeichnungen von einer indischen Reise
Hermann Hesse, 1912, portraitiert von Hans Sturzenegger
Gegenüber von Afrika
Heimathaben ist gut,
Süß der Schlummer unter eigenem Dach,
Kinder, Garten und Hund. Aber ach,
Kaum hast du vom letzten Wandern geruht,
Geht dir die Ferne mit neuer Verlockung nach.
Besser ist Heimweh leiden
Und unter den hohen Sternen allein
Mit seiner Sehnsucht sein.
Haben und rasten kann nur der,
Dessen Herz gelassen schlägt,
Während der Wandrer Mühsal und Reisebeschwer
In immer getäuschter Hoffnung trägt.
Leichter wahrlich ist alle Wanderqual,
Leichter als Friede finden im Heimattal,
Wo in heimischer Freuden und Sorgen Kreis
Nur der Weise sein Glück zu bauen weiß.
Mir ist besser, zu suchen und nie zu finden,
Statt mich eng und warm an das Nahe zu binden,
Denn auch im Glücke kann ich auf Erden
Doch nur ein Gast und niemals ein Bürger werden.
Nachts im Suezkanal
Seit zwei Stunden wird das Schiff von Moskitos belästigt; es ist sehr warm, und die heitere Stimmung vom Mittelmeer hat sich erstaunlich rasch verloren. Viele fürchten sich einfach vor der berüchtigten Hitze im Roten Meer, die meisten aber kehren von kurzen Ferien und Besuchen in der Heimat zurück oder reisen zum ersten Male aus, und für sie alle beginnt jetzt erst die Heimat unterzusinken, und mit der Wärme, dem Sand, den frühen Sonnenaufgängen und den Moskitos überfällt sie der Osten, den sie alle nicht lieben, obwohl und weil sie draußen ihr Geld verdienen. Nur im Restaurant der zweiten Klasse zechen ein paar junge Deutsche, die meisten Passagiere sind schon in den Kabinen. Der ägyptische Quarantänebeamte, der unser Schiff seit Port Said begleitet, marschiert mißmutig auf und ab.
Ich versuche zu schlafen. Ich lege mich in meiner winzigen Kabine aufs Bett, über mir saust schnurrend der elektrische Fächer, im kleinen runden Fensterloch steht schwarzblau die heiße Nacht, knisternd singen die kleinen Stechmücken. Seit Genua war keine Nacht an Bord so still; seit Stunden kein Geräusch als das leise Rollen eines Eisenbahnzuges von Kairo, der auf dem langen öden Damm auftauchte, in gespenstischer Nachbarschaft vorüberschnob und wunderlich im Röhricht der weiten kahlen Landschaft verschwand.
Noch ehe der Schlummer kommt, schreckt mich das plötzliche Verstummen der Maschine auf. Wir liegen still. Ich kleide mich an und gehe aufs Oberdeck. Ringsum eine unerhörte Stille, vom Sinai her kommt der abnehmende Mond, bleiche Sandhaufen schauen im vorübergleitenden Blick entfernter Scheinwerfer tot und glanzlos auf, im unendlichen schwarzen Wasserstreifen blinken grelle giftige Reflexe, unterm schweren matten Mond zucken hundert Seen, Sümpfe, Lachen, Binsenteiche gelb und lieblos aus der traurigen Ebene. Unser Schiff fährt nicht mehr, kein Ruf oder Pfiff, es liegt regungslos, verzaubert, aber voll tröstender Wirklichkeit in der Wüste.
Auf dem Hinterdeck treffe ich einen kleinen, eleganten Chinesen aus Schanghai. Er lehnt aufrecht an der Brüstung und verfolgt die Scheinwerfer mit seinen dunklen, klugen Augen, und er lächelt dazu so hübsch wie immer. Er kann das ganze Shi-King1 auswendig, er hat alle chinesischen Examina gemacht und jetzt auch noch einige englische, er spricht über das Mondlicht über dem Wasser zart und nett in geläufigem Englisch und macht mir Komplimente über die schönen Landschaften Deutschlands und der Schweiz. Es fällt ihm nie ein, China zu rühmen, aber wenn er Lobendes über Europa zu sagen hat, klingt es bei aller Höflichkeit so überlegen, wie wenn der große Bruder nett ist und dem kleineren zu seinen starken Armen gratuliert. Wir wissen alle, daß in China gerade in diesen Tagen die große Revolution neu beginnt2, die vielleicht dem Kaiser den Kopf kosten wird, und unser kleiner feiner Mann aus Schanghai weiß sicher weit mehr als wir und ist vielleicht gar nicht zufällig gerade jetzt unterwegs. Aber er ist still und arglos wie ein Berggipfel in der Sonne und strahlt in seiner höflich verschanzten Heiterkeit alle irgend unbequemen Fragen mit einer gewinnenden Sonnigkeit zurück, die uns alle verwirrt und mich entzückt.
Am Ufer erscheint ein lichter kleiner Fleck. Es ist ein weißer Hund, er läuft eine kleine Strecke weit den Strand entlang, streckt den mageren Hals lang aus und schaut zu uns herüber. Aber er bellt nicht. Er schaut eine Weile scheu und still herüber, riecht am trüben Wasser und trabt lautlos davon, immer der schnurgeraden Uferlinie nach.
Der Chinese redet von den europäischen Sprachen, er rühmt die Bequemlichkeit des Englischen und den Wohllaut des Französischen, er bedauert entschuldigend, daß er nur ganz wenig Deutsch und gar kein Italienisch gelernt hat. Er lächelt dazu lieb und wohlgestimmt und folgt mit den feuchten, klugen Augen den Bewegungen der Schiffslichter.
Unterdessen fahren zwei große Dampfer langsam und unendlich behutsam an uns vorüber. Unser Schiff ist am Ufer angebunden. Der große Kanal ist kostbar und gebrechlich und wird wie Gold geschont.
Ein englischer Beamter aus Ceylon tritt zu uns. Wir stehen lange und sehen ins tote Wasser, der Mond beginnt schon wieder zu sinken. Ich habe das Gefühl, ich sei seit Jahren von der Heimat fort. Nichts spricht zu mir, nichts ist mir nah und lieb, nichts tröstet mich als unser gutes Schiff. Die paar Bretter und Klammern und Lichter sind alles, was ich habe, und es macht mich unruhig, nach so viel Tagen plötzlich den vertrauten Herzschlag der Maschine nimmer zu hören und zu spüren.
Der Chinese redet mit dem englischen Beamten über Gummipreise, und ich höre immer wieder das Wort Rubber, das ich vor zehn Tagen noch nicht kannte und das mir jetzt so geläufig ist, das beherrschende Wort des Ostens. Er redet sachlich, hübsch und höflich, und er lächelt immerzu im fahlen elektrischen Licht, wie ein Buddha.
Der Mond hat seinen kleinen Bogen beschrieben, er neigt sich und versinkt hinter den grauen Schutthalden, und mit ihm versinken die hundert kühlen, übelwollenden Blinklichter der Sümpfe und Seen, die Nacht steht dick und schwarz, scharf durchschnitten von den Lichtbahnen der Scheinwerfer, die ebenso unheimlich und lautlos und unendlich geradlinig sind wie der furchtbare Kanal selber.
Abend auf dem Roten Meer
Von brennenden Wüsten her
Zittert ein giftiger Wind,
Dunkel wartet das wenig bewegte Meer,
Hundert hastige Möwen sind
Durch die offene Hölle unsre Begleiter.
Blitze reißen kraftlos am Himmelsrand,
Keines Regens Wohltat kennt dieses verfluchte Land.
Drüben aber steht licht und heiter
Eine friedliche Wolke allein;
Die hat uns Gott dahin gestellt,
Daß wir nicht länger trostlos sein
Und einsam leiden mögen in dieser Welt.
Niemals will ich die Öde unermessen
Und nie diese quälende Hölle vergessen,
Die ich am heißesten Ort der Erde fand;
Daß aber darüber die lächelnde Wolke stand,
Soll mir ein Zeichen sein für die lastende Schwüle
Die ich in meines Lebens Mittag mir nahen fühle.
Ankunft in Ceylon
Hohe Palmen am Strand,
Leuchtende See und nackte Rudrer im Boot,
Uralt heiliges Land,
Ewig vom Feuer junger Sonne umloht!
Blaues Gebirg verliert sich in Dunst und Traum,
Gipfel blenden, man sieht sie vor Sonne kaum.
Grell empfängt mich der Strand:
Seltsame Bäume starren streng in die Luft,
Häuser taumeln farbig im Sonnenbrand,
Menschengetöse aus schillernden Gassen ruft.
Dankbar flüchtet mein Blick ins Gedräng –
Nach unendlicher Seefahrt welch süßer Tausch!
Und mein Herz wird vor Freude eng,
Schlägt wie vor Liebe im seligen Reiserausch.
Die Nikobaren
Viele lange Tage hatten wir kein Land gesehen, nichts als rings die ewige blauschwarze Scheibe des Indischen Ozeans, die silbern und rosig vor dem Flug hinweg stiebenden Scharen der fliegenden Fische und den sonnenglühenden Himmel ohne Dunst, ohne Wolke und nachts die ungeheure Weite des Sternenraums, strahlend in sattem Dunkelblau. Dann war Colombo gekommen, eine weiß zischende Brandung und rotes Land dahinter: staubwirbelnde rote Straßen, farbige Häuser, im Sonnenbrand zitternd mit fliehenden Umrissen, schöne, schwarzbraune Singalesen, traurig aus mageren Prinzengesichtern und edel ergebenen Rehaugen blickend, weithin wehende Palmenwelt, von Vögeln und Schmetterlingen farbig umschwirrt, ferne, blaue Gebirge, phantastisch schön und hochragend. Es war wie ein schöner, unwahrscheinlicher Traum dagewesen und verschwunden, dieses farbige Ceylon, unwirklich und märchenhaft in der grellen Farbenfülle seiner Erscheinungen. Diese heftigen und etwas theaterhaften Eindrücke waren plötzlich wieder untergesunken und weg, wir fuhren wieder auf dem unendlichen Meere dahin, Tag um Tag, Nacht um Nacht.
Hesse (Mitte) und Mitreisende an Bord der »Prinz Eitel Friedrich«
Wenn man nicht gerade bei Tische saß oder in abendlicher Gesellschaft beisammen war, lag auf allen Gesichtern eine traurige Öde und Gedämpftheit, jener Ausdruck von Welke und müder Apathie, den man bei allen Menschen trifft, die sehr viel auf Reisen sind, vereinigt mit der Mattigkeit und nervösen Unfrische, die den Weißen in den Tropen anhaftet. Still und gesittet lagen sie alle in ihren Deckstühlen, die weißbeschuhten Füße gegen die Reeling gekehrt, die Engländer und Amerikaner mit ihren Frauen, die deutschen Kaufleute und Geologen, die halbfarbigen Damen aus Manila. Alle lagen sie still und beherrscht und niemand klagte; aber alle Gesichter waren unheimlich erloschen, nur ein paar Kinder, Portugiesen, liefen munter umher. Einige junge Deutsche brachten unter der Führung eines alten Australienkapitäns den halben Tag im Rauchsalon zu, und es war ihre Schuld, daß wir schon vor Penang kein deutsches Bier mehr an Bord hatten, alles soffen sie weg; das beinerne Klappern ihrer Würfel tönte geheimnisvoll und diskret stundenlang durch die Luken wie das Geräusch eines unbekannten Gewerbes. Drüben in der zweiten Klasse, wo man schlechter vor der Sonne geschützt war und enger beieinander hockte, sah man lauter ermüdete, feindselige Gesichter leer und gelangweilt in die ewige Meeresöde starren. Nur wenn der junge Schiffsarzt lachend seine Runde machte oder einer der Offiziere mit dem frischen Gesicht und dem etwas ironischen Blick durch die Reihen ging, strahlte für Augenblicke etwas wie Munterkeit und Interesse auf. Diese Offiziere und Matrosen waren nicht in den Tropen, sie waren nicht wie wir mit ihren Gedanken und Sorgen müßig in der Einöde unterwegs, verloren, untätig; sie waren hier zu Hause, sie waren auf ihrem Schiff, in ihrer Heimat, da wehte norddeutsche Zucht und Sauberkeit.3 Für die Schiffsleute waren die fernen dunklen Küsten und die grellen Hafenstädte Asiens nicht Orte der Hoffnung, der Sorge oder Gefahr, sondern lediglich exotische Schmutzwinkel, deren Berührung ihr reinliches Schiff kaum dulden mochte und deren Spuren man bei jeder Ausfahrt eiligst mit Lappen und Wasserströmen von Bord fegte. Wir andern aber, wir waren bloß Passagiere, uns war das Schiff nicht Heimat und Arbeitsstätte, uns lockten und bedrohten jene dunklen Küsten, jene schimmernden Städte, jene fieberbleichen Waldsäume der Inseln.
Eines Vormittags lehnte ich an der Reeling, melancholisch an die Weite und Trauer des ungeheuren leeren Horizonts hingegeben: nichts als das dunkle, kreisrunde Meer in seiner grausigen Unendlichkeit, darüber die einsame, feindlich brennende Sonne und inmitten verloren und sinnlos hinschleichend unser Schiff! Mochte da drüben, wohin unser Blick nicht reichte, Indien oder China, Amerika oder Honolulu liegen, es war ohne Bedeutung; unsere Wirklichkeit bestand einzig darin, daß wir wie ein verirrter kleiner Weltkörper klein und einsam in vollkommener Einöde dahinschwebten.
Da legte mir jemand die Hand auf die Schulter, eine braune, behaarte Hand mit dünnen, zähen Fingern und zwei blanken Goldringen; mein Freund Stevenson lächelte mir zu, der unruhvollste und doch beherrschteste Weltreisende, den ich kenne. Nie vergesse ich mein erstes Bekanntwerden mit ihm: wie er, ein sehniger, dunkelbraun verbrannter Mensch in einem verbleichten und verflickten Tropenanzug, eines Tages von einer Segelbarke aus unser Schiff im Roten Meer angerufen und um Aufnahme gebeten hatte, wie er, einen Kuli mit kleinem Gepäck hinter sich, schlank und flink unsere Falltreppe hinangeklettert und mit seinem fleckigen und verbeulten Tropenhut, zerrissen und abgemagert, nach ganz Afrika duftend, in unsere müßiggängerische, elegante, weißgekleidete Globetrottergesellschaft getreten war! – Nun schob er seinen Arm unter meinen, zog mich weg und führte mich nach Backbord hinüber, wo schon ein Dutzend Reisender mit dem übertriebenen Interesse tödlich gelangweilter Menschen auf Auslug standen.
»Sehen Sie?« fragte Stevenson und deutete ins Weite, und als ich eine Weile mit Anstrengung hingestarrt hatte, sah ich wirklich etwas, sah etwas Unbekanntes, Formloses, Unwesenhaftes, aber etwas, das ohne Zweifel nicht Meer war.
»Land?« fragte ich überrascht.
»Die Nikobaren«, nickte er.
Die Nikobaren? Das war ein Klang, der mich plötzlich in die trübe Klassenstube unserer kleinstädtischen Lateinschule zurückversetzte, wo ich vor Jahrzehnten einmal als kleiner Knabe vom Lehrer gescholten worden bin, weil ich das Wort »Nikobaren« nicht wußte, den Namen jener höchst uninteressanten Inselgruppe, die nördlich von Sumatra und südlich vom Golf von Pegu als eine Reihe winziger Spritzer auf der Landkarte lag.
Niemals seither hatte ich an diese verlorenen Inseln gedacht, vermutlich niemals mehr ihren Namen gehört oder ausgesprochen; wären die Scheltworte jenes längst verstorbenen Lehrers nicht gewesen, so wüßte ich ihn heute überhaupt nicht mehr. So aber sah ich nun plötzlich ein entlegenes, unbekanntes Stückchen fremdester Erde, dessen verwischtes Bild auf unserer Schulwandkarte ich mir noch vorzustellen vermochte, in zweifelloser Wirklichkeit vor mir liegen, ferne zwar und klein, aber mit allmählich sich verstärkenden Umrissen, Insel an Insel, unten ineinander verfließend, oben in Bergzüge und zarte, steile Gipfel gespalten, und dort wohnten Menschen, vermutlich eine Art Malaien und ein paar Engländer, und wir würden sie vielleicht ein paar Stunden lang im Auge behalten können. Also das waren die Nikobaren!
»Sind Sie dort gewesen?« fragte ich meinen Freund.
»Nein, es gab bisher dort nichts für mich zu tun.«
»Ja«, sagte ich, »ist es nun nicht eigentlich etwas recht Dummes und Trauriges, so viel zu reisen? Sie waren ja überall, Sie haben mir von Texas und von Borneo erzählt, von Madras und von Sachalin. Ist das nicht im Grunde scheußlich, immer wieder solche Reihen von Tagen auf Schiffen zu liegen und ins Meer zu spucken, neben müden und schlaffen Menschen, zwischen fremden Küsten, immer rund um den Erdball, der einem schließlich klein und wertlos werden muß?«
»Ja«, meinte er lächelnd, »es ist manchmal langweilig. Aber man hat ja seine Arbeit. Ich habe schon in allen Erdteilen Petroleum, Blei und Zinn aufgefunden. Was dazwischenliegt, diese Reisetage, sind natürlich immer dasselbe. Aber wenn ich auf Borneo mit zwanzig, dreißig Kulis eine Expedition antrete oder in Südafrika so zwei, drei Wochen hintereinander zu reiten habe, dann hört die Langeweile schon auf. Es wird ja wohl allen Menschen ähnlich gehen. Sie zum Beispiel sind Literat, haben Sie mir gesagt. Nun, da arbeiten Sie sich also in etwas hinein, was Ihnen wichtig scheint, toben sich darin aus, erschöpfen sich daran; die Arbeit ist fertig, Sie sind ermüdet und leer, das gespannte Interesse ist weg, die Welt ist weit und grau, und Sie sitzen da und warten und fragen sich, ob dies ganze Leben eigentlich die Mühe lohne. Genauso machen es die Reisenden hier auf dem Schiff, solange sie unterwegs und müßig sind. Warten sie aber einmal bis Penang oder Singapur, dann sehen Sie diese selben Leute plötzlich gespannt und straff vor gepackten Koffern stehen, nach Trägern und Booten rufen, Telegramme annehmen und aufgeben und plötzlich wieder wundervoll funktionieren.«
»Mag sein«, gab ich zu, »aber heimatlos sind sie dennoch; sie haben Eltern und Frauen, Kinder und Freunde in London und Amsterdam, und in Singapur haben sie nur das Kapital liegen, das sie bindet, weil es sich verzinsen muß.«
Stevenson lächelte. »Sie sind noch Anfänger, und es scheint Ihnen jetzt so, als sei diese tropische Schiffsmüdigkeit eine Art von spezieller Krankheit. Aber das ist nicht so. Es ist einfach die Muße, an die kein gesunder Mensch sich gewöhnen kann, wenn er sie auch zu ersehnen vorgibt. Man darf das nicht ernst nehmen.«
»Es ist doch auch die Heimatlosigkeit«, sagte ich.
Er zog die Mütze tiefer in die braune Stirn und sagte: »Sie täuschen sich. Heimat ist etwas, was es nicht gibt. Auch zu Hause und mitten unter den Ihren werden Sie oft genug dies Gefühl von Entwurzeltsein wieder spüren, das Sie jetzt kennengelernt haben. Ein Mann hat seine Heimat immer nur da, wo er arbeitet und Wertvolles leistet, ohne das fühlt er sich nirgends wohl. Und wo er etwas Gutes leistet, da tut er es um der Sache willen, und wenn er auch vielleicht glaubt, er tue es für seine Familie und für seine Nation, so sind das eben Einbildungen. Was wir tun, tun wir für die Menschen, und unsre Belohnung besteht darin, daß das Tun uns oft viel Spaß macht. Wir, wir Männer, die etwas tun, sind alle Kollegen und Brüder, auf der ganzen Erde. Wenn Sie, wie ich hoffe, ein guter Schriftsteller sind, so sind Ihre Brüder alle jene, die irgendwo und irgendwann am gleichen Werk gearbeitet haben wie Sie, an der Vergeistigung der Menschen oder wie Sie das nun nennen wollen. Solange Sie zu dieser Gemeinschaft gehören, solange haben Sie Heimat um sich. Wenn Sie aber diese Gemeinschaft verlassen, dann sind Sie heimatlos, auch wenn Sie dem Parlament Ihres Landes präsidieren sollten. Auch ich, wenn Sie erlauben, empfinde mich als Ihren Kameraden. Sie helfen Ideen reifen und umsetzen, ich helfe die Materie bewegen und Arbeitsfelder schaffen. Zu Ihrer Arbeit gehört es wohl auch, daß Sie Gefühle pflegen und veredeln helfen. Davon müssen Sie mehr als ich verstehen. Aber sehen Sie, Freund: dieses Schiffsheimweh da, das ist kein Gefühl, von dem man Reden sollte; ich glaube, es ist überhaupt kein Gefühl, sondern bloß eine Sentimentalität.«
Er hatte mir nichts Neues gesagt, aber die Lektion war im rechten Augenblick gekommen.
Stevenson verließ uns schon in Penang. Ich sehe ihn noch, wie er noch vom Schiff aus seine englischen und malaiischen Befehlsworte an Land rief und dann, den zerbeulten Tropenhut auf dem schwarzen Sperberkopf, im Galopp auf einer Rikscha in der wimmelnden Chinesenstadt verschwand.
Nachts in der Kabine
Das Meer klopft an die Wand,
Im kleinen runden Fenster blaut die Nacht
Und atmet heiß mit Wüstenhauch herein.
Ich bin zum zehntenmal erwacht
Und liege still in atemlosem Brand
Und schlafe nimmer ein.
Und wie ein wildes Herz
Stößt die Maschine heiß und stöhnend fort
Und müht sich unerlöst in blindem Schmerz
Durch immer neue Fernen sinnlos fort.
O wessen Herz nicht klar und fest
Und froh ist wie Kristall,
Für den ist solcher Raum kein Nest,
Dem folgt die Sehnsucht und der Heimat Sorgenschwall,
Folgt ungestillte Liebe überall
Und macht ihn arm;
Und alles sieht ihn wild und teuflisch an,
Weil er den Feind im eignen Busen trägt
Und nie entrinnen kann.
Abend in Asien
Abends Ankunft in Penang. Im Eastern and Oriental Hotel (dem schönsten Europäerhotel, das ich auf der hinterindischen Halbinsel traf) ward mir eine fürstliche Wohnung von vier Räumen angewiesen, vor der Veranda klatschte das braungrüne Meer an die Mauer, und im roten Sande standen groß und ehrwürdig die abendlichen Bäume. Die rotbraunen und gelben Segel vieler Dschunken, gebaut wie starksehnige Drachenflügel, leuchteten im letzten Tageslicht, dahinter der weiße Sandstreifen des Penangstrandes, die blauen siamesischen Berge und alle die winzigen, dick bewaldeten Koralleninselchen der wundervollen Bucht.
Nach Wochen eines unbequemen Wohnens in der beängstigend schmalen Schiffskabine genoß ich vor allem eine gute Stunde lang die Weite meiner Räume; ich probierte die ausschweifend bequemen Liegestühle des luftigen Vorzimmers, wo alsbald ein kleiner Chinese mit Philosophenaugen und Diplomatenhänden lautlos Tee und Bananen auftrug, ich badete im Baderaum und wusch mich im Ankleidezimmer. Dann kostete ich im hübschen Speisesaal bei ganz guter Tafelmusik zum erstenmal mit leiser Enttäuschung das üble Essen eines englisch-indischen Hotels. Inzwischen war eine tiefe, schwarze Nacht ohne Sterne heraufgekommen, die großen unbekannten Bäume rauschten wohlig im lauen, schweren Winde, und große unbekannte Käfer, Zikaden und Hummeln sangen, schwirrten und schrien überall heftig mit den scharfen eigenwilligen Stimmen junger Vögel.
Ohne Hut und in leichten Schlafschuhen trat ich auf die breite Straße hinaus, rief einen Rikschamann heran, stieg mit frohem Abenteuergefühl in den leichten Wagen und sprach mit Kaltblütigkeit meine ersten malayischen Worte, welche der flinke, starke Kuli so wenig verstand wie ich die seinen. Er tat, was jeder Rikschamann in diesem Falle tut, er lächelte mir mit seinem guten, kindlich bodenlosen Asiatenlächeln herzlich zu, wendete sich um und lief in frohem Trab davon.
Und nun erreichten wir die innere Stadt, und Gasse für Gasse, Platz für Platz, Haus für Haus glühte in einem erstaunlichen, unerschöpflichen, intensiven und doch wenig geräuschvollen Leben. Überall Chinesen, die heimlichen Herrscher des Ostens, überall chinesische Läden, chinesische Schaubuden, chinesische Handwerker, chinesische Hotels und Klubs, chinesische Teehäuser und Freudenhäuser. Dazwischen je und je eine Gasse voll Malayen oder Klings, weiße Turbane auf dunkelbärtigen Köpfen, blanke, bronzene Männerschultern und stille, ganz mit Goldschmuck behängte Frauengesichter rasch von einer Fackel beleuchtet, lachend oder aufheulend dunkelbraune Kinder mit dicken Bäuchen und wunderschönen Augen.
Hier gibt es keinen Sonntag, hier gibt es keine Nacht; ohne Ende und ohne sichtbare Pause geht die gelassene, gleichmäßige Arbeit weiter, nirgends nervös und übertrieben, überall fleißig und heiter. Klug und geduldig kauert auf hohem Brett der kleine Straßenhändler über seiner Bude, still und würdevoll arbeitet am Rande der brausenden Straße der Barbier, zwanzig Arbeiter klopfen und nähen in der Werkstatt eines Schuhmachers, freundlich breitet ein mohammedanischer Kaufmann auf niederen, breiten Ladentischen seine schönen Tücher aus, die aber fast alle aus Europa stammen. Japanische Dirnen sitzen kauernd am Steinrand der Gosse und girren wie fette Tauben, aus chinesischen Freudenhäusern glänzt golden der wohlbestellte steife Hausaltar, hoch über der Straße in offenen Veranden hocken alte Chinesen mit kühlen Gebärden und heißen Augen beim aufregenden Glücksspiel, andre liegen und ruhen oder rauchen und hören der Musik zu, der feinen, rhythmisch unendlich komplizierten und exakten chinesischen Musik. Köche sieden und braten auf der Gasse, Hungrige speisen an langen Brettertischen gesellig und feinschmeckerisch und sicher für zehn Cents nicht schlechter, als ich im Gasthaus für drei Dollar gegessen habe, Fruchthändler bieten unbekannte Früchte an, phantastische Erfindungen einer müßigen, überreichen Vegetation, kleine Buden haben ihre ärmlichen Güter, eine Handvoll getrocknete Fische oder drei Häuflein Betel, sorgsam mit Kerzen beleuchtet. Hier wandeln im verschwenderischen Licht, das namentlich der Chinese liebt, unverändert alle Gestalten der östlichen Märchen, nur die Könige, Wesire und Henker sind zum Teil verschwunden, gleich wie vor Jahrhunderten arbeitet der geschickte Barbier, tanzt die geschminkte Dirne, lächelt ergeben der Diener und blickt stolz der Herr, wie immer kauern wartend die Träger und Arbeitsuchenden, kauen Betel und erzählen einander Geschichten.
Ich besuchte ein chinesisches Theater. Da saßen still und rauchend die Männer, still und teeschlürfend die Frauen, vor ihrer hohen Empore turnte gefährlich auf schwankem Brett der Teeschenk mit mächtigem Kupferkessel. Auf der geräumigen Bühne saß eine Schar Musikanten, das Drama begleitend und seinen Takt kunstvoll betonend; auf jeden betonten Schritt des Helden fiel ein betonter Schlag der weichtönenden Holztrommel. Es wurde in alten Kostümen ein altes Stück gespielt, von dem ich wenig verstand und nicht ein Zehntel sah, denn das Stück ist lang und wird durch Tage und Nächte fortgespielt. Da war alles gemessen, studiert, nach alten heiligen Gesetzen geordnet und in rhythmischem Zeremoniell stilisiert, jede Gebärde exakt und mit ruhiger Andacht ausgeführt, jede Bewegung vorgeschrieben und voll Sinn, studiert und von der ausdrucksvollen Musik geführt. Es gibt in Europa kein einziges Opernhaus, in dem Musik und Bewegungen des Bühnenbildes so tadellos, so exakt und glänzend harmonisch miteinandergehen wie hier in dieser Bretterbude. Eine schöne, einfache Melodie kehrte häufig wieder, eine kurze, monotone Weise in Moll, die ich mir trotz aller Bemühungen nicht einprägen konnte und die ich später tausendmal wieder hörte, denn es war gar nicht, wie ich meinte, stets dieselbe Tonfolge, sondern es war die chinesische Grundmelodie, deren zahllose Variationen wir zum Teil kaum wahrnehmen können, da die chinesische Tonleiter viel kleiner differenzierende Töne hat als unsre. Was uns dabei stört, ist der allzu reichliche Gebrauch von Pauke und Gong; im übrigen ist diese Musik so fein und klingt abends von der Veranda eines festlichen Hauses so lebensfroh und oft so leidenschaftlich, lustbegierig, wie nur irgendeine gute Musik bei uns daheim es tun kann. Im ganzen Theater war außer der primitiven elektrischen Beleuchtung nichts Europäisches und Fremdes; eine alte, durch und durch stilisierte Kunst schwang ihre alten, heiligen Kreise weiter.
Leider ließ ich mich verführen, danach auch noch ein malayisches Theater zu besuchen. Da prangten grelle, wahnsinnige Kulissen von grotesker Häßlichkeit, von dem Chinesen Chek May in wohlgeglückter Spekulation auf die Affeninstinkte der Malayen gemalt, eine Parodie auf alle Entgleisungen europäischer Kunst, das ganze Theater von einer beiselhaften Drolligkeit und Hoffnungslosigkeit, die nach kurzem, krampfhaftem Lachvergnügen unerträglich wird. In üblen Kostümen spielten, sangen und tanzten malayische Mimen in varieteehafter Weise die Geschichte von Ali Baba. Hier wie später überall sah ich die armen Malayen, liebe, schwache Kinder, rettungslos an die bösesten europäischen Einflüsse verloren. Sie spielten und sangen mit oberflächlicher Geschicklichkeit, neapolitanerhaft heftig und manchmal improvisierend, und dazu spielte eine moderne Harmoniummaschine.
Als ich spät die innere Stadt verließ, klangen und glühten hinter mir die Gassen weiter, noch die halbe Nacht hindurch, und im Hotel ließ ein Engländer zu einsamem Nachtvergnügen ein Grammophon oberbayerische Jodlerquartette spielen.
Manuskriptseite »Der Hanswurst« auf Hotelpapier
Der Hanswurst
In Singapur besuchte ich wieder einmal ein malayisches Theater. Ich tat es längst nicht mehr in der Hoffnung, hier etwas von Kunst und Volkstum der Malayen zu sehen oder sonst wertvolle Studien machen zu können, sondern lediglich in behaglicher Abendstimmung, wie man an einem müßigen Abend in einer fremden Seestadt nach dem Essen und Kaffee Lust bekommt, in ein Varietee zu gehen.
Die sehr geschickten Schauspieler, deren einer einen Europäer zu spielen hatte, stellten eine moderne Ehegeschichte aus Batavia dar, die ein Stückefabrikant auf Grund von Zeitungs- und Gerichtsnachrichten dramatisiert hatte. Die Gesangseinlagen mit Begleitung eines alten Klaviers, dreier Geigen, eines Basses, eines Horns und einer Klarinette waren von rührender Komik. Unter den Frauen eine wunderschöne junge Malayin, wohl Javanin, mit hinreißend edelm Gang.
Das Merkwürdige aber war eine magere junge Schauspielerin in der seltsamen Rolle eines weiblichen Hanswurst. Die sehr sensible, überintelligente, allen andern unendlich überlegene Frau stak in einem schwarzen Sack, trug über ihrem schwarzen Haar eine fahlblonde scheußliche Wergperücke und hatte das Gesicht mit Kalk beschmiert, auf der rechten Wange einen großen schwarzen Klecks. In dieser toll häßlichen Bettelmaske bewegte sich die nervös geschmeidige Person in einer Nebenrolle, die zum Stück nur äußerst flüchtige Beziehungen hatte, und war doch beständig auf der Bühne; denn sie spielte den vulgären Hanswurst. Sie grinste und fraß auf affenhafte Art Bananen, sie belästigte Mitspieler und Orchester, unterbrach die Handlung durch Witze oder begleitete sie stumm mit parodierender Nachäffung; dann wieder saß sie zehn Minuten lang teilnahmslos auf dem Fußboden, hielt die Arme verschränkt und blickte mit gleichgültigen, krankhaft klugen, kalt überlegenen Augen ins Leere oder fixierte uns Zuschauer der vordersten Reihe mit kühler Kritik. In dieser Abseitigkeit sah sie nicht mehr grotesk aus, eher tragisch, der schmale, brennend rote Mund teilnahmslos ruhend, vom vielen Lachen ermüdet, die kühlen Augen aus dem fratzenhaft bemalten Gesicht traurig, vereinsamt und erwartungsvoll blickend. Man hätte mit ihr reden mögen wie mit einem Shakespeareschen Narren oder wie mit Hamlet. Bis die Gebärde irgendeines Mitspielers sie reizte – dann stand sie auf, von Leben durchflossen, und parodierte diese Gebärde mit dem kleinsten Aufwande an Anstrengung in so hoffnungslos vernichtender Übertreibung, daß die Mitspieler hätten verzweifeln müssen.
Aber diese geniale Frau war nur Hanswurst: sie durfte nicht italienische Arien singen wie ihre Kolleginnen, sie trug das schwarze Kleid der Erniedrigung, und ihr Name stand weder auf dem englischen noch auf dem malayischen Theaterzettel.
Überfahrt
Von Singapur aus fuhr ich auf einem kleinen holländischen Küstendampfer über den Äquator weg nach Südsumatra. Die Sache begann mit Gepäckschwierigkeiten am Pier und wäre beinahe im ersten Anfang schon verunglückt, denn kaum war das kleine Motorbötchen, das uns und unsre vielen Kisten an Bord des Brouwer bringen sollte, vom Pier abgestoßen, so fuhr uns ein etwas größeres Boot in eiliger Konkurrenz so wild mitten in der Breitseite an, daß wir alle übereinanderfielen und schon ans Schwimmen dachten. Es war jedoch wider alle Wahrscheinlichkeit Gerechtigkeit geschehen und der Angreifer war der Geschädigte; mit einem großen Loch im Bug mußte er abziehen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!