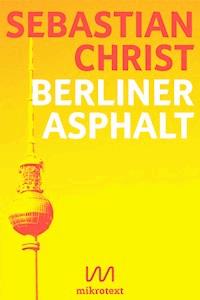18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der deutsche »Berufsverbrecher« Otto Küsel, der im Mai 1940 als Häftling Nr. 2 nach Auschwitz kam, hat als Funktionshäftling Hunderten von polnischen Häftlingen das Leben gerettet, indem er sie vor der »Vernichtung durch Arbeit« bewahrte. 1942 gelang Küsel eine der spektakulärsten Fluchten aus Auschwitz. Neun Monate lebte er im Untergrund; der spätere polnische Außenminister und Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, Władysław Bartoszewski, wollte ihm in dieser Zeit gefälschte Papiere besorgen. Erneut verhaftet, überlebte Küsel Folter und den Todesmarsch. Nach dem Krieg wurde ihm die polnische Staatsbürgerschaft ehrenhalber angeboten. Im ersten Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main hat er als Zeuge ausgesagt. In Polen ist Otto Küsel ein Held, in Deutschland bis heute so gut wie unbekannt. Sebastian Christ, der 20 Jahre lang auf Küsels Spuren geforscht hat, erzählt seine erschütternde wie heldenhafte Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Sebastian Christ
Auschwitzhäftling Nr. 2
Otto Küsel – der unbekannte Held des Konzentrationslagers
wbg Theiss ist ein Imprint der Verlag Herder GmbH
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Michaela Kneißl – geviert
Lektorat: Christina Kruschwitz
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
ISBN Print: 978-3-534-61025-9
ISBN E-Book (EPUB): 978-3-534-61000-6
ISBN E-Book (PDF): 978-3-534-61001-3
Inhalt
Einleitung
Neukölln und Sachsenhausen
Auschwitz
Jenseits des Lagers
In Freiheit
Zurück in Auschwitz
Flossenbürg
Schwarzhofen
Der Prozess
Epilog
Pläne des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau
Anmerkungen
Literatur
Abbildungsnachweis
Einleitung
Dies ist die Geschichte eines Mannes, der nie vorhatte, ein Held zu werden. Eigentlich wollte er nur frei sein.
Er war nicht frei von Fehlern. Gerade deswegen hat er viel zu selten darüber gesprochen, wie viel Gutes er geleistet hat. Und dass er wahrscheinlich Hunderten Menschen das Leben gerettet hat.
Sein Name war Otto Küsel. Ein Mann aus dem Berliner Arbeitermilieu, der keiner Ideologie folgte, sondern vor allem seinen Instinkten. Er leistete Widerstand gegen die Gewaltherrschaft der Nazis, ohne sich selbst als Widerstandskämpfer zu sehen. Otto war ein einfacher Mann, der im entscheidenden Moment das Richtige tat.
***
Der 14. Juni 1940.
Ein Zug trifft im Konzentrationslager Auschwitz ein. Es ist der erste Häftlingstransport überhaupt. In den Güterwaggons befinden sich 700 Polen, die in den Wochen zuvor verhaftet worden waren, oft aus nichtigen Gründen. Die meisten von ihnen sind sehr jung, kaum älter als 20 Jahre. Und sie wissen noch nicht, was ihnen bevorsteht. Selbst auf Nachfrage wollte man ihnen nicht den Zielbahnhof des Transports verraten.
Die Türen zum Waggon werden aufgerissen. Ein SS-Mann schreit: »Alle raus! … Los, ihr verfluchten Banditen!« Mit Gewehrkolben werden die Männer aus dem Zug geprügelt, müssen ein Spalier aus Uniformierten passieren, werden angeschrien und mit Fäusten geschlagen. Schließlich erreichen sie das Lagertor. So schildert es der Schriftsteller Wiesław Kielar in seinem Buch Anus Mundi1, in dem er seine fast fünfjährige Zeit in deutschen Konzentrationslagern beschreibt.
Im Lager selbst warteten andere Peiniger auf sie. Sein erster Eindruck war der von »finsteren großen Kerlen, die sonderbarerweise mit etwas angezogen sind, was täuschend an gestreifte Pyjamas erinnert«. Jeder von ihnen hielt einen großen Stock in der Hand. »Ich kriege etwas an der Hand ab, aber der Mantel, den ich in der Hand hielt, minderte zum Glück ein wenig den Schlag. Ich sprang zur Seite, bekam hier aber wieder einen Tritt von einem großen und dicken ›Gestreiften‹.«2 Es war die erste Begegnung mit den Kapos im Lager, jenen Funktionshäftlingen, die sich fast ausschließlich aus deutschen »Berufsverbrechern« rekrutierten und die Häftlingsnummern 1 bis 30 trugen.
Und das waren nur die ersten Minuten in Auschwitz. Fortan wurden die neuen Häftlinge stetig gequält. SS und Kapos lebten ihren Sadismus an den Neuankömmlingen aus. Potenziell tödliche Schläge mit Holzknüppeln auf Kopf und Genick. Demütigende Grußrituale, die bei kleinsten Fehlern in Prügelorgien ausarteten. Warnschüsse aus Maschinenpistolen. Von Beginn an sollen die neuen Häftlinge spüren, dass sie von den Deutschen als »Untermenschen« betrachtet werden.
Und dann der sogenannte »Sport«: Im Grunde handelte es sich dabei um Folter im klassischen Sinne. Begleitet wurden solche »Turnstunden« von unsäglichen Gewaltexzessen der Kapos. Kielar wurde gleich an einem der ersten Tage befohlen, mit Dutzenden anderen gleichzeitig auf einen Baum zu klettern – begleitet von den Schlägen von Bruno Brodniewicz, Häftling Nummer 1 und Lagerältester. Entkräftet und durch unzählige Hiebe verletzt, fiel er vom Baum hinunter und wurde bewusstlos. Später wachte er aus seiner Ohnmacht auf. Ihm hatte im Stillen jemand geholfen. »Ein Kapo, ein grüner Winkel auf der gestreiften Jacke, Nr. 2. Ohne Stock, ein milder Blick, kleines nach oben strebendes Näschen, die Mütze schief aufgesetzt. Aha, das ist dieser gute Kapo – der Arbeitsdienst. Komm, komm – er winkt mir und den anderen, die daneben liegen«, schrieb Kielar. »›Keine Angst! Eine gute Arbeit! Essen holen‹, sagte Otto gütig.«3 Wiesław Kielar hatte gerade erstmals Bekanntschaft gemacht mit Otto Küsel, der so ganz anders war als die übrigen 29 Kapos. Für viele polnische Auschwitz-Überlebende war er ein Held. Man nannte ihn auch den »Engel der Polen«. Wahrscheinlich hat er Hunderte Menschen vor der Vernichtungsmaschinerie des Konzentrationslagers Auschwitz gerettet.
Das Leben von Otto zu erzählen gleicht einem Puzzlespiel. Er selbst hat nur wenige Quellen über sein eigenes Leben hinterlassen. Ein einziges Wortlautinterview mit ihm ist erhalten: Es entstand Anfang der 1980er-Jahre, geführt vom evangelischen Studentenkreis der Universität Bonn, und erschien wenige Monate vor Ottos Tod im Jahr 1984.4 Die meisten wörtlichen Zitate von ihm, die für dieses Buch verwendet wurden, stammen aus diesem Text.
Häftlingsfoto von Otto Küsel, deutlich zu sehen der grüne Winkel und die Häftlingsnummer 2.
Wer war dieser Mann, von dem Auschwitz-Überlebende noch Jahrzehnte später so voller Wohlwollen und Respekt erzählten?
Otto wurde 1909 in Rixdorf geboren, einer Großstadt vor den Toren Berlins, die 1920 unter dem Namen »Neukölln« in die damalige Reichshauptstadt eingegliedert wurde. Als junger Mann geriet er mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt, wahrscheinlich wegen Diebstahls- oder Einbruchsdelikten. Mit Autoritäten stand er nach eigener Aussage ständig in Konflikt. In der Ideologie des NS-Regimes galt er als »Berufsverbrecher« und kam 1937 ins Konzentrationslager Sachsenhausen. Dort wurde er drei Jahre später auf Befehl des späteren Lagerkommandanten Rudolf Höß als einer der ersten 30 Häftlinge für das Konzentrationslager Auschwitz ausgewählt.
Diese 30 Häftlinge sollten als Kapos dienen. Sie alle trugen den grünen Winkel auf der Brust, der sie als »Berufsverbrecher« auswies. Nicht alle »Grünen Winkel« in Auschwitz waren Kapos, aber die ersten 30 Funktionshäftlinge waren fast ausnahmslos »Berufsverbrecher«. In der Hierarchie des Lagers standen sie zwischen den SS-Mannschaften und den übrigen Häftlingen. Bestimmte Aufgaben des Lagerregimes wurden an die Kapos delegiert, die ihrerseits dafür Privilegien in der Hölle des Lagerlebens genossen. Kleinere und größere Annehmlichkeiten – beispielsweise die Unterbringung in weniger dicht belegten Baracken oder Sonderzuteilungen beim Essen – sollten dazu dienen, die Kapos zu einem möglichst brutalen Umgang mit ihren Mithäftlingen anzustacheln. Die meisten der ersten 30 Häftlinge in Auschwitz folgten der Logik dieses Systems und wurden zu Sadisten. Doch Otto war anders.
Anfangs kamen die Häftlinge im Konzentrationslager Auschwitz mehrheitlich aus Polen. Also lernte Küsel Polnisch, damit er sich mit ihnen verständigen konnte. Mit der Zeit wurde er zu einem ihrer wichtigsten Verbündeten im alltäglichen Kampf ums Überleben.
Als »Arbeitsdienst« sollte Otto der SS dabei helfen, die Vernichtung der polnischen Häftlinge durch Arbeit zu ermöglichen. Von ihm wurde erwartet, die teils lebensgefährlichen und teils etwas ungefährlicheren Arbeiten im Lager so zu verteilen, dass die Zahl der Häftlinge dezimiert würde. Otto tat jedoch genau das Gegenteil. Er fand Wege, das System auszutricksen. Kranke und geschwächte Häftlinge schickte er zum Kartoffelschälen oder zu anderen leichten Tätigkeiten – und zwar so lange, bis sie wieder zu Kräften kamen. Neuankömmlingen machte er klar, dass sie im Lager nicht als Akademiker oder Offiziere auffallen dürften – weil sie sonst Gefahr liefen, von der SS als Teil der polnischen Gesellschaftselite getötet zu werden.
Otto war auch bekannt dafür, Tipps zu verteilen, wie man selbst schwere Aufgaben so ausgestalten konnte, dass sie körperlich erträglich wurden. Und er arbeitete, zumindest indirekt, mit dem polnischen Lagerwiderstand zusammen. Fluchtwillige bekamen von seinem Büro, in dem später auch Mitglieder des Widerstands arbeiteten, spezielle Tätigkeiten zugeteilt, von denen aus sich ein Entkommen aus Auschwitz einfacher realisieren ließ – beispielsweise auf Posten außerhalb des Lagers. Historiker sind sich einig, dass Ottos Schreibstube einer der wichtigsten Drehpunkte war, mit dessen Hilfe der polnische Widerstand beispielsweise Informationen über die Situation in Auschwitz nach außen schleusen und Lebensmittel organisieren konnte. Und für andere Häftlinge war er einfach ein Mutmacher: Er sprach ihnen Trost zu, half ihnen dabei, das Lager auch psychisch zu überleben.
Für ihn selbst war dieses Engagement sehr gefährlich. Stets musste er darauf achten, die Balance zu halten. Einerseits wollte er helfen, andererseits musste er seine Hilfe so ausgestalten, dass er bei der Lagerleitung nicht negativ auffiel. Ihm glückte das über einen erstaunlich langen Zeitraum – zu dem Preis, dass er nicht immer und zu jedem Zeitpunkt zur Tat schreiten konnte und manche Male seine Mithäftlinge vertrösten musste.
Im Dezember 1942 gelang Küsel mit drei anderen Häftlingen eine abenteuerliche Flucht aus Auschwitz. Er tauchte in Warschau unter, lebte unter anderem bei einer dem Widerstand nahestehenden Familie und schloss sich einer Untergrundgruppe an. Im September 1943 wurde Küsel verraten, von der Gestapo verhaftet und nach Auschwitz zurückgebracht. Nach Verhören und Folter sperrte man ihn in den sogenannten »Bunker« in Block 11. Er überlebte die Einzelhaft wie durch ein Wunder: Denn ausgerechnet in dieser Zeit kam es erstmals zu einem Wechsel in der Führung des Konzentrationslagers. Rudolf Höß wurde nach Berlin ins SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt berufen. Sein Nachfolger Arthur Liebehenschel erließ eine Amnestie für alle Bunkerhäftlinge. Damit ist Küsel einer der wenigen Häftlinge in der Geschichte des Konzentrationslagers Auschwitz, die nach Flucht und Wiederverhaftung mit dem Leben davongekommen sind.
Im Februar 1944 wurde Otto ins Konzentrationslager Flossenbürg deportiert, wo er es schaffte, der schweren körperlichen Arbeit im Steinbruch oder beim Bau von Messerschmitt-Jagdfliegern zu entgehen. Im April 1945 wurde er auf einem der Flossenbürger Todesmärsche befreit. Der Krieg war für Otto damit zu Ende. Er ließ sich fast genau an jenem Ort nieder, an dem ihn die Amerikaner befreit hatten, heiratete, wurde Vater von zwei Töchtern und arbeitete als Verkaufsfahrer für einen Obst- und Gemüsegroßhändler.
Bereits 1945 gab es eine Initiative ehemaliger polnischer Auschwitz-Häftlinge, Küsel die polnische Staatsbürgerschaft ehrenhalber zu verleihen. Mit vielen Mitgefangenen blieb er in Briefkontakt. Manche suchten nach Küsel, um ihm zu danken. Im Jahr 1964 sagte er bei den Auschwitz-Prozessen in Frankfurt als Zeuge aus – er wurde aber von den Richtern als möglicher Spion der Lagerleitung denunziert. Diese Erfahrung belastete Otto schwer.
In Auschwitz machte er Bekanntschaft mit zahlreichen Personen, die später prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wurden: Hermann Langbein, der 1954 Mitbegründer des Internationalen Auschwitz Komitees war, schrieb über ihn, dass er »wie kaum ein anderer Überlebender von Auschwitz stolz auf seine Vergangenheit sein« könne.5 Er habe mit vielen anderen über Otto gesprochen. »Von keiner Seite habe ich auch nur die Andeutung einer negativen Erinnerung über diesen außergewöhnlichen Menschen gehört.«6 Der Schriftsteller Wiesław Kielar kannte ihn genauso wie der Theaterkünstler Józef Szajna oder der spätere Maler und Zeichner der Washington Post, Jan Komski. Und der Politiker Józef Cyrankiewicz, ab 1947 Ministerpräsident des entstehenden kommunistischen Staates in Polen und 1970 Mitunterzeichner des Warschauer Vertrages mit der Bundesrepublik, war in Block 11 sein Zellennachbar.
Auch mit Władysław Bartoszewski war Küsel bekannt. Der spätere polnische Außenminister und Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels wurde als 18-Jähriger bei einer Straßenrazzia verhaftet und kam nach Auschwitz. Kurz vor seinem Tod im Jahr 2015 erschien auf Deutsch das Buch Mein Auschwitz, in dem Bartoszewski sich in einem langen Gespräch an seine Zeit im Konzentrationslager erinnert. Er nennt Otto eine »Ausnahme« unter den ersten 30 Häftlingen. Küsel habe den polnischen politischen Häftlingen geholfen, zum Beispiel dadurch, dass er besonders Geschwächten eine »leichtere und sicherere Arbeit« verschaffte. Im Jahr 1943 – Bartoszewski war damals bereits wieder in Warschau – bekam er einen Auftrag, der mit Otto in Verbindung stand. Auch davon wird in diesem Buch noch die Rede sein.
Dass über Küsel in Deutschland bisher kaum etwas publiziert wurde, hängt auch mit seiner Biografie zusammen. Otto entstammt dem Berliner Arbeitermilieu, er hat Zeit seines Lebens auch nie große Worte über seine Taten verloren oder gar die Öffentlichkeit gesucht. Er war kein Intellektueller, dessen Handeln heute auf eine höhere Deutungsebene projiziert werden könnte. Und deswegen ist seine Geschichte auch nicht an die deutschen Großdiskurse über den Widerstand in Nazi-Deutschland angebunden: etwa über den sozialdemokratischen, kommunistischen, kirchlichen oder militärischen Widerstand.
Außerdem war Küsel von den Nationalsozialisten als »Berufsverbrecher« betitelt worden. Das NS-Regime übernahm ab 1933 bereits zur Zeit der Weimarer Republik bestehende Rechtsansichten, wonach es Menschen gebe, die »aus Gewinnsucht« als professionell tätige Kriminelle agieren würden. Man nahm an, dass diese Menschen nicht resozialisierbar seien, weil sie faktisch von Geburt an dazu bestimmt wären, gegen das Gesetz zu verstoßen. Bereits in den ersten fünf Jahren der NS-Herrschaft wurden Tausende Menschen auf Basis dieser nicht mit rechtsstaatlichen Maßstäben konformen Gesetzgebung in Konzentrationslager deportiert. Wenn sie nicht als Kapos ausgewählt wurden, erlitten sie dort das gleiche Martyrium wie die übrigen Gefangenen auch. Nach dem Krieg erhielt nur ein Bruchteil der von den Nazis als »Berufsverbrecher« eingestuften Menschen eine Entschädigung. Andere Opfergruppen verwehrten ihnen die Anerkennung, weil sie glaubten, dadurch das eigene Ansehen in Verruf zu bringen. Unterschwellig herrschte der Glaube vor, dass es keine Opfer geben könne, die vorher selbst – außerhalb der Konzentrationslager – kriminell waren.
Das Thema ist also komplex. Dies mag der Hauptgrund dafür gewesen sein, warum der Deutsche Bundestag erst am 13. Februar 2020 beschloss, die von den Nationalsozialisten als »Asoziale« und »Berufsverbrecher« bezeichneten Menschen als Verfolgte des NS-Regimes anzuerkennen. Bis heute ist das Schicksal der »Grünen Winkel« nur unzureichend erforscht.
Dabei können wir von Ottos Geschichte einiges lernen: Wie man unter widrigsten Bedingungen anständig bleibt. Und wie man sich den manipulativen Anreizen einer Diktatur selbst unter Lebensgefahr widersetzt.
Ottos Erlebnisse sind auch nicht zuletzt Zeugnis der Freundschaft zwischen Deutschen und Polen – und zwar zu einem Zeitpunkt, als dies in der Geschichte beider Völker am wenigsten wahrscheinlich war. Das größte Missverhältnis im Zusammenhang mit Otto Küsel ist, dass er in Polen bis heute vielen Menschen im Gedächtnis geblieben ist – dass ihn in Deutschland aber kaum jemand kennt.
Neukölln und Sachsenhausen
1
Ottos Vater hieß ebenfalls Otto. Er war ein angesehener Mann in seinem Milieu, er arbeitete als Lagerverwalter. Otto Küsel junior hätte als Jugendlicher wohl nie gedacht, dass Otto Küsel senior eines Tages für ihn eine Respektsperson werden würde. Denn seine Idee vom Leben war eine ganz andere als die seiner Eltern.
Am 16. Mai 1909 wurde er in Rixdorf geboren. Vater, Sohn und Mutter Mathilde wohnten zunächst in der Münchner Straße 23 (heute: Flughafenstraße), in einem Gebäude, das sich unweit des in Ottos Geburtsjahr fertiggestellten Rathauses Neukölln befand. In dieser Gegend besuchte Otto junior auch die Volksschule. »Ich wollte eigentlich Schornsteinfeger werden, aber mein Vater hatte Beziehungen zu einem Elektriker und so begann ich bei diesem eine Lehre«1, erinnerte er sich. Elektrizität war damals ein Zukunftsthema: Berlin war zu dieser Zeit eines der weltweit führenden Zentren in diesem Industriebereich. Siemens hatte seinen Hauptsitz in der Stadt, die AEG unterhielt gigantische Fabrikhallen in Berlin-Oberschöneweide – nur wenige Kilometer von Ottos Elternhaus entfernt. Und beide Firmen bauten bereits vor über 100 Jahren Elektroautos in Serienproduktion auf dem Berliner Stadtgebiet.2
Otto junior war damals jedoch nicht danach, allzu weit in die Zukunft zu denken. »Ich war ein schlechter Lehrjunge, frech, ein richtiger Lausejunge«, sagte Otto. »Heute gebe ich niemandem die Schuld daran; jeder Mensch muss sich selbst ein Urteil bilden, jeder weiß, wenn er etwas Schlechtes tut.« Er brach seine Ausbildung nach zwei Jahren ab. Damals war er 16 Jahre alt. Und er entschloss sich, von zu Hause auszuziehen.
Otto sprach nie sehr detailliert über diese Zeit. Ihn plagte ein schlechtes Gewissen. »Als junger Mensch ist man dumm, was hat man gemacht, nur Dummheiten, und man kam sich, wenn man Dummheiten gemacht hatte, wie ein Held vor«, sagte er in seinem einzigen größeren Interview kurz vor seinem Tod.
Die nächsten zehn Jahre hatte er keinen festen Wohnsitz. Er entdeckte, dass ihm das »Handeln im Blut lag«. Also zog er mit einem Bauchladen voller Schnürsenkel von Haus zu Haus. »Dabei musste man mit den Leuten reden und versuchen, ihre weiche Stelle zu finden, damit sie einem etwas abkauften.« Später handelte er auch mit Obst. Er bot seine Ware an Verkaufsplätzen an. Zeitgemäß im wilden Berlin der 1920er-Jahre waren seine Sprüche, die er den möglichen Kundinnen zurief: »Bananen, Bananen, für die Damen, die keine Herren haben!«3
Er selbst war damals glücklich mit seiner Lebenssituation, wie er selbst sagte. Otto wollte nicht abhängig von einem Chef sein. Seine wirtschaftliche Lage war zwar überschaubar, dafür konnte er selbst entscheiden, wann er arbeiten wollte und wann nicht. Er fühlte sich in seinen Jahren auf den Berliner Straßen frei. Das war genau jener Lebensentwurf, den er damals suchte.
Gleichzeitig war Otto auch klar, dass sein Geschäft weit davon entfernt war, den klassischen Ansprüchen eines Kaufmannsberufs zu genügen. »Eigentlich lief das alles mehr auf Betteln als auf Hausieren hinaus – man durfte sich von der Polizei jedenfalls nicht erwischen lassen.«4 Hinzu kam noch, dass sich die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland im Zuge der Weltwirtschaftskrise von 1929 dramatisch verschlechterte. Von September 1929 bis Anfang 1933 vervierfachte sich die Zahl der Arbeitslosen.5 Millionen von Familien hatten kaum noch das Geld, um sich den alltäglichen Lebensunterhalt zu leisten. Keine guten Rahmenbedingungen für jemanden, der sich mit kleinen Haustür-Deals über Wasser halten will. Es ist wahrscheinlich, dass Otto in dieser Zeit zum ersten Mal straffällig wurde.
Ottos Polizeiakte aus jener Zeit ist mit großer Wahrscheinlichkeit im Zweiten Weltkrieg bei den Luftangriffen auf Berlin verbrannt. Im Landesarchiv finden sich keine Dokumente über seine Vorstrafen. Er selbst blieb vage dazu. Hermann Langbein fasste ein Gespräch, das er 1969 mit Otto geführt hat, wie folgt zusammen: »Als junger Bursch hatte er in der Zeit der allgemeinen Arbeitslosigkeit und Not drei Strafen erhalten, die letzte, als er 24 Jahre alt war.«6 Die meisten Zeitzeugen aus Auschwitz sagen, dass Otto Diebstähle begangen hat oder bei Einbrüchen Schmiere stand.
Eine Registerkarte aus dem KZ Sachsenhausen weist vier Vorstrafen mit insgesamt 66 Monaten Haft aus. Das würde dafürsprechen, dass er auch wegen schweren Diebstahls verurteilt wurde. Die meiste Zeit zwischen den Jahren 1929 und 1935 hat er wohl im Gefängnis verbracht.
In einem rechtsstaatlichen System würde man Diebe nur wegen der Taten verurteilen, die sie auch tatsächlich begangen haben. Und man würde den Verurteilten nach verbüßter Strafe die Möglichkeit geben, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Doch in Deutschland kamen im Januar 1933 die Nationalsozialisten an die Macht. Danach war nichts mehr, wie es eigentlich sein sollte.
2
Es ist ein großes Missverständnis zu glauben, dass die »Machtergreifung« der Nationalsozialisten im Januar 1933 wie eine Naturkatastrophe über Deutschland hereingebrochen wäre. Das Gegenteil war der Fall. Adolf Hitler war zu diesem Zeitpunkt schon längst einer der populärsten Politiker in Deutschland. Bei der Reichspräsidentenwahl von 1932 erhielt er im zweiten Wahlgang 36,8 Prozent der Stimmen. Seine Partei, die NSDAP, hatte Ende 1928 bereits mehr als 100.000 Mitglieder. Das war lange vor der Weltwirtschaftskrise ab Oktober 1929. Und schon bei der Reichstagwahl vom 14. September 1930 wurde die Partei zweitstärkste politische Kraft in Deutschland. Nur 22 Monate später, bei den Neuwahlen vom 31. Juli 1932, gaben 37,3 Prozent der Wähler der NSDAP ihre Stimme. Schritt für Schritt war es den Nationalsozialisten gelungen, die Republik zu entkernen. Sie hatten früh verstanden, wie mächtig Lügen sein können.
Eine Demokratie kann nur dann überleben, wenn eine stabile Mehrheit der Bürger an Fakten glaubt – also an Dinge, deren Existenz sich nach überprüfbaren Kriterien belegen lässt. Auf Basis dieser gemeinsamen Wahrheit kann man über politische Fragen diskutieren, Übereinstimmungen finden und sich auch uneinig sein. In jedem Fall redet man über die gleiche Sache. Wenn jedoch genug Menschen bereit sind, an Lügen zu glauben – ganz so, als seien es Fakten –, dann funktioniert das System nicht mehr. Demokratie stirbt dabei nicht durch äußere Gewalt, wie beispielsweise bei einem Staatsstreich. Sie zergeht innerlich. Die NSDAP hat bei regulären Wahlen nie eine absolute Mehrheit der Stimmen bekommen. Aber am Ende waren die Feinde der Republik so stark, dass diejenigen, die noch an den gemeinsamen Fakten festhielten, in der Minderheit waren. Die Demokratie war handlungsunfähig geworden.
Warum glauben Menschen plötzlich an Lügen? Meist kommen sie in bekannter Gestalt daher, sie schließen an Vorurteile und Ideen an, die schon vorher weitverbreitet waren. Antisemitismus war in Deutschland bereits in den Jahrhunderten zuvor ein Problem gewesen – und ist es bis heute. Judenfeindliche Narrative waren sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer Republik Teil des politischen und kulturellen Mainstreams. Solche Gedanken gehörten stets zum öffentlichen Diskurs, sie waren bekannt, präsent und aussprechbar. Nicht jeder Deutsche dachte so, aber es gab immer eine hinreichend große Zielgruppe von Menschen, die empfänglich dafür war. Aus diesem Milieu ist auch die NSDAP entstanden. Die Stigmatisierung von Juden als angebliche »Feinde der Volksgemeinschaft« war eine Lüge, mit der die NSDAP Wähler mobilisieren und ihre spätere Gewaltherrschaft rechtfertigen konnte.
Völkische Ideologien, die »Volk« und »Nation« gleichsetzten und von einer politischen Neuordnung im Sinne einer »Volksgemeinschaft« sprachen, gab es ebenfalls bereits seit dem späten 19. Jahrhundert. Besonders viele Anhänger fanden solche Ideen im protestantischen Milieu mit seinem Leistungsethos. Und so waren die Lügen auch formuliert: Wann »verdient« es sich ein Mensch, zur »Volksgemeinschaft« zu gehören? Und wann kann er aus der Gemeinschaft ausgestoßen werden?
Menschen, die damals einen gesellschaftlich unangepassten Lebensentwurf pflegten, fielen aus diesem Schema heraus. Wer etwa keinen festen Wohnsitz hatte und keiner geregelten Beschäftigung nachging, musste befürchten, vom NS-Regime als »Feind« markiert zu werden. Die Nazis nutzten den Begriff »Asoziale«, um Menschen zu betiteln, die außerhalb der bürgerlichen Konventionen lebten – ob freiwillig oder unfreiwillig: zum Beispiel als Bettler, Landstreicher, Hausierer, Tagelöhner oder Prostituierte. Gemein war ihnen in den Augen der Nationalsozialisten, dass sie angeblich »arbeitsscheu« seien und damit der Gesellschaft schadeten. Das musste die NSDAP nie anhand von Fakten beweisen. Adolf Hitler konnte sich darauf verlassen, dass ein hinreichender Teil der Deutschen dem Vorurteil zustimmen würde, dass »Asoziale« durch ihren Lebensstil ganz generell dem Gemeinwohl schadeten.
Das Propagandasystem entwickelte daraus eine zweite Lüge, die gleichzeitig als Rechtfertigung für Gewalt diente: Nur wenn man diese Leute entrechte und wegsperre, könne die Gesellschaft vor ihnen geschützt werden. Das schien vielen Deutschen damals schlüssig, zumal die Nationalsozialisten scheinbar logische Argumente aus der Ökonomie benutzten: Wenn man tatsächlich glaubte, dass es so etwas wie eine exklusive »Volksgemeinschaft« von Deutschen gäbe, dann ergab es natürlich auch Sinn, den Beitrag eines jeden Einzelnen zum wirtschaftlichen Erfolg des völkischen Kollektivs zu hinterfragen. Für die Mehrheit der Deutschen, die regulär erwerbstätig war, blieb diese Frage unverfänglich: Sie konnte ja von sich behaupten, dass sie durch ihre Arbeit auf den Feldern des Reiches oder in den Fabriken ihren Anteil leisten würde.
Auch Sinti und Roma waren schon seit Jahrhunderten Ziel von Diskriminierung und Ausgrenzung. Einerseits wurden sie in der NS-Zeit aus rassistischen Gründen verfolgt – in dem maßgeblichen Kommentar zu den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 werden Sinti und Roma – genauso wie Juden – als »artfremd« bezeichnet. Andererseits wurden sie auf einer ähnlichen gesetzlichen Grundlage wie auch »Asoziale« verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt. Viele Deutsche fanden das grundsätzlich richtig: Denn sie glaubten an die weitverbreiteten Vorurteile gegenüber »Zigeunern«, denen seinerzeit beispielsweise eine Neigung zum Diebstahl nachgesagt wurde.
Eine andere Opfergruppe nationalsozialistischer Verfolgung waren die sogenannten »Berufsverbrecher«. Die Bezeichnung wurde mit Absicht gewählt: Denn die Nationalsozialisten wussten, dass es populäre Vorurteile gegen Menschen gab, die wiederholt straffällig wurden. Viele Menschen glaubten nicht daran, dass verurteilte Verbrecher sich »bessern« und einen neuen Lebensweg einschlagen könnten. Der Begriff »Berufsverbrecher« sagt wörtlich, dass ein Mensch durch kriminelles Handeln seinen eigenen Lebensunterhalt bestreitet und genau darin eine Profession gefunden hat, die er ein Leben lang ausüben wird. Es gäbe keine Möglichkeit, solche Leute durch Haft und Resozialisierung in ein gesetzestreues Leben zurückzuführen. Deswegen müsste die Gesellschaft präventiv vor diesen Menschen geschützt werden.
»Berufsverbrecher« ist ein Schmähwort, das für sich genommen schon eine Lüge ist. Denn nach rechtsstaatlichen Prinzipien werden Menschen durch begangene und nachgewiesene Taten zu Verbrechern – und nicht, weil man bei ihnen eine Veranlagung oder Neigung zu künftigen Taten vermutet. Und trotzdem klang der Begriff für viele Zeitgenossen schlüssig.
Das hatte Gründe. Bereits im Kaiserreich und in der Weimarer Republik gab es eine Debatte darüber, was Strafe letztlich bewirken soll. Müsste man eine bestimmte Tat ahnden? Oder sollte man vorbeugend eingreifen, um zukünftigen Schaden abzuwenden? Verschiedene Experten vertraten damals die Ansicht, dass die Veranlagung zur Kriminalität bei manchen Menschen quasi in Fleisch und Blut übergeht. So zum Beispiel auch Robert Heindl, der später, ab 1946, erster Präsident des Bayerischen Landeskriminalamtes war. Er prägte den Begriff des »Berufsverbrechers« in der Kriminologie und veröffentlichte im Jahr 1926 eine 560-seitiges Buch zu diesem Thema.7
Heindl war der Meinung, dass Haft nicht dazu beitragen könne, einen »Berufsverbrecher« zu »bessern«. Er polemisierte gegen die »Utopie der Besserungstheorie« und befürwortete eine »lebenslängliche Sicherheitsverwahrung« für Menschen, die seiner Definition eines »Berufsverbrechers« entsprachen.8 Aus seiner Sicht unterschied sich der »Berufsverbrecher« vom »Gelegenheitsverbrecher« vor allem durch das Streben nach »Gewinnsucht«.9 »Die rasche Aufeinanderfolge der Verbrechen hat vor allem ihren Grund in dem verhältnismäßig großen Geldbedarf der meisten Berufsverbrecher. Denn sie lieben fast alle Alkohol, Weiber, Spiel«, so Heindl wörtlich.
Aus der Sozialisierung in dieser Gruppe ergäben sich bei »Berufsverbrechern« sowohl charakteristische wie auch körperliche Wesensmerkmale: »Das Gros der gewerbsmäßigen Verbrecher sind körperlich heruntergekommene Denkfaule. Alkohol, Kokain, zu wenig Schlaf, unregelmäßiges Leben, Aufenthalt in stinkigen Löchern, Onanie und sonstige Exzesse sorgen dafür«, schrieb Heindl.10 Fantasielosigkeit und mangelnde Intelligenz führten dazu, dass »Berufsverbrecher« ihre Straftaten auch stets auf eine ähnliche Weise begingen.
In einem anderen Kontext schrieb Heindl auch von einer »Zuchthäuslerphysiognomie«, die sich bei Menschen in Gefängnissen entwickle. Dazu zitierte er einen Anstaltsarzt, der sich über das Erscheinungsbild eines insgesamt acht Jahre in Haft sitzenden Mannes ereifert, von dem dokumentarische Porträtbilder gemacht wurden: Das »unschuldige« Erscheinungsbild, das der Gefangene bei seiner Verhaftung noch gehabt hätte, wäre mit den Jahren in der Zelle zu einem »unheimlichen, widerlichen« Aussehen geworden.11
Nun sind Verbrechensprognosen, so wie alle Zukunftsprognosen, nicht rechtssicher. Wir wissen nichts Faktisches über die Zukunft. Und weil das so ist, können durch radikale Präventivstrafen auch Unschuldige betroffen sein. Das war womöglich auch Heindl klar. Eher zwischen den Zeilen führt er deswegen noch eine eugenische Komponente in seine Argumentation mit ein.
Berufsverbrecher seien demnach nicht nur aus »Gewinnsucht« auf Verbrechen angewiesen und der Lebensumstände wegen als solche auch optisch erkennbar. Sie könnten darüber hinaus auch ihre Veranlagung zum Verbrechen genetisch vererben: »Die Schädlichkeit des Berufsverbrechers äußert sich auch noch indirekt. Jeder einzelne, in Freiheit gelassen, bildet den Ausgangspunkt einer schauerlichen geometrischen Progression. Er lernt andere an, die dann wieder Schüler haben werden. Vor allem aber wird der Berufsmäßige durch seine wiederholten Freiheitsperioden in die Lage gesetzt, Nachkommen zu erzeugen, die Rasse zu verschlechtern und so mittelbar die Kriminalität zu erhöhen«, so Heindl.12 »Berufsverbrecher« stellten, wenn man dieser Argumentation folgt, allein schon durch ihre Fortpflanzungsfähigkeit eine Gefahr für künftige Generationen dar.
Die Nationalsozialisten konnten gut an diese höchst zweifelhaften und bereits von rassenhygienischen Argumenten durchdrungenen Wortmeldungen anknüpfen. Bereits im November 1933 erließ das NS-Regime ein sogenanntes »Gewohnheitsverbrechergesetz«.13 Wer dreimal zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde, musste nicht nur mit einer verschärften Strafe rechnen, sondern konnte nach verbüßter Gefängnishaft auf unbestimmte Frist in »Sicherungsverwahrung« genommen werden. Allerdings musste der Verurteilte dafür vom Gericht als »Gewohnheitsverbrecher« charakterisiert werden. Und die Unterbringung war reglementiert: Sie sollte in normalen Haftanstalten vorgenommen werden.
Der nationalsozialistischen Landesregierung in Preußen reichte das nicht aus:14 Sie erließ, noch bevor das Gewohnheitsverbrechergesetz verkündet wurde, einen Erlass für die »Vorbeugehaft« von »Berufsverbrechern«. Wer aus »Gewinnsucht« – das heißt hier: wegen Eigentumsdelikten – dreimal zu mindestens sechs Monaten Haft verurteilt wurde, konnte von der Polizei ohne richterlichen Beschluss und ohne Befristung in ein Konzentrationslager gebracht werden. Dort waren die Verurteilten dem Willkürregime der SS ausgesetzt. Im Prinzip dachten die Nationalsozialisten in Preußen die mehr als zweifelhaften Ideen von Heindl in aller Konsequenz zu Ende: Berufsverbrecher könnten sich nicht »bessern«, sie müssten gebrochen und vernichtet werden.
Es war der Beginn einer ganz eigenen Verfolgungsgeschichte, die bis heute kaum aufgearbeitet ist. Womöglich haben viele Deutsche seinerzeit die große Lüge glauben wollen: Nämlich, dass die Gesellschaft vor »Berufsverbrechern« präventiv geschützt werden müsse, weil diesen das Kriminelle im Charakter oder gar im Erbgut liege. Tatsächlich aber lag die Schwelle, die nun von den Nationalsozialisten für die Einstufung zum »Berufsverbrecher« gesetzt wurde, verhältnismäßig niedrig. Das galt insbesondere für die damalige Zeit: Die Spätphase der Weimarer Republik war durch Massenarbeitslosigkeit und Armut geprägt. Wer in dieser Zeit auf die »schiefe Bahn« geriet, dem wäre das womöglich Jahre zuvor noch nicht passiert.
Man musste nämlich längst kein Schwerkrimineller sein, um die neuen preußischen Kriterien für die Definition eines »Berufsverbrechers« zu erfüllen. Das Strafgesetzbuch betrachtete damals beispielsweise jegliche Form von Einbruch als »besonders schweren Fall von Diebstahl«, der selbst bei mildernden Umständen mit einer Haftstrafe nicht unter drei Monaten zu ahnden war.15 Die Höchststrafe lag bei zehn Jahren. In die gleiche Kategorie fiel, wer Gegenstände aus einer Kirche stahl oder sich mit mehreren Menschen zusammentat, um Einbrüche oder Diebstähle zu begehen. Schon das »Schmierestehen« konnte also mit einer mehrjährigen Gefängnisstrafe geahndet werden. Zwei weitere Verurteilungen wegen minderschwerer Delikte reichten dann bereits aus, um in ein Konzentrationslager eingewiesen zu werden.
Die meisten sogenannten »Berufsverbrecher« haben tatsächlich gegen damals geltendes Recht verstoßen. Wenn sie zu regulären Haftstrafen verurteilt wurden, dann geschah das meist auf Basis gültiger Gesetze. Zu Opfern nationalsozialistischer Verfolgung wurden sie durch die »Vorbeugehaft« in den Konzentrationslagern, die außerhalb rechtsstaatlicher Grundlagen stattfand und nichts mit irgendeiner gerechtfertigten »Buße« für eine begangene Tat zu tun hatte, sondern auf rassenhygienischen Annahmen beruhte.
3
Otto war gleich zu Beginn der NS-Herrschaft erneut ins Visier der Justiz geraten. Im Gespräch mit Hermann Langbein sagte er, dass er mit 24 – das heißt zwischen Mai 1933 und Frühjahr 1934 – ein drittes Mal verurteilt wurde. Auf seiner Meldekarte, die im Landesarchiv Berlin erhalten geblieben ist, wird als erste vermerkte Adresse die »Neuendorfer Straße 90« in Brandenburg an der Havel genannt. Dort befand sich im Jahr 1933 das Konzentrationslager Brandenburg.16 Es gibt jedoch keinerlei Aufzeichnungen darüber, dass Otto bereits in dieser Zeit KZ-Häftling war. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass er hier ab Frühjahr 1934 inhaftiert war. Zu dieser Zeit wurde das Gebäude wieder als reguläres Strafgefängnis genutzt.
Im Spätsommer 1935 wurde Otto entlassen. Und er versuchte beruflich wieder dort Fuß zu fassen, wo er sich selbst am wohlsten fühlte: als Kleinselbstständiger mit eigenem Bauchladen. »Ich habe nach meiner Entlassung aus der Haft wieder gehandelt, das war denen natürlich nicht recht. Sie hätten es lieber gehabt, wenn ich beim Autobahnbau oder so gearbeitet hätte«, erinnerte sich Otto.17 Zum ersten Mal bezog er eine feste Wohnung: Er lebte in der Delbrückstraße 34, Ortsteil Schmargendorf, bei einer Familie Poppe.
Doch das neue Leben brachte auch rechtliche Verpflichtungen mit sich. Otto musste zur Polizei, um sich unter seiner neuen Adresse anzumelden. Sein antiautoritärer Geist traf nun auf die Verhaltensvorschriften in nationalsozialistischen Amtsstuben. »Ich ging hinein und sagte: ›Guten Tag‹. Da sagte der: ›Gehen Sie noch einmal ’raus!‹ Ich dachte, der hat noch zu tun und ging hinaus. Nach ein paar Minuten ging ich wieder hinein und sagte: ›Guten Tag‹, er schickte mich wieder raus und als ich zum dritten Mal hereinkam und: ›Guten Tag‹ sagte, meinte er: ›Wissen Sie denn nicht, dass das ›Heil Hitler‹ heißt? Gehen Sie noch einmal hinaus!‹ Ich bin also wieder herausgegangen, aber dann bin ich weggegangen und hab gedacht, die können mich mal.«
Am Ende musste seine Hauswirtin die Anmeldung übernehmen. Frau Poppe hat ihn am 23. September 1935 als Untermieter registrieren lassen. Damit war der Ärger jedoch nicht vorbei: »In der nächsten Zeit bekam ich ein paarmal Vorladungen zur Polizei, da habe ich mich aber nie darum gekümmert, die sollten mir den Buckel herunterrutschen.«
Die Zeit verging. Nur wenige Kilometer von Ottos neuer Wohnung entfernt liefen die Bauarbeiten am Berliner Olympiastadion. Hier fanden im August 1936 die Olympischen Sommerspiele statt – bis heute gelten sie als der wohl erfolgreichste Versuch, der Welt eine falsche Normalität von der politischen Situation in Nazi-Deutschland vorzugaukeln. Antisemitische Verbotsschilder wurden an öffentlichen Plätzen abmontiert, damit die internationalen Besucher sie nicht zu sehen bekamen. Der Stürmer, eines der schlimmsten Hetzblätter der nationalsozialistischen Presse, musste jede Ausgabe in dieser Zeit vor Veröffentlichung zur Prüfung vorlegen. Und Leni Riefenstahl schuf in ihren Olympia-Filmen eine damals als modern empfundene Ästhetik, die mystische Bilder, athletische Körper und bis dahin nie gesehene Kameraperspektiven in der Sportdokumentation verband. Auf der Biennale in Venedig im Jahr 1938 bekam die Regisseurin den Preis für den besten Film – noch vor Walt Disney mit dem abendfüllenden Zeichentrickfilm Schneewittchen.18
In Wahrheit bereitete sich das NS-Regime jedoch bereits während der Olympischen Spiele 1936 auf die nächste Eskalationsstufe ihrer Verfolgungspolitik vor. Sinti und Roma wurden während der zweiwöchigen Großveranstaltung in ein Sonderlager auf dem Gebiet des heutigen Bezirks Marzahn-Hellersdorf gesperrt. Und vor den Toren der Stadt entstand zeitgleich das Konzentrationslager Sachsenhausen.
Die Sicherheitsbehörden hatten Otto nicht vergessen. Anfang 1937 bekam er erneut Post. Dieses Mal war es nicht die reguläre Schutzpolizei, sondern die Geheime Staatspolizei (Gestapo), die sich bei ihm meldete. Otto hatte zwar die bisherigen Vorladungen ignoriert, aber als die Gestapo ihn anwies, sich auf dem Revier in der »Roten Burg«19 am Alexanderplatz zu melden, sah er sich gezwungen, zu handeln.
Er fuhr zu den Beamten in den gigantischen, kuppelgekrönten Backsteinbau und wurde gleich an Ort und Stelle verhaftet. Das war Ende Februar oder Anfang März 1937. Einige Tage muss er wohl in einer der zahlreichen Gefängniszellen gesessen haben, die einst Platz für 328 männliche Häftlinge boten und später von der Gestapo dafür missbraucht wurden, erklärte »Feinde« des Regimes »verschwinden« zu lassen. Der letzte Eintrag auf seiner Meldekarte datiert vom 10. März des gleichen Jahres: »Für K.Z. eingeliefert (Konzentrationslager Sachsenhausen)«. Der für Ihnen zuständige Gestapo-Beamte soll zu Otto noch gesagt haben: »Wir werden ihnen das Arbeiten schon beibringen!«20
Es spricht einiges dafür, dass Otto zum Opfer einer gezielten Verfolgungsaktion wurde, die Anfang 1937 von Heinrich Himmler initiiert wurde. Der Reichsführer SS war 1936 durch einen Erlass von Adolf Hitler und Reichsinnenminister Wilhelm Frick zum Chef der Deutschen Polizei ernannt worden. Ihm schwebte eine Vision vor: Himmler wollte eine »Volksgemeinschaft ohne Verbrecher« erschaffen.21 Er sagte später selbst, dass er nicht mehr darauf warten wollte, bis ein bereits verurteilter Straftäter aufs Neue überführt und verurteilt werde. Wer von den Nazis verdächtigt wurde, »von Natur aus« zur Kriminalität zu neigen, sollte zum vermeintlichen »Wohle der Gesellschaft« für immer weggesperrt werden.
Anfang 1937 beschloss Himmler, die Zahl der sogenannten »Vorbeugehäftlinge« signifikant zu erhöhen. »Ich gehe jetzt, weil mir die Kriminalität in Deutschland immer noch zu hoch ist, dazu über, Berufsverbrecher in viel größerem Umfange als bisher schon nach einigen Strafen, nach drei oder vier Malen, einzusperren und nicht mehr loszulassen«, sagte er im Januar 1937 vor Offizieren der Wehrmacht.22 Am 23. Februar 1937 ordnete er in einem Schreiben an das preußische Landeskriminalpolizeiamt an, zirka 2.000 »nicht in Arbeit befindliche Berufs- und Gewohnheitsverbrecher schlagartig in einem Tage im ganzen Reichsgebiet festzunehmen und in den Konzentrationslagern unterbringen zu lassen«.23 Es gab dafür auch speziell vorbereitete Namenslisten. Da Ottos Polizeiakte nicht mehr existiert, lässt sich nicht feststellen, an welchem Tag er genau verhaftet wurde. Aber seine Überstellung nach Sachsenhausen fällt exakt in jene Phase, in der sich die Zahl der sogenannten »Vorbeugehäftlinge« in deutschen Konzentrationslagern schlagartig verfünffachte.
Für Otto war es der Beginn seiner mehr als achtjährigen Leidenszeit als Lagerhäftling. Er selbst hat Jahrzehnte später noch versucht, den Sinn hinter alldem zu erkennen. Für ihn, dessen Lebensentwurf nicht in die gängigen Schemata des NS-Staates passte, war die Gewalt, die der nationalsozialistischen Ideologie innewohnte, schon sehr früh spürbar – lange bevor seine Altersgenossen als Soldaten in den Krieg zogen und alliierte Bomber die Großstädte Nazi-Deutschlands in Schutt und Asche legten. »Es war ja auch egal, ob im Krieg oder im KZ – überall drohte der Tod«, sagte Otto.24 Er musste lernen, unter den Lebensbedingungen, in die ihn das System hineinzwang, zu überleben.
Noch im gleichen Jahr wurde der »Grunderlass vorbeugende Verbrechensbekämpfung« verkündet.25 Es war der umfassende Versuch, eine rechtliche Grundlage für die Verfolgung von »Asozialen« und »Berufsverbrechern« im gesamten Deutschen Reich zu schaffen. Die strengen Vorschriften aus Preußen wurden dabei größtenteils adaptiert, nochmals verschärft und durch »Gummiparagraphen« erweitert, die viel Spielraum bei der Rechtsauslegung offenließen. In zeitlich unbefristetete »Vorbeugehaft« konnte nun genommen werden, wer als »Berufsverbrecher« wegen aus »Gewinnsucht« begangenen Taten dreimal zu mindestens drei Monaten Haft verurteilt wurde. Außerdem führte der Erlass nun den Typus des »Gewohnheitsverbrechers« ein, der immer wieder ähnliche Straftaten begeht (wenn auch nicht aus »Gewinnsucht«) und nach den gleichen Maßgaben wie ein »Berufsverbrecher« belangt werden konnte.
Ohne jede weitere Definition wurden auch »Asoziale« als Fokusgruppe der Maßnahmen benannt. Sie mussten sich noch nicht einmal eines serienmäßigen Gesetzesbruchs schuldig gemacht haben, um in ein KZ verschleppt zu werden. Es reichte, wenn die Polizei befand, dass ein Mensch »durch sein asoziales Verhalten die Allgemeinheit gefährdet«. Auch falsche Angaben zur Person auf dem Polizeirevier in Verbindung mit dem Verdacht auf weitere Straftaten werden als hinreichender Grund für sogenannte »Vorbeugehaft« in einem Konzentrationslager genannt.
Der Erlass öffnete das Tor für die flächenmäßige Verfolgung von Personen, die in den Augen der Nationalsozialisten »verdächtig« waren oder einfach nur einen Lebensstil pflegten, der nicht im Einklang mit der völkischen Ideologie stand. Es wird geschätzt, dass bis zu 80.000 als »Asoziale« und »Berufsverbrecher« bezeichnete Menschen Häftlinge in deutschen Konzentrationslagern waren. Viele von ihnen haben die Haft nicht überlebt.
4
Der 16. März 1937. Otto war an jenem Tag einer von 17 Männern, die als »Zugänge« im Konzentrationslager Sachsenhausen registriert wurden. Die Gruppe konnte unterschiedlicher kaum sein: Heinrich Gündchen, Häftling Nummer 937, war bereits 55 Jahre alt. Josef Karolewski, der genauso wie Otto ebenfalls als »Vorbeugehäftling« firmierte, hatte gerade erst seinen 25. Geburtstag gefeiert. Otto war der zweitjüngste Neuzugang an diesem Tag.
Und schon in den ersten Minuten begann die Gewalt. »Da gab es Ohrfeigen und man wurde körperlich misshandelt«, erinnerte sich Otto. »Einer von uns hatte einen Zylinder, oder vielmehr so eine ›Glocke‹ auf, dem hat man die Krempe über die Ohren gezogen, und so was alles.«
Als Otto an der Reihe war, wurde er nach seinem Namen und der Herkunft gefragt. Er konnte sich die Gründe dafür selbst nicht so recht deuten, aber die Wachmänner von der SS hielten in diesem Moment Abstand zu ihm. »Ich erkläre mir das dadurch, dass derjenige, der mich da aufgenommen hat, in unserer Gegend in Berlin gewohnt haben muss und meinen Vater gekannt hat.« Sein Vater sei eine Respektsperson gewesen, sagte Otto. »Mein Vater war auch ein Mensch, der so wie ich nie gelebt hätte, er war ein ehrenwerter Mann, er ist später auch so geblieben, wie er war.«26
Otto Küsel senior wurde in Kenntnis darüber gesetzt, dass sein Sohn in Sachsenhausen inhaftiert war. Einmal, erinnerte sich Otto junior, habe sein Vater auch versucht, die Erlaubnis für einen Haftbesuch zu bekommen. Leider vergeblich. Es ist nichts darüber bekannt, ob beide später noch einmal persönlichen Kontakt zueinander hatten.
Das Konzentrationslager Sachsenhausen lag am Stadtrand von Oranienburg, nur etwa 35 Kilometer von der Alten Reichskanzlei entfernt, in der sich die Wohn- und Arbeitsräume von Adolf Hitler befanden. Bis Neukölln, wo Otto den größten Teil seines bisherigen Lebens verbracht hatte, war es eine Bahnfahrt von etwas mehr als einer Stunde. Seit 1925 war Oranienburg an das Berliner S-Bahn-Netz angebunden und damit auch verkehrstechnisch Teil der Großstadtregion.
In den Jahren 1933 und 1934 hatte es in Oranienburg bereits ein erstes Konzentrationslager gegeben. Es lag mitten in der Innenstadt auf dem Gelände einer alten Brauerei und diente als Gefangenenlager für politische Gegner der NSDAP. Sie wurden dort unter Aufsicht der SA in »Schutzhaft« genommen – ein Euphemismus des NS-Regimes für die Gefangennahme von Andersdenkenden auf Basis des seit dem Reichstagsbrand geltenden Ausnahmezustands. Der anarchistische Schriftsteller Erich Mühsam wurde am 10. Juli 1934 im KZ Oranienburg ermordet. Kurz danach wurde das Lager als Folge des »Röhm-Putsches«27 geräumt und aufgelöst.
Im Jahr 1936 wurde dann 20 Fußminuten vom früheren KZ Oranienburg ein neues Konzentrationslager errichtet. Die NSDAP hatte ihre Machtstellung längst gefestigt. Es ging ihr nicht mehr darum, eilig verhaftete Regimegegner wegzusperren. Das KZ Sachsenhausen sollte ein Konzentrationslager neuen Typs werden.28 Die Planungen fielen in jene Phase, als das Lagersystem der Nationalsozialisten Konturen annahm und vereinheitlicht wurde. Dementsprechend sollte Sachsenhausen eine Vorbildfunktion für alle anderen Konzentrationslager einnehmen.
Die Grundfläche des Lagers hatte die Form eines Dreiecks. Sämtliche Häftlingsbaracken waren – wie in einem Amphitheater – im Halbkreis um den zentralen Appellplatz errichtet worden. Dort befand sich auch das Torhaus, auf dessen Gitter der Satz »Arbeit macht frei« zu lesen war. Von dem Wachposten auf dem Torhaus, der sich in einem fachwerkverkleideten Vorbau befand, konnte man das gesamte Lager überblicken – und notfalls auch mit den dort postierten Maschinengewehren unter Feuer nehmen. Totale Kontrolle über die Häftlinge, das sollte sich bereits in der Architektur des Komplexes widerspiegeln.
Otto bekam eine Häftlingsuniform aus Drillichstoff. Er wurde nun als »Berufsverbrecher« geführt, dementsprechend war seine Kleidung auch gekennzeichnet: Am rechten Hosenbein und auf der linken Brustseite musste er einen 30 Zentimeter langen und zehn Zentimeter breiten Stoffstreifen in grüner Farbe tragen. Jeder Häftling wurde auf diese Weise markiert, damit die Wachmannschaften sofort wussten, weshalb ihn der NS-Staat ins Konzentrationslager geschickt hatte. Politischen Häftlingen war die Farbe Rot zugeordnet. Später, ab dem Jahr 1938, wurde das System für alle Konzentrationslager einheitlich definiert: aus den Stoffstreifen wurden Dreiecke, die sogenannten »Winkel«. Wer als »Asozialer« in ein KZ kam, musste einen schwarzen Winkel tragen, Homosexuellen war der »rosa Winkel« zugedacht worden. Juden trugen eine Kombination aus gelben und andersfarbigen Winkeln, die – übereinandergelegt – einem Davidstern ähnelten.
Diese Kennzeichnung war jedoch nicht nur als Orientierung für die Wachmannschaften gedacht. Sie war Teil einer psychologisch sehr ausgefeilten, zynischen Strategie, mit der die Nationalsozialisten von Beginn an versuchten, das Innenleben des Lagers nach ihren Vorstellungen zu gestalten – ganz nach dem Prinzip »divide et impera« (»teile und herrsche«) wurden die Häftlinge entlang von Interessensgegensätzen gespalten und gegeneinander aufgehetzt.
Die Einteilung in Häftlingsgruppen führte einerseits zu Rivalität. Gezielt wurden die einzelnen Farbwinkel gegeneinander ausgespielt, indem man sie unterschiedlich behandelte. Da im brutalen Alltagsklima der deutschen Konzentrationslager das eigene Überleben für die Häftlinge das bestimmende Leitthema war, stand bald nicht mehr der gemeinsame Feind, sondern die Verbesserung der eigenen Überlebenschancen im Mittelpunkt des Handelns. Die Rivalität zwischen den »Grünen Winkeln« und den »Roten Winkeln« beispielsweise bestimmte in vielen Konzentrationslagern den Häftlingsalltag. Gleichzeitig gab es innerhalb einer Gruppe aber auch oftmals Solidarität: Menschen, die aus ähnlichen Gründen ins Konzentrationslager gekommen waren, halfen einander oft gegenseitig.
Doch die SS beließ es nicht bei der Spaltung der Häftlingsgemeinschaft in einzelne Gruppen. Sie führte auch ein System der hierarchischen Belohnung ein. Die Grundzüge dafür waren im KZ Dachau entwickelt worden.29 Um ihr Gewaltregime bis in die letzten Nischen des Lageralltags zu übertragen, ernannte die SS – auch nach rasseideologischen Kriterien – sogenannte »Funktionshäftlinge«, die gewisse Privilegien genossen. Meist waren das in Sachsenhausen »Reichsdeutsche«.30 Sie wirkten, zumindest auf dem Papier, als verlängerter Arm der Wachmannschaft im Lager und nahmen zahlreiche Verwaltungstätigkeiten wahr. Fast alle Verantwortlichen der SS hatten auf diese Weise in ihrem Bereich Hilfskräfte unter den Gefangenen.
In Sachsenhausen ernannte die SS drei »Lagerälteste«. Sie konnten selbst Strafen aussprechen und hatten die Aufsicht über alle Häftlingseinrichtungen im Lager.31 In Block B gab es eine Häftlingsschreibstube. Hier war auch das Büro des »Arbeitsdienstes« untergebracht – so hieß der Funktionshäftling, der auf Befehl der SS die Arbeitskommandos einteilte. In den Häftlingsbaracken gab es jeweils einen »Blockältesten«, der den »Blockführern« von der SS unterstand. Den Blockältesten unterstanden wiederum die »Stubenältesten« und die »Stubendienste«. Je höher ein Häftling in dieser Hierarchie war, desto mehr Handlungsspielraum fiel ihm zu. Zwar stand das gesamte Lager unter der Dauerkontrolle durch die Posten auf den Wachtürmen, aber die eigentlichen SS-Vorgesetzten der Funktionshäftlinge kontrollierten nur sporadisch das Handeln ihrer Untergebenen.32 Das gab den »Lagerprominenten«, wie die Funktionshäftlinge bald genannt wurden, sehr viel Macht.
Überlebende des NS-Lagersystems berichteten später oft von dem Grauen, das besonders von den »grünen« Funktionshäftlingen ausging. »Berufsverbrecher« waren gefürchtet, weil sie ihre Machtstellung oft missbrauchten. Allerdings war nur ein sehr kleiner Teil der über 60.000 »grünen« Häftlinge in einer Kapo-Funktion tätig.
Es gab auch Häftlinge, »grüne« wie »rote«, die solche Funktionsposten sehr verantwortungsvoll im Sinne ihrer Mitgefangenen ausfüllten. Natürlich mussten auch sie die Befehle der SS befolgen. Aber dazwischen ergaben sich dann Gelegenheiten, die Interessen der Mithäftlinge zu verteidigen und sie vor Schlimmerem zu bewahren. Gute Funktionshäftlinge lebten oft eine Doppelrolle im Lager: Einerseits mussten sie für die SS als verlässliche Ansprechpartner erkennbar sein. Anderseits nutzten sie ihre Position, um immer dann zu helfen, wenn sie es konnten. Dafür war Geschick und soziale Intelligenz nötig. Manchmal sogar schauspielerisches Talent.33
Solche verantwortungsvoll handelnden Funktionshäftlinge achteten beispielsweise darauf, dass die Essensrationen gerecht verteilt wurden, dass Ordnung im Block herrschte und die organisatorischen Abläufe reibungslos funktionierten.34 Das war im Sinne der Lagerleitung, verstieß aber auch nicht gegen die Interessen der Mithäftlinge. Im Gegenzug eröffnete sich ein gewisser Handlungsspielraum – beispielsweise bei der Besetzung von Arbeitskommandos, bei alltäglichen Disziplinarfragen und sogar bei der Belegung von Transporten.35 Und nicht zuletzt mussten sie bereit sein, auch selbst Opfer zu erbringen: Wenn die SS aus Kalkül oder Willkür etwas zu bemängeln hatte, ließen sie sich auch für die vermeintlichen Fehler ihrer Mitgefangenen verprügeln. Das erforderte einen starken Charakter.
Wer als Lager- oder Blockältester diente, hatte nicht nur organisatorische oder disziplinarische Befugnisse, sondern zudem das Recht, andere Häftlinge für neue Posten vorzuschlagen. Andersherum konnten SS-Leute aber auch Funktionshäftlinge absetzen, wenn sie mit deren Arbeit nicht zufrieden waren.
Das schuf den Boden für Denunziationen.36 Und es führte mitunter zu Konflikten, die sehr wohl von der SS einkalkuliert waren. Häftlinge, die in der Hierarchie aufsteigen wollten, konnten entweder auf die Gunst eines Funktionsträgers hoffen oder eben diesen Funktionsträger in Misskredit bringen. Nicht selten wurden die Denunzianten anschließend für Verleumdungen belohnt. Andererseits half das Empfehlungssystem auch dabei, dass Widerstandsgruppen ihre eigenen Leute im Lagersystem platzieren konnten. Dadurch war es ihnen möglich, zumindest teilweise Einfluss auf das Schicksal ihrer Mitgefangenen zu nehmen und in den Besitz von Informationen über den laufenden Massenmord in den Konzentrationslagern zu kommen. So hatten sie die Chance, Leben zu retten.
5
Otto war Häftling Nummer 979 im KZ Sachsenhausen. Die NS-Propaganda behauptete, dass angeblich problematische Charaktere durch harte körperliche Tätigkeit in Arbeitslagern wie Sachsenhausen zu besseren Menschen geformt werden könnten. Das war blanker Zynismus. Tatsächlich war »Arbeit« in Sachsenhausen das bevorzugte Mittel, um Menschen zu brechen und zu vernichten. Sie war meist sinnlos, es ging nicht darum, etwas zu erschaffen. Das Ziel von Arbeit war nicht die Veränderung der Welt, sondern die Zerstörung des menschlichen Willens.
Das Gleiche galt für den »Sport«. Es ging nicht um ein Training zur Körperertüchtigung, sondern um Qual und Demütigung. Häftlinge, die kein Arbeitskommando hatten, mussten »Sport« treiben. In der ersten Zeit nach seiner Ankunft wurde auch Otto zu solchen Übungen gezwungen. »Die Leute mussten an den Toren stehen im ›Sachsengruß‹, Hände hinterm Kopf, in die Knie gehockt. So haben sie vorne am Tor gesessen und wurden von den Wächtern oben, die auf dem Turm saßen, beobachtet. Und wehe dem, der Hände heruntergenommen hat«, erinnerte sich Otto.37
Nach einiger Zeit bekam er ein Arbeitskommando zugeteilt. Er musste Steine schleppen für den Bau von Offiziershäusern der SS. Die Gebäude wurden vom Architekten Bernhard Kuiper geplant, der auch schon das Lager entworfen hatte. Sie stehen heute noch: Spitzgiebelige Einfamilienhäuser, an denen jeder Besucher der Gedenkstätte vorbeilaufen muss, um das Besucherzentrum zu erreichen. Die »Arbeit« an diesen Häusern war von Beginn an als Schikane geplant. Anstatt die Backsteine direkt an die Baustelle zu liefern, wurden sie 100 oder 200 Meter vom Baugrundstück entfernt abgeladen. Die Aufgabe der Häftlinge war nun, die Steine auf ein Brett zu laden und sie zum eigentlichen Bestimmungsort zu tragen. »Vorschrift war: Einundzwanzig Steine. Ein Stein hat immerhin sieben Pfund gewogen«, erinnerte sich Otto. Jedes Mal musste er mehr als 70 Kilo auf den Schultern stemmen. Harte körperliche Tätigkeit war er nie gewohnt gewesen, so ging es vielen, die in dieser Zeit in Sachsenhausen waren. Und die Nazis wussten das. Einige Häftlinge hätten trotzdem freiwillig mehr geschleppt, vielleicht auch, um sich selbst zu beweisen. Das Essen war der körperlichen Tätigkeit nicht angemessen, es war klar, dass Menschen hier zugrunde gerichtet werden sollten. Und deswegen verstand er auch nicht, warum sich manche Mithäftlinge noch ein oder zwei Klötze mehr auf ihr Brett luden. Otto jedenfalls hätte am liebsten gar nichts getan, die sinnlose »Arbeit« führte ihn in einen Zustand des innerlichen Widerstands.
Mit der Zeit lernte er, die Lücken im System auszunutzen. Ein Problem betraf die Körperhygiene und damit letztlich auch seine eigene Gesundheit: In den Häftlingsbaracken, in denen teilweise mehrere Hundert Menschen untergebracht wurden, gab es zwar einen Waschraum – darin befanden sich aber keine Duschen, sondern nur zwei kreisrunde Stehbrunnen, in denen das Wasser in dünnen Strahlen nach oben geleitet wurde. Jeden Morgen hatten die Häftlinge 30 Minuten Zeit, sich zu waschen. Oft standen acht bis zehn von ihnen gleichzeitig um diese Brunnen herum und versuchten, in den knappen Momenten etwas Wasser abzuschöpfen. Otto zog es deswegen vor, in den Rohbauten der SS-Häuser zu baden. »Oft waren zum Beispiel in den Häusern Waschkessel, da konnte ich mich waschen, ich durfte mich bloß nicht erwischen lassen. Der Bauunternehmer, das war zwar ein SS-Mann, aber kein schlechter Kerl, wenn der mich geschnappt hätte, der hätte nichts gesagt, aber ein anderer SS-Mann hätte mich nicht sehen dürfen.«38