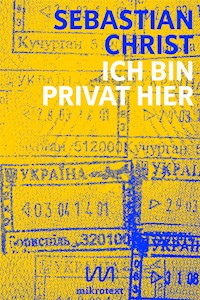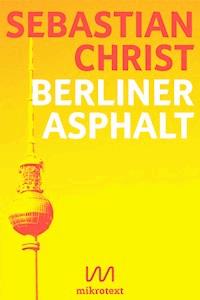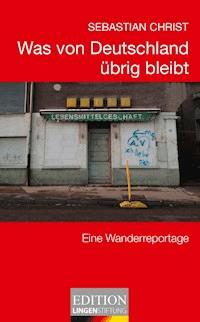
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lingen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der demografische Wandel ist keine statistische Größe, er wird auf dem Weg durch die deutsche Provinz von Ost nach West erfahrbar. Deutschland wächst nicht mehr von innen heraus, es schrumpft. Dörfer, ganze Landstriche verwaisen, junge Menschen ziehen in die Ballungszentren. Doch können wir uns ein Deutschland ohne Provinz leisten? Eine Wanderreportage, die den Verlust von Heimat, Identität, aber vor allem von unwiederbringlicher Vielfalt spürbar werden lässt - ein Plädoyer für die Provinz. EDITION LINGEN STIFTUNG - Publikationen für politisch interessierte Bürger
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Kapitel 0
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Danke
Über den Autor
Impressum
Vorwort
Ich bin in einer kleinen Stadt in Nordhessen geboren, die weder Showmaster noch Olympiasieger hervorgebracht hat. Frankenberg. Eine kleinlaute Stadt, die fünfundvierzig Fahrminuten von der nächsten Autobahn entfernt liegt, für nichts auf der Welt bekannt ist und in der die Menschen vielen neuen Trends erst einmal skeptisch gegenüberstehen. Eine Stadt ohne Idole und Ideen. So dachte ich jedenfalls einmal. Nach dem Abitur packte ich im Jahr 2001 meine Sachen und fuhr ab Richtung Süden.
Ich habe in München studiert, mir von Oberbayern aus einen Überblick verschafft. Über Deutschland. Ich habe einiges gelernt. Zum Beispiel, dass drei Viertel aller deutschen Kinder in ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen sind wie ich, nämlich außerhalb der sechsundsiebzig deutschen Großstädte. Dass der deutsche Mittelstand, der über sechzig Prozent der Arbeitsplätze in diesem Land stellt, mehrheitlich in der Provinz zuhause ist. Dass all die beeindruckenden Zahlen von der deutschen Vize-Exportweltmeisterschaft niemals möglich wären, wenn es nicht die vielen Menschen im ländlichen Deutschland gäbe, die immer wieder abseitige und geniale Ideen haben, auf die niemand in Berlin, Hamburg oder Köln kommt. Das Telefon ist nicht in München erfunden worden, sondern im südhessischen Friedrichsdorf. Das Kugellager in Schweinfurt. Und der Erfinder des ersten funktionsfähigen Computers, Konrad Zuse, hat sein Technikinteresse in Hoyerswerda entwickelt – jener deutschen Stadt, die heute am stärksten vom demografischen Wandel betroffen ist.
Während meines Studiums verbrachte ich auch einige Monate in Frankreich. Ich lernte dort viele neue Freunde kennen. Die meisten hatten ein Hauptstadtproblem. Wenn sie beruflich etwas erreichen wollten, mussten sie irgendwann dorthin ziehen. Alle redeten sie von Paris. Als ich zurückkam, hörte ich meine Kommilitonen von Reutlingen, Marburg, Greifswald oder Osnabrück sprechen. Ich begriff, dass eine entwickelte Provinz Freiheit bedeuten kann. Auch in der Lebensgestaltung.
Seit mehr als fünf Jahren lebe ich nun in Berlin. Und doch hatte ich nie das Gefühl, im Mittelpunkt des Landes zu wohnen. Vielleicht in der größten Stadt. Aber ich war mir sicher, dass die Bundesrepublik auch dort passierte, wohin die Züge am Hauptbahnhof abfuhren: Elsterwerda, Rathenow, Wismar. Es war diese Vielfalt, die mich immer wieder neugierig werden ließ. Mit zwanzig war ich froh, endlich aus der Provinz wegziehen zu können. Heute freue ich mich für jeden, der geblieben ist.
Der demografische Wandel lässt die Republik von innen her schrumpfen. Während die größten Städte vom Zuzug junger Menschen profitieren, leidet die Provinz gleich mehrfach: Zu wenige Kinder werden dort geboren, zu viele Talente wandern ab und die Bevölkerung altert überdurchschnittlich stark. Im Jahr 2050, sagen Wissenschaftler, wird das Durchschnittsalter der Bevölkerung außerhalb der Metropolregionen bei über fünfundfünfzig Jahren liegen. Noch sind es Prognosen. Doch vielerorts sind die Auswirkungen schon spürbar.
Dies ist die Geschichte einer Wanderung durch die Mitte Deutschlands. Sie fand im Winter statt, wenn die deutsche Provinz weder Postkartenbilder noch Trachtentanzgruppen zu bieten hat. Es war ehrlicher so. Ich war Schritt für Schritt auf der Suche nach einem Land, in dem ich aufgewachsen bin. Und in dem ich immer noch lebe.
Kapitel 0
Es war im dunkelsten Winter aller Zeiten, als ich Deutschland für ein paar Augenblicke verließ. Ich hatte die Sonne seit Wochen nicht mehr gesehen, der Rollsplit auf den abgetauten Bürgersteigen knirschte wie zerbrochenes Glas. Die Luft schmeckte nach gerade geschmolzenem Schnee, und schon am frühen Nachmittag fuhren die Taxis mit eingeschalteten Scheinwerfern durch den städtischen Dämmerzustand. Auf den Straßen von Berlin waren nur wenige Menschen unterwegs. Es war die Zeit, als alle unter Glühbirnen, Energiesparlampen und Neonröhren auf das Leben nach dem Schnee warteten.
Noch als ich meine Stiefel schnürte, mochte ich noch nicht so recht dran glauben, was ich da gerade tat. Mir stieg der Geruch von Kiefernzapfen und Kerzenwachs in die Nase, als ich die Heizung in meiner Wohnung herunterdrehte und die elektrischen Geräte ausschaltete. Was wichtig war, trug ich nun auf dem Rücken: zwei Sätze Wechselkleidung, zehn Paar Socken, ein Cape, eine Kamera, Kartenmaterial, einen alten Laptop, die jeweiligen Ladegeräte, eine kleine Reiseapotheke und ein wenig Proviant. Gegen die Kälte schützte ich mich mit dicken Pullovern, einem mehr als ein Quadratmeter großen Halstuch aus Jordanien und einer warmen Jacke, deren Stoff jedoch von Sonne, Wasser und Waschmittel über die Jahre hinweg so bleich und spröde geworden war, dass er an den Gummibünden scheibchenweise abblätterte.
Funktionskleidung hatte ich nicht dabei. Ich wäre mir albern vorgekommen: Als ob ich einen Raumanzug bräuchte, um die Wiesen, Wälder und Äcker meines eigenen Geburtslandes zu erkunden. Und im Grunde war mir auch nicht danach, zu planen. Ich wollte einfach loslaufen.
Am Berliner Hauptbahnhof kaufte ich mir ein Ticket nach Osten. Ich stieg in einen Waggon mit tiefen Sitzen, der von einer schuhschachtelförmigen Diesellok übers Gleisbett gezogen wurde. Am Zugfenster beobachtete ich die Landschaft dabei, wie sie bei hundertzwanzig Stundenkilometern am Fenster vorbei brach. Alles war Farbe. Nichts war Form. Und ich konnte mir nicht im Geringsten vorstellen, worüber die Menschen längs der Strecke lachten und stritten. Cottbus. Frankfurt. Der Zug war hier zu Ende, ich nahm ein Taxi. Hinter der Oder ließ ich den Fahrer am ersten Bahnhof anhalten. Ab nun hatte ich schmatzenden Sandboden unter den Füßen.
Kapitel 1
Das erste, was ich von Słubice sah, war ein Gleisstrang und das weite Land, das sich flach nach Osten entrollte bis es irgendwann gegen Berge prallte; das Gras, auf dem Schneeflecken lagen und der Gestank von verbranntem Diesel, der über allem lag. Ich zupfte an den Riemen meines Rucksacks, bis sie straff genug saßen für die nächsten Stunden und merkte, dass mich die Leere beinahe erschlug. Der Ortsname des winzigen Bahnhofs war mit Haltestäbchen am Schild befestigt: „SŁUBICE“ starrte es stieläugig vom Blech. Auf der Wartebank am anderen Gleis saßen ein paar Jugendliche, sie sprachen über ein hübsches Mädchen in Rzepin, das sie dort finden wollten. Ihre Sprache war voll von Slangwörtern. Ich versuchte ihnen zuzuhören, gab aber schnell auf. Dann lief ich los, und die nächsten neunhundert Kilometer schaute ich fast immer nach Westen, während ich gleichzeitig in alle Himmelsrichtungen dachte.
So fing alles in Słubice an. Ich musste lachen, weil ich mehr fühlte, als dass ich sah. Vor einhundertzehn Jahren fuhr hier ein Zug nach Westen, damals noch durch den Stadtteil „Frankfurt-Dammvorstadt“. In einem der Waggons saß ein vierzehnjähriger Bauernjunge namens Stanislaus, der weder lesen noch schreiben konnte. Mein Urgroßvater. Ich hatte ihn nie kennengelernt, aber viel von ihm gehört. Meine Großtante Elfriede hatte mir sein Leben erzählt, ich sollte alles im Detail wissen. Es ist eine Geschichte, die von Wegziehen, Ankommen und Dazwischensein handelt. Sie konnte stundenlang mit leuchtenden Augen von ihrem Vater sprechen. Je länger sie redete, desto mehr polnische Wortfetzen und Satzbausteine mischten sich in ihre Monologe. Manchmal schrieb sie mir auch von ihm. Ihre Handschrift war Lateinisch, nicht Sütterlin, so wie bei meinen deutschstämmigen Verwandten aus dieser Generation. Was sie erzählte, war ergreifend zeitlos. So klar stand ihr alles noch vor Augen.
Mein Urgroßvater wurde im Jahr 1889 in einem winzigen Dorf geboren, das zum Gouvernement Kalisz im Russischen Reich gehörte. Polen war zu diesem Zeitpunkt schon seit über hundert Jahren von der Landkarte verschwunden, aufgeteilt zwischen Preußen, Österreich und Russland. In den Industriezentren des „Weichsellandes“ wuchs ein selbstbewusstes polnisches Bürgertum heran, auf dem Land dagegen herrschte bittere Armut. Stanislaus musste schon als Junge auf dem Hof seiner Eltern arbeiten. Mit seinen Geschwistern baute er eine kleine Kate, die mehrere Kilometer weiter draußen zwischen Äckern und Wirtschaftswegen stand. Hier lebte er tageweise zwischen Pferden und Pflügen, besonders, wenn es abends schon früh dunkel wurde. Den Proviant nahmen die Kinder mit aufs Feld.
Weil der Schulunterricht im Gouvernement Kalisz ab 1885 nur noch auf Russisch abgehalten werden durfte, sollte der Dorfpfarrer den Kindern Lesen und Schreiben beibringen. Der Lehrauftrag ging irgendwo zwischen dem Alten und dem Neuen Testament verloren. In der Einsamkeit seiner kleinen Hütte entwickelte sich Stanislaus jedoch zu einem geschickten Handwerker. Er lernte, jegliches Gerät mit einfachsten Mitteln zu reparieren. Und schon früh träumte er davon, nach Deutschland zu gehen. Die Grenze war nur achtzig Kilometer entfernt, in Stanislaus’ Familie wurde auch Deutsch gesprochen – Kalisz gehörte vor dem Wiener Kongress zeitweise zu Preußen.
Dann kam jener Tag im Jahr 1903, als sich Stanislaus entschloss, in den Westen aufzubrechen. Er war des Unterrichts beim Dorfpfarrer überdrüssig geworden, mit vierzehn Jahren würde er nicht mehr das Alphabet lernen können, dachte er. Und außerdem fühlte er sich alt genug, um für sich selbst zu sorgen. Meine Großtante Elfriede beschrieb es in einem ihrer Briefe ganz nüchtern: „Dann hat Stanislaus den Pfarrer in seiner Hütte eingesperrt und ist ab nach Deutschland.“ Was für eine Entscheidung.
Kapitel 2
Ich folgte den Bahnschienen noch einige Meter. Die Straße ins Stadtzentrum war eng und dicht befahren. An mir zogen mehr deutsche als polnische Kennzeichen vorbei, und links des Weges erhob sich ein sozialistischer Kastenbau aus der Erde, dessen Wände mit gelben Kunststoffplatten verblendet waren. Hinter den Fenstern: schütteres Garn, Beamtengewebe. Vor dem Gebäude befand sich eine gigantische Tankstelle. Ebenfalls ein Zweckbau, hier füllten Fernfahrer aus Deutschland und anderen EU-Staaten glucksend Benzin in die dicken Kolbenbäuche ihrer Lastwagen.
Ich ging weiter, über schmale Straßen, an Wiesen und Brachen vorbei. Später konnte ich die Oder sehen, die wie ein Panther an mir vorbei schlich. Das Zentrum von Słubice war voll mit Läden. Und mit Leuchtreklamen, deren Buchstaben im Dunst wie kleine Feuer brannten.
In einem Supermarkt nahe der Grenze kaufte ich noch etwas zu trinken ein und traf fast nur Menschen, die jenseits der Oder wohnten. Die Kassiererin sprach sie alle auf Polnisch an, und wechselte dann klaglos ins Deutsche, es war ihr zur Routine geworden. In ihrem Schubfach lagen Złoty- und Euro-Scheine nebeneinander. Und wenn doch ein Pole in der Schlange stand, klang ihre Sprache wie ein kleiner Frühlingsbach, der zischend und säuselnd über Felsen und Grundsteine hinweghüpfte. Vor dem Supermarkt klackten Kofferräume über deutschen Kennzeichen. Ich sah in zufriedene Gesichter von Brandenburgern, die hier ein gutes Geschäft gemacht hatten. Ich begegnete Schulmädchen, die über den Unterricht flachsten, beobachtete junge Burschen, die sich neue Dummheiten ausdachten und auch deutsche Studenten beim Bummel durch das neue polnische Einkaufsparadies, Plastiktüten in beiden Händen. Der Weg zur Grenze war gesäumt von hell erleuchteten Schaufenstern und Shoppingmalls mit Fassaden aus Beton und Stahl, die neonweiß über die abgelebten klassizistischen Fassaden der alten Dammvorstadt triumphierten.
Der Kreisverkehr an der Europabrücke war gesäumt von tauenden Schneematschhaufen, und der Himmel hing tief, ganz so, als wolle er beide Städte am Boden festdrücken und im Trüben vereinen. Die ersten nassen Flocken plumpsten vom Himmel herab. Eine Grenze gab es nicht mehr. Auf polnischer Seite waren die einstmaligen Grenzgebäude durch Ladenzeilen und Zigarettenstände ersetzt worden, am Westende der Brücke stand ein Bagger im Schnee, der die Zollgebäude von früher mit stahlharten Schaufelschlägen wegfraß. Von dem dunklen Tunnel, durch den man einst nach Deutschland einfahren musste, existierte nur noch ein Haufen Schutt. Kein Mensch kümmerte sich mehr um die Linie, die in der Mitte des Flusses Deutschland von Polen trennte. Sie war nur noch eine staatliche Vermutung. Zu abstrakt, als dass man sie wirklich spüren konnte. Hundert Kilometer südlich haben sich Görlitz und Zgorzelec – ebenfalls flussgetrennte Zwillingsstädte – zu einer „Europastadt“ zusammengeschlossen. Es gibt gemeinsame Ratssitzungen, und beide Städte bewarben sich miteinander um den Titel der „Europäischen Kulturhauptstadt“. Mich amüsierte der Gedanke: Wie sähe eine Europastadt Frankfurt/Słubice wohl aus? Im Wappen trüge sie sicherlich die Einkaufstüte.
Kapitel 3
Als ich in Deutschland ankam, waren die Straßen leer. Mir fiel auf, dass es auch einige Polen gab, die mit voll gepackten Einkaufstaschen nach Słubice zurückliefen. In der Dämmerung folgte mir ein Radfahrer auf dem Bürgersteig. Auch er wollte sich wegen des Schneefalls an den Arkaden unterstellen, die sich längs der Zufahrt zur Brücke befanden. Wir standen einige Minuten nebeneinander. Und wir sprachen kein Wort. Am Oderturm, der auf deutscher Seite wie ein Zeigefinger in den Himmel ragte, kaufte ich mir in einem kleinen Einkaufszentrum Handschuhe. Die Verkäuferin schaute mich verstohlen an, als ich mit nassem Rucksack und schneematschbedeckter Mütze in ihrem Laden stand. Ihre Blicke blieben an mir hängen, voller Verwunderung, und auch ihre Kollegin schaute mich an, als sei ich ein seltenes Tier. Niemand sprach mit mir mehr, als nötig gewesen wäre. Es war das erste Mal, das ich mich wie ein Fremder in einem vertrauten Land fühlte. Ich kam und sah. Und als ich ging, hatte ich nichts weiter im Ohr als eine flüchtige Verabschiedungsformel.
So lief ich weiter zu meinem Hotel, und ich konnte auf den Straßen weiterwandern, so still war es.
Ich aß in einem Restaurant, dessen Küche im Rechteck vom Gastraum umschlossen wurde. Außer mir war nur noch ein Pärchen da. Er hatte eine Kerze anzünden lassen, seine Schultern waren breit und seine Sprache unbeholfen. Der Nachtisch kam, und er redete auf sie ein: „Meinst Du nicht, dass da etwas für uns ist? Eine Perspektive? Denk doch mal nach.“ Die Frau löffelte wortlos an ihrem Eis. Als sie aufstanden, hatten sie sich getrennt. Und weil ich mich zwischen all den leeren Stühlen einsam fühlte, ließ ich die Rechnung kommen.
Kapitel 4
Am Stadtrand von Frankfurt an der Oder warb ein Händler damit, dass es zur Eröffnung seines neuen Autohauses in Eisenhüttenstadt „Achim Mentzel, Feuerwerk und Freibier“ gebe, überlebensgroß war das Plakat. In Pillgram starrten mich die Menschen an, ohne mich zu grüßen. Und in Briesen wurde im Schaukasten der Gemeindeverwaltung ein Kabarettprogramm mit dem Titel „Auch Zwerge werfen lange Schatten“ angekündigt. Aber das meinte ich gar nicht mal, wenn ich über Brandenburg nachdachte.
Ich dachte an all den Schnee, der an diesem Tag fiel, und wie der Wind ihn so lange über die Hügel der Mark stäubte, bis er wie eine dicke Daunendecke über den Feldern und Wegen und sogar über den Straßen lag. Und ich meine die Wälder, mit windverkrüppelten Bäumen, die wie Greise am Rand der langen, geraden Waldwege stehen. Die flüchtenden Rehe. Der Mondschein. Aber vor allem: die Distanzen. Von Frankfurt an der Oder bis ins Zentrum von Fürstenwalde sind es knapp 40 Kilometer. Folgt man als Wanderer dem Jakobsweg, der hier von Polen aus entlang der Spree bis Berlin und dann weiter nach Tangermünde führt, kommt man auf der gesamten Strecke lediglich durch vier Dörfer. Dazwischen: Weiden, Felder mit Wintergetreide. Und Stille.
Ich war mir nicht sicher, ob es in Brandenburg so etwas wie „Nachbardörfer“ gab. Jeder Ort stand hier solitär, für sich genommen, die nächste Siedlung lag jeweils eine Autofahrt entfernt. Und natürlich stiftete ich Unruhe, wenn ich in diese Gemeinschaften einbrach. Genau deshalb subtrahierte ich die starrenden Blicke der Menschen von meinen Eindrücken, um zu einem realistischen Ergebnis zu kommen. Ich mochte den Leuten nicht ihr Staunen vorwerfen, so ungelenk es auch daher kommen mochte. Dafür staunte ich selbst zu gern. Über die Weite, die ich in Deutschland nicht für möglich gehalten hatte. Über lose Dörfer und kleine Fabriken, die vor sich hinbröckelten und rosteten, Geländegewinne gegen die Natur, die auf sandnarbigen Betonsockeln standen. An der Wand des Supermarktes in Briesen war noch eine alte Stadtkarte aus DDR-Zeiten zu erkennen. Rote Sterne markierten wichtige Denkmäler, der Bahnhof im Norden des Ortes schien überfantastisch groß. Von hier aus fuhren regelmäßig die Züge nach Berlin ab. So wie heute auch noch.
Ich stellte mir vor, wie dieses Dorf aus dem Sand der Mark gebuddelt wurde. Ein Mensch nimmt eine Axt und fällt einen Baum. Und dann noch einen. So lange, bis er eine Schneise in den Wald geschlagen hat. Dann baut er ein Haus. Andere Menschen machen es ihm nach. Ausgerechnet dort, wo niemand vorher wohnte. Und irgendwann wohnen so viele Menschen beisammen, dass sie eine Gemeinschaft bilden. Die Gegend von Briesen in der Mark war schon vor eintausendvierhundert Jahren von Slawen besiedelt worden. Im Nichts. Unter meinen Schuhen klebte der Schnee. Ich sah Ebene. Ich sah Bäume. Ich sah Menschen, die zusammenhalten mussten. Ein Dorf bis Fürstenwalde, zwei weitere bis zur Berliner Stadtgrenze. Und als ich Briesen verließ, hatte ich keine Ahnung, wann ich mir das nächste Mal etwas zu Essen kaufen konnte. Deshalb lief ich noch einmal zurück und stopfte meinen Rucksack voll mit Getränken und Lebensmitteln.
In den Wäldern war ich allein, meine Stiefel glitten in frischen Schnee, und nirgends waren andere Fußspuren zu sehen als meine. Standen die Bäume dicht genug am Wegesrand, vervielfältigte sich das Knirschen unter meinen Sohlen wie in einem langen Tunnel. Doch es war nicht der Klang, der mich am Denken hielt, es war der vereiste Untergrund. Jeder Schritt ein Prüfen, ob die Sohle abgleitet oder Halt findet. In den Spurrinnen, die Autoreifen bei Tauwetter in die Erde gedrückt hatten, sammelte sich das Wasser. Jetzt waren die Pfützen gefroren, und der Neuschnee kaschierte alles Eis.
Und so begann ein Duell zwischen mir und dem Wald. Ich zog das Schritttempo an, wenn ich auf „echten“ Waldwegen mit Moos- oder Grasuntergrund ging. Hier gab es keine gefrorenen Pfützen, und auch der Schnee konnte nicht zu Eisplatten zusammengedrückt werden. Ich konnte Strecke machen, fühlte mich, als ob ich auf der Überholspur unterwegs wäre. Und wenn ich mich wieder auf Schotterboden bewegte, schaltete ich zwei Gänge zurück. Mich störte die Temperatur nicht, auch die Flocken und der Wind waren mir egal. Aber das tastende Gehen machte mich müde. Es war, als ob ich auf den Winterwegen tanzen lernen würde. Ich trainierte bestimmte Schrittfolgen und Abrolltechniken, damit ich über die vereisten Wege hinweg wedeln konnte.
Noch schlimmer wurde es allerdings am Abend, als gegen sechs Uhr die Dunkelheit alle Konturen verschluckte und die Waldwege nur noch weiß waren. In der Wegmitte fand ich Halt. Nur dass sich dort über den Tag schon zehn Zentimeter Neuschnee gesammelt hatten. Also stapfte ich wie ein Waldarbeiter, es war ein mühsamer Gang, und schon nach wenigen Kilometern fühlten sich meine Schenkel zementsackschwer an.
Das Knirschen unter meinen Sohlen hörte ich irgendwann nicht mehr, es fühlte sich vielmehr so an, als wanderte ich durch weißen Pudding. Dann blieb ich kurz vor Berkenbrück stehen, ich wollte mich setzen, merkte aber, dass es weit und breit keine Bank mehr gab. Von oben leuchtete der Mond, und die Autos auf der A12 flirrten mit ihren Rücklichtern zwischen den Baumstämmen hervor. Ich überlegte mir, was wäre, wenn ich einfach hier stehen bliebe. Ich fiele wohl irgendwann um, es würde nicht lange dauern, bis ich steifgefroren war. Und sicher würden mehrere Tage vergehen, bis mich jemand fände. Also hob ich wieder die linke Sohle, und die rechte Sohle, und die linke Sohle, bis ich mich aus dem weißen Sumpf befreit hatte.
Einen Kilometer weiter wurde der Waldweg zum Teerweg. Berkenbrück war noch eine Stunde zu Fuß entfernt, aber wenigstens war ich mir jetzt sicher, dass ich es erreichen würde. Holzlaster kamen mir entgegen. Ich sah wieder Menschen, und meine Schritte wurden leichter. Gegen halb neun kam ich in Fürstenwalde an der Spree an, ich fand schnell ein nettes Hotel am Rande der Altstadt, das von einem Ehepaar mit osteuropäischem Akzent betrieben wurde. Ich sprach mit ihnen ein paar Sätze, erinnerte mich aber schon Minuten später nicht mehr daran, über was wir redeten. Mein Zimmer lag im Dachgeschoss, mehr ein Wohnzimmer als ein Hotelzimmer. Als ich auf meiner Couch lag und die Übertragung der Fußball-Europa League schaute, fiel ich in einen festen Schlaf, aus dem ich erst mitten in der Nacht wieder aufwachte. Das Licht fiel sparsam auf die Dächer von Fürstenwalde, und die Dachfenster waren vom Eis fest verschlossen.
Am nächsten Tag sah ich kaum etwas anderes als Wald. Fünfundzwanzig Kilometer zu Fuß, und nur einmal konnte ich durch die Bäume ein paar Straßenlaternen sehen. Je näher ich Berlin kam, desto einsamer wurde Brandenburg.
Ich hatte keine Angst im Wald: Aufgewachsen bin ich dort, wo es fast ebenso viele Bäume wie zwischen Frankfurt und Berlin gibt. Einige Freunde aus Kreuzberg und Charlottenburg warnten mich vor den Wölfen, die es seit einigen Jahren wieder in Brandenburg geben sollte. Andere machten sich Sorgen, dass ich Dieben begegnen könnte. Doch welcher Dieb würde wohl tagelang im verschneiten Unterholz auf seine Chance warten, um einen müden Wandersmann auszurauben, in dessen Rucksack kaum mehr steckte als ein zerbeulter Laptop, ein Haufen dreckiger Wäsche und zwei belegte Brote mit Wurst? Allein der Gedanke schien mir absurd. Soviel Aufwand für so wenig Lohn. Wenn ich ein Dieb wäre, dann würde ich nach Charlottenburg gehen. Oder nach Kreuzberg. Aber ich widersprach niemandem, der mich warnte, weil ich jeden verstehen konnte, der sich keine Vorstellung von der eisesfrischen Leere eines brandenburgischen Waldes mit seinen braunroten Kiefernstämmen machen konnte.
Der Wald fing am zweiten Tag an, mit mir zu sprechen. Ich konnte das Rascheln im Laub und das Maunzen im Geäst einordnen. Ich fühlte mich sogar wohl dabei, von so viel unsichtbarem Leben umgeben zu sein. Und doch blieb ein gewisser Respekt vor den brandenburgischen Wäldern, was mit ihrer schieren Dimension zu tun hatte: Einen ganzen Tag kann man hier laufend verbringen, ohne einen Menschen zu sehen. Einen Tag auf Eis und Schnee, bei Minustemperaturen, ohne Handyempfang. Ich hatte einen kleinen Satellitenempfänger dabei, der mir im Notfall den Weg durch den Wald weisen sollte. Aber auch der funktionierte zwischen Fürstenwalde und Erkner nicht.
Und immer wieder pflügten meine Sohlen durch den Schnee, um das Eis zu vermeiden. Ich rannte Berlin entgegen. Ich konnte Berlin spüren.
Kapitel 5
Erkner war wie ein Flicken, der auf der Südostseite von Berlin klebte und das Leben am Auslaufen hinderte. Was ich noch an Ruhe, Bäumen und Eis im Gedächtnis hatte, war nichts weiter als ein Gefühl von gestern, denn schon vor meinem Hotel waren Straßen und Autos und Jogger. Ich bewegte mich unter Menschen, die sich bewegen mussten, warum auch immer. Die Stadt grenzte direkt an die Metropole und trennte Erde von Teer und die Landluft vom Berlingeruch. Im Kreisverkehr am S-Bahnhof wurde ich fast von einem LKW überfahren, der mich einfach übersah. Der Fahrer bremste hektisch, und sein Führerhaus wackelte noch zwei, dreimal unter dem Ruck. Alles, was zwischen Provinz und Stadt stand, war in Sekundenbruchteilen auf die Straße gestemmt. Das Zischen des Lufttanks. Die Augen hinter dem Lenkrad, die nach der ersten Schrecksekunde genervt auf den Fußgänger mit dem großen Rucksack hinabblickten. Es war, als hätte sich in diesem Moment der Rhythmus geändert, der meinen Weg bestimmte. Von allen Seiten drangen nun Geräusche an mich heran, die mich zum Zuhören zwangen.
Und schon einige Fahrtwindstöße weiter war ich in Berlin. Noch nie war ich zu Fuß in die Stadt gekommen, und was ich sonst an Gewohnheiten pflegte, war nun schon längst egal. Busse fuhren an mir vorbei und ich hörte immer wieder die S-Bahn aus der Ferne rattern – ohne dass ich auf die Idee kam, einzusteigen. Auf Facebook schimpften meine Freunde über den Neuschnee. Doch bei minus vier Grad spürte ich viel eher den schneidenden Ostwind in meinem Gesicht. Betrat ich ein beheiztes Gebäude, brannte meine Haut, ganz so, als verstünde mein Körper nicht, dass er in Sicherheit war vor den Böen. Dieser Februar war echt, so wie der Schnee auf meiner Mütze und das Eis unter meinen Füßen. Es war ein Februar ohne alles.
Ich lief auf einer langen, geraden Straße in den Bezirk Köpenick hinein, und wären die heulenden Motoren rechts meines Radweges nicht gewesen, und die Zäune, ich hätte wahrscheinlich nur das Grün der Bäume wahrgenommen. Die Stadt befreite sich nur langsam von Brandenburg. Später kam ich an den geduckten Bungalowbauten von Rahnsdorf vorbei, deren Dächer noch den ländlichen Respekt vor der dritten Etage zu haben schienen. Einmal stoppte ich kurz an einem Ort namens „Hessenwinkel“ und dachte mich ein paar Hundert Kilometer in die Zukunft, in meine alte Heimat. Doch ich sah weder Fachwerk noch Hügel, und gab mich wieder der Stadt hin, die sich langsam aus dem märkischen Sand emporpuzzelte.
Um den Müggelsee herum führte eine große, lange Straße, auf der langsam der Verkehr anschwoll. Die Strandbäder waren leer, die Fenster der Verkaufsbuden vernagelt. Zum ersten Mal traf ich hier zwei andere Wanderer, die plötzlich vor mir standen, als hätte ich sie treffen sollen. Sie trugen ebenfalls dicke Rucksäcke auf dem Rücken, doch wir waren so erstaunt, dass uns nur ein kurzer Gruß über die Lippen ging. Im Sommer war ich oft hier gewesen, mit dem Fahrrad war ich von Friedrichshain hier her gefahren. Doch nun musste ich weiter gehen, weiter in den großen Bauch der großen Stadt, die in meinen Gedanken nun einfach nur beginnen sollte, aber einfach nicht begann, weil sie größer war, als ich das jemals in den Bahnen, Bussen oder auf dem Fahrrad realisiert hätte.
Köpenick fing am Westufer des Sees zu brummen an. Ich war noch weit vom Lonely-Planet-Berlin entfernt, Touristen gab es hier im Winter nur selten, und die Stadt, über die alle sprachen, war noch einen halben Tagesmarsch entfernt. Kinder spielten am Ufer des Sees, die Schulranzen auf dem Rücken. Keine Spielplätze, an denen Mütter oder Väter warten würden und miteinander Erziehungstipps austauschten. Manche Häuser standen hier leer, eine Villa am See war nur mit einem Fahrradschloss gesichert. Die Sonne ging über dem zugefrorenen Wasser unter und zog orangefarbene Schlieren über das Eis.
In Friedrichshagen bekam ich schließlich Hunger und kehrte in einen Gasthof ein, der an der Müggelspree lag. Es war das Vereinsheim eines Ruderclubs, gleich am Eingang hing ein schwarzes Brett, auf dem ein Antrag diskutiert und der Tod eines langjährigen Mitglieds betrauert wurde. Der Wirt stand mir einige Sekunden sprachlos gegenüber, und ich fragte, ob ich mich setzen dürfe. Ich war der einzige Gast, und eigentlich mochte ich diesen Ort mit all den Ruderpokalen und Erinnerungsfotos, weil es mir so schien, als erzählte der Saal Geschichten: Vor allem die von früheren Helden und Rennsiegen, aber ich kam mir nie allein vor, so wortgewaltig waren die Wände um mich herum. Doch auch meine Frage, ob ich mein Handy zum Laden an eine Steckdose anschließen könnte, entlockte dem Menschen, der mir gegenüberstand, nur höfliche Schweigsamkeit. Mir wurde klar, dass mein Rucksack einem Gespräch im Weg stand, und so ließ ich die Karte kommen, um zu zeigen, dass ich auch als Fremder ein guter Kunde sein würde.
Seine Frau sah mich von der Küche aus an, und als ich einen Hirschbraten bestelle, fiel der Blick ein zweites Mal auf mich. Fast wurde sie panisch, als ich vorm Essen noch einmal an ihrer Küche vorbei zum Waschbecken ging. Ich lächelte und versuchte sie anzusprechen, bekam aber keine Antwort. Sie hielt kurz beim Klößemachen inne und fürchtete wohl, dass ich nun gehen wolle. Erst als ich die Rechnung zahlte, klarte ihr Gesicht auf.
Ich machte einen Bogen um den alten Stadtkern von Köpenick. Entlang der Wuhlheide fühlte ich mich eine Stunde lang einsam, weil kein Fußgänger meinen Weg kreuzte. Der Verkehr floss mit der Zwangsläufigkeit einer Modelleisenbahnanlage, und ich wartete nur dann, wenn mein Signal auf Rot stand. In Oberschöneweide sah ich die ersten Studentenkneipen, doch all das Vertraute verlor sich schon einige Hundert Meter weiter zwischen Fabriken und Nutzwertbrücken, zwischen denen ich wie auf geteerten Großstadtkanälen Richtung Neukölln lief. Hinter dem städtischen Krematorium tauchte dann wie ein Wunder die Sonnenallee auf. Von nun an war ich im Neubürgerberlin, und die Stadt spuckte mich erst wieder aus, als ich sie am westlichen Rand wieder verließ.
Kapitel 6
Der Abend. Wie im Traum.
Eine Bar in Neukölln. An der Wand hinter dem Tresen klebte eine grüne Retro-Tapete, die erst mit der Renovierung dort angebracht worden war. Die Mauern ringsum waren mit Spachteln abgeschabt, damit sie unfertig aussahen. So wie Berlin aussehen soll. Provisorisch, angedacht, nicht ausgeführt. All das ist in aller Perfektion inszeniert. Ein feines Geschäftsmodell.
Das Licht war gedimmt. Ich saß auf einer schweren Holzbank. Und neben mir versuchte ein junger Mann mit dicker Hornbrille zwei Frauen mit Floskeln über das Bierbrauen zu beeindrucken. Er redete über Dunkel- und Altbiere und verwechselte dabei ständig untergärige und obergärige Hefesorten. Dann dozierte er über die Brauweise von amerikanischem Root Beer, über den Alkoholgehalt. Bevor ich „Kräuterlimonade“ sagen konnte, trank ich aus und ging.
Ins Hotel.
Sieh Dir die Terracotta-Vase an, in der das vertrocknete Schilf steht. Klopf auf die braune Furnierfläche Deines Schreibtisches, die so schön dunkelbraun farbveredelt wurde, erdfarben, und Du wirst merken, es ist nichts weiter als Pressholz in neuer Folie. Schau Dir das billige Telefon an, das mit dem Wegwerfhörer. Und die Sprinkleranlage, die auf Dich herabglotzt. Das Waschbecken ist stabil und marmoriert, aber sobald Dir der Rasierer runterfällt, siehst Du von unten, dass alles nur aus Kunststoff ist. Pressschaum. Die violetten Blumen in der Vase sind aus Nylon und Du fragst Dich, ob sie jeden Morgen abgestaubt werden.
Ich dachte an all den goldenen Zierkrempel aus den neunziger Jahren, der hier mal gewesen sein muss, alles weggeschmissen, nur die goldenen Türklinken waren übrig geblieben.