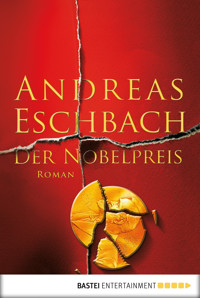5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein kubanischer Wissenschaftler hat zugegeben, vor 16 Jahren zusammen mit einem deutschen Mediziner einen Menschen geklont zu haben. Nun sucht alle Welt nach dem Klon. Und der Vater des 16jährigen Wolfgang kannte den Kubaner. Als eine große Boulevardzeitung mit Wolfgangs Foto und der Schlagzeile "Ist er der deutsche Klon?" auf der Titelseite erscheint, bricht die Hölle los …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Der Autor
Andreas Eschbach,geboren in Ulm, studierte in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik und wurde vor allem durch den Thriller »Das Jesus-Video« (1998) bekannt, der auch verfilmt wurde. Mit »Eine Billion Dollar«, »Der Nobelpreis«, »Ausgebrannt« und zuletzt »Ein König für Deutschland« stieg Eschbach endgültig in die Riege der deutschen Top-Thrillerautoren auf. Seine Bücher für junge Leser erscheinen im Arena Verlag. Andreas Eschbach lebt als freier Schriftsteller mit seiner Familie in der Bretagne.www.andreaseschbach.de
Titel
Andreas Eschbach
Perfect Copy
Die zweite Schöpfung
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2012 © 2002 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen Umschlaggestaltung: Frauke Schneider Umschlagtypografie: knaus. büro für konzeptionelle und visuelle identitäten, Würzburg ISBN 978-3-401-80168-1www.arena-verlag.de Mitreden unter forum.arena-verlag.de
Kapitel 1
»Was den heutigen Abend anbelangt«, sagte Wolfgangs Vater, »gibt es noch etwas, das du wissen solltest.« Er kramte in einer Schublade. »Julia?«, rief er dann nach hinten, »wo sind meine Manschettenknöpfe?«
Aus Richtung des Badezimmers war eine undeutliche Antwort zu hören.
»Was denn?«, fragte Wolfgang. Das Jackett gebürstet, die Schuhe blitzblank gewienert, die Haare frisiert stand er seit mindestens einer halben Stunde abmarschbereit, wippte auf den Zehen und wäre am liebsten längst unterwegs gewesen.
»Julia?«, rief Dr. Richard Wedeberg, Chefarzt am örtlichen Krankenhaus und von Kollegen hinter seinem Rücken »Beethoven« genannt wegen seiner wallenden grauen Haare. »Ich suche meine Manschettenknöpfe. Die mit der Perlmuttauflage.«
Eine Tür öffnete sich, ein Duft nach Lavendel wehte heran. »Sie sind entweder in der Garderobenschublade«, rief Wolfgangs Mutter entnervt, »oder…«
»Da sind sie nicht.«
»Dann würde ich in deinem Arbeitszimmer nachsehen.«
»Wie sollen meine Manschettenknöpfe denn in mein… ?«
»Schau einfach nach.« Die Tür schlug zu.
Wolfgang verfolgte, wie sein Vater mit missbilligendem Gesichtsausdruck davonrauschte und mit seinen Manschettenknöpfen zurückkam. »Na also«, sagte er zufrieden. »Sie waren in meinem Arbeitszimmer.« Er stellte sich vor den großen Ankleidespiegel und nestelte an seinen Hemdsärmeln. »Also, was das Konzert heute Abend anbelangt, solltest du wissen, dass der Solo-Cellist, Hiruyoki… Julia!«, rief er erneut, »ich finde meine Fliege nicht! Die dunkelrote seidene.«
Wieder die Badtür. Wieder ein Schwall Lavendel. »Du hast sie wahrscheinlich in der Tasche.«
»Ah, ja. Richtig. Hab sie!«
Wolfgang verdrehte die Augen. Wenn das so weiterging, würden sie zu spät kommen. Es brauchte bloß einen Stau zu geben auf der Autobahn, und sie würden ankommen, wenn das Konzert gerade vorbei war.
»Hiruyoki Matsumoto«, vervollständigte er den Namen, als sein Vater keine Anstalten dazu machte.
»Er ist erst siebzehn, musst du wissen«, sagte der, völlig darauf konzentriert, seine Fliege zu binden. »Ein Wunderkind, schreibt die Presse. Na ja, was die eben so schreiben. Jedenfalls entstammt er einer alten, hoch angesehenen japanischen Familie, die weitläufig mit dem Kaiserhaus verwandt sein soll. Vor sieben Monaten ist er zum ersten Mal öffentlich in Erscheinung getreten, und nun macht er schon eine Welttournee.«
»Oha«, machte Wolfgang ahnungsvoll. Er spielte nämlich auch Cello, und das seit frühester Kindheit. Sein Lehrer bescheinigte ihm großes Talent. Eine Karriere als Konzertmusiker galt als ausgemachte Sache.
»Du weißt, ich halte nichts davon, Kindern ihre Kindheit zu rauben, nur um eines Effektes willen. Eine künstlerische Laufbahn ist etwas fürs ganze Leben, gerade in der Musik. Das geht nicht ohne solide Ausbildung«, fuhr sein Vater fort. Er wandte sich seinem Sohn zu und lächelte mit funkelnden Augen. »Aber du bist auch bald so weit. Du wirst auch bald an die Öffentlichkeit gehen können. Und sie werden dich genauso feiern wie jetzt den jungen Japaner.«
Wolfgang hatte plötzlich einen trockenen Mund. »Meinst du?«
»Ich habe nicht den geringsten Zweifel«, erklärte sein Vater. »Heute Abend wirst du einen Blick in deine Zukunft werfen.«
Er ahnte nicht, wie Recht er damit haben sollte.
Und wie sehr er sich zugleich irrte.
Am anderen Ende der Stadt trafen sich an diesem Abend zwei Männer in einer dunklen Kneipe, in der es nach altem Frittierfett roch und jeder sich um seinen eigenen Kram kümmerte, sobald das Bier auf dem Tisch stand.
Der eine Mann war schlank, beinahe mager, hatte eine scharf geschnittene Nase, einen wolligen Vollbart und mehr Falten um die Augen, als seinem Alter – er war kaum über dreißig – angemessen gewesen wären. Er schob einen Zettel, auf dem ein paar gekritzelte Zeilen standen, über den Tisch. »Der Junge heißt Wolfgang Wedeberg«, sagte er. »Das ist die Adresse, die Schule, in die er geht, und so weiter.«
Der andere Mann war untersetzt und hatte ein leicht aufgedunsenes Dutzendgesicht. Er nahm den Zettel an sich und überflog, was darauf stand. »Nur beobachten?«, fragte er.
»Nur beobachten. Und Fotos. Er darf Sie nicht bemerken.«
Der andere faltete den Zettel zusammen und schob ihn in die Brusttasche seines grauen Kaufhaushemdes. »Davon lebe ich«, sagte er und langte nach seinem Bierglas. »Dass man mich nicht bemerkt.«
Das Konzert fand in einem richtigen, prächtig anzuschauenden Schloss statt. Sie schritten über weiche rote Teppiche, breite Treppen mit geschwungenen Marmorgeländern empor, durch große, hell erleuchtete Räume voller Stuck und Blattgold und festlich gekleideter Menschen. Junge Frauen in Dienstmädchentracht waren hinter langen, weiß gedeckten Tischen damit beschäftigt, Sektkelche eng an eng aufzustellen, und über das vielstimmige Gemurmel hinweg hörte man das Orchester stimmen, ein viel versprechendes disharmonisches Quietschen und Kratzen.
Wolfgang sah von Zeit zu Zeit verstohlen zu seiner Mutter hin. An diesem Abend wirkte sie gelöst wie selten sonst, beinahe fröhlich. Und sie war schön, fand er, in dem dunklen Abendkleid mit ihrem langen, glänzend schwarzen Haar und der schlichten Perlenkette um den Hals. Mutter war einmal Konzertsängerin gewesen, hatte Musik studiert und ein Engagement an einem kleinen Haus in Berlin gehabt, als sie Vater kennen lernte und auch noch einige Zeit danach. Obwohl sie es bestritt, vermutete Wolfgang, dass sie es bisweilen bedauerte, das alles aufgegeben zu haben, als er schließlich auf die Welt gekommen war.
Vater sah Ehrfurcht gebietend aus in seinem Smoking, nicht wie ein Zuhörer, sondern beinahe wie der Dirigent persönlich. Er schaute voll grimmiger Erwartung drein, grüßte hin und wieder einen Bekannten mit ungeduldiger Beiläufigkeit und sagte, als der zweite Gong ertönte: »Es geht los. Lasst uns unsere Plätze suchen.«
Würdige Männer in Roben beobachteten aus klobigen Bilderrahmen heraus, wie die Konzertbesucher sich durch lange Reihen gepolsterter Stühle drängelten, endlich nach und nach zum Sitzen kamen und wie, nach dem dritten Gong, die Gespräche verstummten.
Ein Sprecher des Veranstalters begrüßte das Publikum, stellte den Dirigenten vor, wartete den höflichen Applaus ab, um endlich den Solo-Cellisten anzukündigen mit den Worten: »Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren – der neue Stern am Himmel der Musik… der junge Mann, den viele schon als den Pablo Casals des einundzwanzigsten Jahrhunderts bezeichnen… begrüßen Sie mit mir, aus dem Land der aufgehenden Sonne, Hiruyoki Matsumoto!«
Applaus brandete auf wie eine Sturmflut. Auch Vater klatschte und nickte Wolfgang dabei verschwörerisch zu. Wolfgang klatschte nicht; er saß nur da und beobachtete den schmalen Jungen, der mit einem fast honigfarbenen Cello in der Hand die Bühne betrat und sich, unter mehrfachem tiefem Verbeugen, auf die Mitte zubewegte, zu seinem Platz zur Linken des Dirigentenpults.
Wolfgang wurde heiß unter seinem Jackett. Die Vorstellung, dass er selbst einmal… und womöglich bald… ! Atemberaubend. Und der Applaus wollte kein Ende nehmen. Auf eine verrückte Weise kam es ihm so vor, als gelte der Beifall bereits ihm, und er hatte das Gefühl, rot zu werden. Du meine Güte!
Der Dirigent hob den Taktstock, um zu zeigen, dass es der Vorschusslorbeeren nun genug waren. »Schau gut hin«, raunte Vater, der unter den Letzten war, die noch klatschten.
Gespannte Stille breitete sich aus. Das Vorspiel begann, zart hingehauchte Töne, eine Andeutung der Motive, die kommen sollten.
Hiruyoki setzte den Bogen an, höchste Konzentration im Blick, wartete auf seinen Einsatz.
Dann spielte der junge Japaner den ersten Ton. Und der traf Wolfgang wie ein elektrischer Schlag.
Später an diesem Abend kehrte der Mann mit dem Vollbart in sein Hotelzimmer zurück, zog seine Jacke aus und hängte sie, nachdem er daran gerochen und angewidert das Gesicht verzogen hatte, über einen Kleiderbügel und diesen in das offene Fenster. Dann ließ er sich aufs Bett fallen, holte den Zettel aus der Tasche, den der Portier ihm überreicht hatte – jemand hatte seine Nummer hinterlassen –, nahm das Telefon vom Nachttisch und wählte. Als es in der Leitung tutete, legte er sich zurück und starrte an die Decke.
Am anderen Ende wurde abgehoben. Jemand bellte: »Ja?«
»Conti«, sagte der Mann auf dem Bett.
»Tommaso!« Es klang wie eine Mischung aus Schrei und Seufzer. »Schalten Sie Ihr Handy eigentlich ab und zu ein? Ich versuche den ganzen Abend, Sie zu erreichen.«
Der Mann mit dem Vollbart studierte das Muster der hellgelben Flecken an der Decke. »Nun, jetzt haben Sie mich erreicht.« Trotz seines fremdländischen Namens sprach er akzentfrei Deutsch.
Ein Keuchen im Telefonhörer. »Verdammt noch mal, Tommaso, Sie tun so, als hätten wir alle Zeit der Welt! Können Sie sich überhaupt vorstellen, was hier los ist? Wie mir die Redakteure im Nacken sitzen? Andere Zeitungen sind auch hinter dieser Story her, das ist Ihnen doch hoffentlich klar?«
»Sicher«, sagte der Mann auf dem Bett und streifte gemächlich die Schuhe ab. »Aber andere Zeitungen wissen nichts von Wedeberg.«
»Und das müssen wir nutzen!«, heulte es aus der Leitung. »Wir müssen raus mit dieser Meldung. Die Titelseite, Tommaso, Sie kriegen die Titelseite – bloß schicken Sie mir endlich etwas, womit ich sie füllen kann!«
»Ich muss mir meiner Sache erst hundertprozentig sicher sein.«
»Grundgütiger… ! Ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist. Sonst war es immer die reine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, aber diesmal stellen Sie sich ausgesprochen… ich sag’s lieber nicht. Aus dem hinterletzten afghanischen Kuhdorf habe ich mehr von Ihnen gehört als jetzt aus dem Schwarzwald. Tommaso, was ist los mit Ihnen?«
Der Mann mit dem Vollbart holte tief Atem. »Ich tue nur meinen Job. Sie sind nervöser als sonst, das ist alles.«
»Nervös? Na klar bin ich nervös, verdammt noch mal. Ein Chefredakteur muss nervös sein und auf hundertachtzig, sonst taugt er nichts. Glauben Sie, ich kann ruhig schlafen? Nach all den Vorarbeiten, dem ganzen Geld, das wir ausgegeben haben? Wenn jemand anders auf die gleiche Spur kommt und die Sache woanders zuerst erscheint, bin ich die längste Zeit Chefredakteur gewesen. Dann kriege ich höchstens noch einen Job bei der Müllabfuhr.«
»Niemand anders wird auf die gleiche Spur kommen. Das, was ich weiß, kann niemand sonst wissen.«
»Das sagen Sie jedes Mal.«
»Wenn Sie damit rausgehen – wären Sie sich dann nicht lieber sicher, dass alles stimmt, was Sie schreiben?«
Wieder das Keuchen, und eine Pause. Im Hintergrund hörte man Stimmengemurmel und das Klackern von Tastaturen. »Ich brauche Bilder. Wenigstens ein Bild, Tommaso, bitte! Nur damit ich in der Konferenz was vorzeigen kann. Und schreiben Sie endlich etwas, sonst tue ich es selber.«
Der Mann mit dem wolligen Vollbart seufzte. »Gut. Wenn Sie mir versprechen, dass noch nichts erscheint, schicke ich Ihnen, was ich bis jetzt habe.«
»Versprochen. Sind Bilder dabei?«
»Bekomme ich übermorgen.«
Damit war der Mann am anderen Ende nicht glücklich, das war deutlich zu hören. Aber er sagte: »Also. Schicken Sie, was Sie haben.«
Nachdem er den Hörer aufgelegt hatte, stemmte der Mann sich hoch und schleppte sich auf den Stuhl vor dem mit Hotelprospekten überladenen Schreibtisch, auf dem sein Laptop stand. Aber er schrieb nichts, sondern starrte minutenlang nur die weiße Wand an.
Schließlich legte er die Hände auf die Wangen, massierte seine Nasenflügel und murmelte vor sich hin: »Porco dio! Was habe ich da nur angerichtet?«
Wolfgang starb tausend Tode während dieses Konzerts. Schweiß rann in Bächen unter seinem Hemd, aber er wäre nicht im Mindesten überrascht gewesen, wenn sich herausgestellt hätte, dass es nicht sein Schweiß war, sondern sein Blut. Unfassbar, wie gut der Japaner spielte. Unfassbar auch, dass Vater im Ernst zu glauben schien, er, Wolfgang Wedeberg, würde jemals im Stande sein, auch nur annähernd so gut zu spielen. Und er glaubte es tatsächlich. Immer wieder, meistens nach einer atemberaubenden Kadenz, sah er herüber mit einem Blick, als wolle er sagen: Demnächst du!
Nie im Leben. Nie im Leben würde er so spielen. Die Finger Hiruyokis tanzten förmlich über die Saiten. Sein Bogen schien lebendig zu sein. Und natürlich spielte er auswendig, alles ohne Noten! Wolfgang sah ihm zu mit dem Gefühl, ein Omnibus zu sein, von dem man erwartete, im nächsten Formel-I-Rennen mitzufahren – und zu siegen.
Er versank in seinem Sessel und wünschte sich, im Erdboden zu versinken. Alles ringsumher verschwamm hinter dunklen Nebeln, es gab nur noch ihn und den jungen Solo-Cellisten oben auf der Bühne, und diese so mühelos wirkenden, so unglaublich gekonnten Töne, die er seinem ungewöhnlich hell lackierten Instrument entlockte. Verrückte Phantasien zuckten durch seinen Kopf, wie die, nach dem Konzert würden die Leute auf ihn zeigen und ihn auslachen, oder ihn auffordern, auf die Bühne zu gehen und zu spielen, nachzumachen, was Hiruyoki vorgemacht hatte, und er würde mit hochrotem Kopf gehorchen und sich unsterblich blamieren… Hörte überhaupt jemand zu? Es kam ihm vor, als beobachte ihn jeder im Saal heimlich und amüsiere sich über die Vermessenheit, es einem solchen Virtuosen gleichtun zu wollen.
Es sah alles so… leicht aus! Wolfgang sah dem Japaner fassungslos zu. Er war konzentriert, gewiss, aber die Finger seiner Griffhand bewegten sich selbst bei schnellen Passagen so sicher, dass man den Eindruck hatte, er hätte das Stück locker doppelt so schnell spielen können und trotzdem fehlerfrei. Fehler? Hiruyoki Matsumoto schien überhaupt nicht zu wissen, was das war.
Irgendwann im Lauf des Abends – die Erde hatte ihn immer noch nicht verschluckt, der Schweiß tropfte aus seinem Hemd, aber immerhin noch nicht aus dem Stuhl, auf dem er saß, und noch niemand hatte mit dem Finger auf ihn gezeigt und laut aufgelacht – sagte Wolfgang sich, dass heute Abend zumindest eine Frage beantwortet worden war, die er seit langem mit sich herumgetragen hatte: die Frage nach dem wahren Maß seines Talents.
Er war bis zu einem gewissen Grad talentiert, zweifellos. Ein einziges Vorspiel vor der Musiklehrerin in der fünften Klasse hatte ausgereicht, ihn auf die Eins in Musik zu abonnieren, fast unabhängig von seinen sonstigen Leistungen im Unterricht. Er beherrschte viele Stücke der klassischen Cello-Literatur und hätte in einem Streichquartett mitspielen können, ohne sich zu blamieren.
Aber von der Meisterschaft und Leichtigkeit, die er da oben auf der Bühne sah, trennte ihn mehr als nur Übung. Zwischen ihm und Hiruyoki klaffte ein unüberbrückbarer Abgrund.
Er war froh, als es endlich vorbei war. Er klatschte, wie alle anderen auch, und hatte dabei das Gefühl, zwei nasse Säcke gegeneinander zu schlagen. Beim Hinausgehen bewegte er sich steif wie ein Stock, weil ihm das Hemd auf der Haut klebte. Als sie hinaustraten in den Abend, eine frische Mainacht, fröstelte ihn.
»Das war wunderbar, nicht wahr?«, meinte Vater mit unerträglich guter Laune. Und Mutter pflichtete ihm bei! Wolfgang schwieg und verfluchte jeden Meter Weges bis zum Parkplatz.
»Und?«, sagte Vater, als sie den Wagen erreicht hatten, und sah ihn an. »Habe ich zu viel versprochen?«
Wolfgang war zum Umfallen elend. »Nein«, stieß er hervor und schlang die Arme um sich.
»Eines Tages«, prophezeite Vater, den Autoschlüssel in der Hand, »werden wir hierher zurückkommen, und es wird genauso sein wie heute. Nur mit dem Unterschied, dass auf den Plakaten dort drüben der Name Wolfgang Wedeberg stehen wird.«
Nie im Leben, dachte Wolfgang, aber er brachte es nicht fertig, das zu sagen. Stattdessen bat er: »Können wir einsteigen? Mir ist kalt.«
Kapitel 2
Das Gymnasium von Schirntal war ein klotziger Altbau mit hohen, in gelbem Sandstein eingefassten Fenstern. In der sechsten Klasse pflegte der Erdkundelehrer die Fenster zu öffnen und zu fragen: »Aus welchem Gestein bestehen die Hochlagen des Schwarzwalds? Aus Buntsandstein, Leute.« Dann klopfte er gegen die Umfassung und wiederholte: »Buntsandstein. Das hier, Leute. Gibt es, wie der Name sagt, in verschiedenen Farben, und das hier ist, wie man unschwer sieht, der gelbe.« Aus demselben gelben Buntsandstein war der hohe Portalbogen über dem Haupteingang gemeißelt, in dem groß »OBERSCHULE« eingraviert stand. Die blecherne Laterne, die daneben hing, stammte zweifellos auch noch aus Zeiten, als man »Oberschule« gesagt hatte statt »Gymnasium«.
Morgens herrschte auf dem Platz vor der Schule großer Auftrieb. Eigentlich war es kein Vorplatz, sondern die Zufahrt zum Lehrerparkplatz hinter dem Haus, aber von kurz nach sieben an hielten die Schulbusse aus den umliegenden Gemeinden und spuckten Massen von Schülern aus, die anschließend in dichten Trauben auf dem vielfach geflickten Kopfsteinpflaster herumstanden und die Autos der Lehrer eher widerwillig passieren ließen. Nur die, die noch Hausaufgaben abzuschreiben hatten, begaben sich früher als unbedingt erforderlich in die Klassenzimmer.
Wolfgang kam an diesem Morgen verstimmt an. Und als Erstes von Cem begrüßt zu werden, seinem mit einer unverwüstlichen, geradezu waffenscheinpflichtigen guten Laune gesegneten Sitznachbarn und besten Freund, machte es nicht besser. »Mann, machst du ein Gesicht«, meinte der mit herausforderndem Grinsen. »Dabei haben wir in zwei Wochen Ferien, und außerdem: Lass dir nichts anmerken, aber jetzt, in diesemAugenblick, sieht sie zu dir herüber, ich schwöre es!«
»Was? Ehrlich?« Wolfgang drehte den Kopf, bis er sie entdeckt hatte. Svenja. Sie stand mit ein paar anderen Mädchen aus der Parallelklasse zusammen und sah natürlich nicht zu ihm herüber.
»Na jetzt natürlich nicht mehr«, brummte Cem. »So wie du dich anstellst.«
In der ersten Stunde hatten sie Biologie. Es herrschte immer noch, wie sich Cem ausdrückte, »Klonomanie«. Zwei Wochen zuvor nämlich hatte ein kubanischer Mediziner namens Frascuelo Aznar die Weltöffentlichkeit mit der Erklärung schockiert, vor sechzehn Jahren einen Menschen geklont zu haben, und zwar auf Initiative und in Zusammenarbeit mit einem deutschen Wissenschaftler, der gut bezahlt und keinen Namen genannt hatte. Seither kannten die Medien kein anderes Thema mehr als: Wer ist der Klon? Dass Aznar vor einigen Jahren bei einem schweren Laborunfall erblindet und demzufolge außer Stande war, seinen damaligen Partner auf Kongressfotos oder dergleichen zu identifizieren, machte die Sache nur noch spannender.
Die Lehrerschaft des Gymnasiums Schirnberg jedenfalls war komplett dem Klon-Fieber verfallen. Jeder Lehrer bemühte sich, den offiziellen Lehrplan ignorierend, in seinem Unterricht irgendetwas zu behandeln, das zumindest entfernt mit dieser Affäre zu tun hatte. »Klonomanie« eben.
Naturgemäß fiel das im Biologieunterricht am leichtesten. Das weite Feld der Zellteilung und Fortpflanzung bot überreichlich Gelegenheit zu Wiederholung und Vertiefung. Aber am Montagmorgen den Biosaal zu verdunkeln und endlos Dias von sich teilenden Zellen zu zeigen war schon heftig vom »Kittel«, wie Dr. Kistner wegen des stets um seine hagere Gestalt schlotternden weißen Laborkittels genannt wurde.
»Du musst mal mit ihr reden«, meinte Cem, während der Kittel salbadernd mit dem Zeigestock über die Leinwand kratzte. »Sonst wird das nie was.«
Wolfgang stierte düster auf das projizierte Bild, das eine von Samenzellen umlagerte Eizelle zeigte. »Das wird sowieso nie was. Schließlich hat sie schon ’nen Freund.«
»Marco? Pah. Nur eine Frage der Zeit, bis sie von dem die Nase voll hat.«
In diesem Moment durchschnitt die Lehrerstimme das allgemeine Gebrabbel. »Bardakci?«
Cem fuhr hoch. »Ja?«
Der Kittel musterte ihn mit spöttischem Funkeln in den Augen. »Gut geschlafen?«
»Ähm, nein, überhaupt nicht. Ich… wenn Sie die Frage noch mal wiederholen könnten… ?«
»Ach, das würde die anderen doch nur langweilen. Wer weiß es? Steinmann?« Der Kittel redete Schüler grundsätzlich mit Nachnamen an.
Marco spreizte den breiten Brustkorb. »Mitose ist die normale Zellteilung. Meiose dagegen ist die Reduktionsteilung, bei der Zellen mit einem haploiden Satz von Chromosomen entstehen, die man Gameten nennt oder auch Keimzellen.« Es klang gut auswendig gelernt.
»Gut, Steinmann«, sagte der Kittel und klopfte mit den Stock in seine Handfläche. »Ich hoffe, es ist sich jeder darüber im Klaren, dass das im Test drankommt. Du auch, Bardakci.«
Cem murmelte etwas auf Türkisch, das man vermutlich in keinem Wörterbuch gefunden hätte.
Rasselnd kam das nächste Dia. Es zeigte wieder eine Zelle, die für Wolfgangs Augen nicht anders aussah als das Dutzend Zellen davor. Er warf einen Blick zu Marco hinüber, der zufrieden vor sich hin grinste. Marco Steinmann war der Älteste in der Klasse und nicht nur groß und stark, er sah auch schon richtig männlich aus und war zu allem Überfluss verdammt gut in der Schule. »Weißt du«, raunte er Cem zu, »ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, was sie mit jemandem wie mir anfängt. Wenn man’s genau nimmt, bin ich doch eher ein seltsamer Typ.«
Cem hob die Augenbrauen. »Da will ich dir nicht widersprechen.«
In der anschließenden Doppelstunde Englisch lasen sie sich mühsam weiter durch Ernest Hemingways The Old Man And The Sea aus keinem anderen Grund als dem, dass es von einem armen kubanischen Fischer handelte und Hemingway es während seiner Zeit auf Kuba geschrieben hatte. Die Geschichtslehrerin schließlich ließ unter allgemeinem Stöhnen noch einmal das Video laufen, das vor zwei Wochen erstmals in den Tagesthemen ausgestrahlt worden war und den ganzen Rummel ausgelöst hatte und das sie mittlerweile zum Erbrechen oft gesehen hatten. Es zeigte einen dürren Mann mit Sonnenbrille, der in einem Rollstuhl vor einer sonnendurchgluteten, weitläufigen alten Hafenanlage saß und mit krächzender Stimme seine Geschichte zum Besten gab.
»Stoppen wir einmal hier«, sagte Frau Pohl und drückte die Pausentaste, sodass ein zitterndes Bild auf dem Schirm verharrte. »Konzentrieren wir uns auf die Szenerie im Hintergrund.« Sie deutete auf ein massiv aussehendes, schwarz-weiß geschecktes Gemäuer, über dem sich ein Leuchtturm erhob. »Das ist das Castillo delMorro, das größte und beeindruckendste Festungsbauwerk am Hafen von Havanna. Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert war dies der am stärksten befestigte Hafen von ganz Lateinamerika, denn seine bevorzugte Lage an der karibischen See machte die Hauptstadt von Kuba, das damals noch zu Spanien gehörte…«
»Gnade!«, murmelte Cem. »Kann nicht endlich was Neues passieren? Nichts gegen das englische Königshaus, aber falls sich einer von denen den Hals brechen will, wäre jetzt der ideale Zeitpunkt.«
Wolfgang hörte kaum hin. Er grübelte über den vergangenen Abend nach. Hiruyoki hatte ihn geschockt, klar, aber was hatte das zu bedeuten? Womöglich einfach, dass er das Üben in letzter Zeit nicht mehr ernst genug genommen hatte. Wenn man ständig gesagt bekam, wunder wie begabt man sei, neigte man eben dazu, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Vielleicht war Hiruyokis ganzes Geheimnis, dass er fünfmal so lange und so hart übte? Biss hatte er jedenfalls, das war in jeder Note zu spüren gewesen.
Und Üben konnte Wunder bewirken, das hatte Wolfgang oft genug selbst erlebt. Gerade wenn man nicht aufhörte, sobald man etwas halbwegs beherrschte, sondern es gerade dann, mit eher zu viel Präzision als zu wenig, wieder und wieder durchging, war es oft, als öffne sich eine Tür, von der man nicht einmal gewusst hatte, dass sie da war.
Vor der letzten Stunde – Religion – packte Cem hochbefriedigt seine Tasche und meinte: »Tja, wenigstens Allah meint es gut mit mir. Ich denk an dich, wenn ich zu Hause auf der Couch liege.«
»Neid!«, grummelte Wolfgang. Das baden-württembergische Kultusministerium lag seit Monaten mal wieder wegen irgendwelcher Formalien mit den islamischen Kulturverbänden im Clinch, und so lange fiel der islamische Religionsunterricht im Lande aus.
»Aber wir könnten uns heute Nachmittag treffen«, schlug Cem vor. »Freibad oder so.«
Wolfgang schüttelte den Kopf. »Ich muss Cello üben. Bin im Rückstand.«
»Na, wenn das so ist.« Cem schulterte seine Tasche und wandte sich zum Gehen. »Dann viel Spaß noch.« Sein Grinsen war schon fast unverschämt.
Und so ging es noch einmal eine Stunde lang um Klone, um Gentechnik, die Vermessenheit des Menschen, den Turmbau zu Babel und so weiter und so fort. Herr Glatz, der mit Vornamen Friedhelm hieß, konnte sich bei derlei Anlässen prachtvoll aufregen. Er pflegte rot anzulaufen, bis ihm der Schweiß auf der Stirn stand, und in endlosem Monolog querfeldein zu galoppieren, von einem Thema zum nächsten, was ihm eben so in den Sinn kam. Dabei tigerte er unruhig durch die Tischreihen. Wenn man nicht gerade unter der Bank Karten spielte, konnte man mehr oder weniger tun, was man wollte: Der rote Kopf hieß, dass er bis zum Ende der Stunde keine Fragen stellen würde.
Wolfgang sinnierte darüber, was an seinem Übungsprogramm zu verbessern war. Er konnte sich jede Woche zusätzlich zu dem, was ihm sein Lehrer aufgab, eines der Stücke vornehmen, die er schon beherrschte. Es täglich mehrmals spielen und auf besondere Präzision achten. Sich mit dem Tonband kontrollieren. Am besten, er begann mit Bach. Das Präludium der c-Moll-Suite, genau. Gleich heute Nachmittag.
Er sinnierte auch noch, als die Schule aus war und er sein Fahrrad gemächlich die bergan führenden Gassen hochschob.
Den Mann, der ihm folgte und ihn verstohlen fotografierte, bemerkte er nicht.
Nach dem Mittagessen ging Wolfgang in das Arbeitszimmer seines Vaters, um Aufnahmen der c-Moll-Suite zu suchen. Das durfte er. Der Schreibtisch war unantastbar, das gegenüber der gewaltigen Stereoanlage aufgebaute Dirigentenpult, auf dem immer eine Partitur und ein Stock lagen, heilig, doch sich nach Lust und Laune aus den CDs und Kassetten zu bedienen war Wolfgang ausdrücklich erlaubt, solange er sie regelmäßig zurückbrachte und wieder an der richtigen Stelle einsortierte.
Vaters Arbeitszimmer war ein großer, düsterer, eigenartig leblos wirkender Raum. Zwei dichte Tannen vor dem Fenster ließen wenig Licht herein, und die wertvollen alten Möbel aus dunkler Eiche, die noch aus der Praxis von Großvater stammten, den Wolfgang nie kennen gelernt hatte, heiterten das Ganze auch nicht gerade auf. Auf dem Schreibtisch türmten sich Akten, die meisten eingestaubt, weil Frau Krämer, die Mutter ab und zu im Haushalt zur Hand ging, ebenfalls striktes Verbot hatte, dort irgendetwas zu berühren. Hinter den Glastüren der Wandschränke herrschte ein wildes Durcheinander aus Zeitschriften, medizinischen Büchern und schlimm zerknitterten, eingerissenen Notizzetteln aller Art. Doch das Regal mit den CDs, das die ganze Längswand rechts und links der Stereoanlage einnahm, war geradezu akribisch geordnet, ebenso wie die zahllosen Kassetten in den Schubladen darunter. Etwa ein Drittel der CDs enthielt die Symphonien und Opern, die sein Vater zur Entspannung zu dirigieren pflegte, der Rest waren Werke, die in irgendeiner Weise mit dem Cello zu tun hatten: Cellokonzerte, Suiten, Sonaten, Duette mit Klavier, Kammermusik und dergleichen. Vater führte eine Datenbank aller Tonträger auf seinem Computer, und die nach verschiedensten Kriterien ausgedruckten Listen waren immer auf dem neuesten Stand.
So war es kein Problem, Aufnahmen der Suite fürVioloncellosolo Nr. 5 c-Moll BWV 1011, wie das Werk von Johann Sebastian Bach offiziell hieß, von verschiedenen Interpreten zu finden. Er wählte eine CD mit einem Konzert von Pablo Casals aus den Dreißigerjahren und eine moderne Aufnahme mit Heinrich Schiff aus den Achtzigern, erwog eine CD von Yo-Yo Ma, verwarf sie aber – Mas Interpretationen waren in der Regel zu eigensinnig, um einem Schüler als Vorbild dienen zu können – und stieß noch auf eine Kassette mit dem Solisten Daniel Müller-Schott. Als er probeweise hineinhören wollte, fand er im Kassettenschacht von Vaters Anlage eine Kassette vor, die er noch nie gesehen hatte – uralt aussehend, ein knallrotes Billigprodukt und im Gegensatz zu den sonstigen Gepflogenheiten nur miserabel beschriftet: Auf der A-Seite stand mit blauem Filzstift »J.«, gekritzelt, das war alles.
Wolfgang steckte sie zurück in den Recorder und ließ sie laufen. Ein Cello, wie nicht anders zu erwarten. Sein Cello, das hörte er deutlich. Vater hatte immer wieder Aufnahmen gemacht, wenn er geübt hatte, schon seit jeher. Diese Aufnahme hier musste uralt sein. So gut hatte er damals gespielt? Kaum zu glauben. Er musste schmunzeln, als das Stück – im Moment fiel ihm nicht ein, was es war – mit einem Missklang abbrach und er sich mit heller Kinderstimme sagen hörte: »Ich fang noch mal bei Takt sechzig an.«
Er legte die rote Kassette beiseite. Irgendwie stimmte ihn das wieder zuversichtlich. Immerhin, er hatte als Kind wirklich gut gespielt, also lag es nur am Üben, oder? Womöglich hatte sein Cellolehrer Recht, der zu sagen pflegte: »Die Pubertät macht Jungs faul – da haben sie die ganze Zeit Mädchen im Kopf.«
Auf seinem Zimmer hörte er die Aufnahmen nacheinander an, mit geschlossenen Augen, völlig auf die Cellostimme konzentriert. Er sah sich dabei selber spielen, spürte den Strich des Bogens, fühlte den Satz der Finger, lauschte auf Phrasierungen, Vibrati, die An- und Abstriche. Danach kramte er die Noten hervor, nahm das Cello zwischen die Schenkel, griff nach dem Bogen und probierte es selbst.
Es wurde schrecklich. Er hörte es schon, während er spielte, und als er sich danach die Aufnahme anhörte, fand er sein Spiel noch schrecklicher. Die Tempi – ungleichmäßig. Die Phrasierungen – plump. Verglichen mit den großen Vorbildern war das, was er zuwege gebracht hatte, stümperhaft und seelenlos. Enttäuscht pfefferte er den Bogen aufs Bett.
Wie konnte das sein? Er war von klassischer Musik umgeben aufgewachsen. Sein Cello hatte schon in der Ecke gestanden, dunkel, schön und wohlriechend, als er noch nicht einmal hatte laufen können. Schon als Dreikäsehoch war er in die Musikvorschule gegangen, und das gern, hatte mit Trommel und Xylophon begriffen, wie man Höhen und Längen von Noten verstand und was ein Takt war, hatte mit den anderen vor stolz versammelten Eltern gesungen und musiziert. Mit dem Cello anzufangen war ganz selbstverständlich gewesen, zuerst mit einem halben, als er noch in der Grundschule und zu klein für das richtige Instrument war, später mit einem dreiviertelten und endlich mit seinem eigenen: Nun sei er groß, hatte sein Vater ihm damals gesagt, und er war stolz gewesen. Wie sein Vater es wollte, ging er jede Woche zweimal zum Unterricht und übte jeden Tag, nicht immer gern und nicht immer ohne Ermahnung, aber er hatte stets gehorcht und nie weiter darüber nachgedacht: Es war eben, wie es war.
Wie konnte es sein, dass sein Vater und seine Mutter und seine Cellolehrer ihn für so begabt hielten und er selber nichts davon merkte? Alles, was er fertig brachte, war, die Töne in der richtigen Höhe und der richtigen Reihenfolge zu spielen. Aber das genügte nicht, bei weitem nicht!
Er blickte die Noten auf dem Ständer an und hatte das Gefühl, dass der Abgrund zwischen ihm und jemandem wie Hiruyoki Matsumoto in Wahrheit noch viel größer und tiefer war, als er ihm gestern Abend im Konzert erschienen war.
Seine Mutter war in ihrem Atelier, das neben der Küche nach hinten in den Garten hinausging, und hatte wie immer die Tür zur Eingangshalle offen stehen. In die Stille hinein vernahm er ihre Stimme von unten: »Wolfgang? Ich höre dich nicht üben!«
Gleich darauf hörte sie ihn wieder üben. Diesmal die Etüden, die ihm sein Cellolehrer aufgegeben hatte. Gleichmäßig, getragen und mit kleinen Misstönen und Aussetzern ab und zu erfüllte der Klang seines Cellos das stille Haus der Wedebergs.
Was seine Mutter nicht hörte, war, dass dieser Klang vom Tonband kam. Wolfgang hatte einen Mitschnitt seiner letzten Übungsstunde in den DAT-Recorder gelegt und hockte nun, die angezogenen Beine umarmend, auf dem Bett und starrte grübelnd vor sich hin.
Auch der mit drei Stunden Nachmittagsunterricht endlos lange Dienstag ging vorüber, immerhin mit einer völlig »klonfreien« Französischstunde, und auch in Physik fiel das Wort mit dem K kein einziges Mal. Dafür gewöhnte sich ihr Sportlehrer gerade an, sie allesamt als »Klone« zu titulieren: »So, Ihr Klone, heute fangen wir mit einer Runde Bauchmuskeltraining an!« Muskeln waren die besondere Leidenschaft von Oberstudienrat Becker, vor allem seine eigenen, die er in überaus beeindruckendem Zustand hielt. Sein zweites Hobby war das Sammeln von Schimpfwörtern und Kraftausdrücken, was einem nicht entging, wenn er mal wieder wilde Geschichten von seiner Bundeswehrzeit und seinen Einsätzen im Kosovo erzählte.