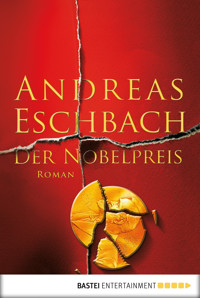5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Lampen zerspringen, Züge bleiben liegen, Dinge schweben durch den Raum … und daneben steht ein Junge, dessen starrer Blick diese unheimlichen Vorgänge lenkt. Armand ist ein Telekinet. Einer der besten. Doch diese seltene Gabe hat ihre Schattenseiten. Das Militär will, dass er seine parapsychologischen Kräfte als Killer einsetzt. Armand bleibt nur die Flucht - die ihn zu Marie und in ein neues Leben führt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Andreas Eschbach
Die seltene Gabe
Andreas Eschbach, 1959 geboren, studierte Luft- und Raumfahrttechnik und leitete ein Softwareunternehmen, bevor er beschloss, sich ganz dem Schreiben zu widmen. 1995 erschien sein erster Roman, der auf Anhieb mit dem Literaturpreis des Science-Fiction-Clubs Deutschland ausgezeichnet wurde; viele weitere Preise folgten. Seit seinem Thriller »Das Jesus Video«, der monatelang an der Spitze der Bestsellerlisten stand und erfolgreich verfilmt wurde, zählt Andreas Eschbach zu den erfolgreichsten deutschen Science-Fiction-Autoren. Mehr unter www.andreaseschbach.de
Andreas Eschbach nimmt seine Leser mit, wenn er sich in seine Welt der Beunruhigung hinausphantasiert. Mit ihm einzutauchen in ein kluges Spiel um Denkmöglichkeiten ist mitreißend unterhaltsam. Er bringt unsere Köpfe zu anhaltendem Grübeln über Realität und Fiktion. Auch das ist eine Gabe. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
Veröffentlicht als E-Book 2010 © 2004 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung und -typografie: knaus. büro für konzeptionelle und visuelle identitäten, Würzburg unter Verwendung eines Fotos von Dougal Waters © gettyimages ISBN 978-3-401-80112-4
www.arena-verlag.de Mitreden unter forum.arena-verlag.de
Kapitel 1 |
Wenn man eine ganz normale siebzehnjährige Gymnasiastin ist und einfach so durch die Stadt radelt und plötzlich überall mehr Polizisten und Polizeiautos sieht als je zuvor im Leben, denkt man dann, dass das etwas mit einem selbst zu tun haben könnte? Denkt man nicht. Ich jedenfalls sah mich die ganze Zeit bloß staunend um und dachte,wow, bestimmt ein Bankraub. Geiselnahme. Hier bei uns, in unserem verschlafenen Städtchen. Sensationell.Und hatte es plötzlich eilig, nach Hause und vor den Fernseher zu kommen, um mehr zu erfahren. Es war Ende März, aber doch schon ein wunderschöner, warmer Frühlingstag. Den Nachmittag hatte ich bei Jessica verbracht, meiner besten Freundin. Wir hatten die Hausaufgaben zusammen gemacht und über die Welt und das Leben und über Jungs geredet...Naja, um genau zu sein, hauptsächlich über Jungs, und um noch genauer zu sein, hauptsächlich über einen ganz bestimmten Jungen, über Dominik nämlich, in den Jessica aktuell verknallt war und der am Tag zuvor nicht nur mit ihr geredet, sondern sich sogar mit ihr verabredet hatte. Na toll! Jessica und ich kriegten jedes Mal Streit, wenn sie frisch verliebt war. Auch diesmal hatte es wieder sogeendet. Sie fing nämlich immer bei der erstbesten Gelegenheit an zu schwärmen, wietollder Typ sei und wiesüßund all der Quatsch, und ja, gut und schön, eine Weile konnte ich das auch über mich ergehen lassen, bloß hörte sie nie von selber wieder auf. Also kam unweigerlich der Moment, in dem mir das alles auf die Nerven ging. Dann sagte ich Sachen wie, dass sie sich doch bitte schön mal umsehen solle an der Schule und schauen, ob es irgendwelche Mädchen gäbe, die von ihren Liebesgeschichten was anderes hätten als Ärger. »Wenn du den Typ nicht kriegst, kommst du um vor Sehnsucht, und wenn du ihn hast, vor Eifersucht«, war mein Sprüchlein. Jessica hatte daraufhin rumgeschmollt, dass das bei ihr was völlig anderes sei – klar –, und ich hatte weitergemacht von wegen, die Jungs bei uns an der Schule seien ohnehin alle eingebildet und langweilig und könnten mir samt und sonders gestohlen bleiben. »Du bist bloß neidisch, weil dich sowieso keiner anschaut«, hatte Jessica gegiftet und ich hatte zurückgefaucht, jawohl, das sei mir auch sehr recht. Vor allem könne ich herzlich gern darauf verzichten, dass mich einer wie Dominik anschaue. »Auf den fliegen doch alle bloß wegen seiner blonden Locken«, hatte ich gesagt. »Damit sieht er so unschuldig aus wie ein Engelchen. Aber in Wirklichkeit hat er es faustdick hinter den Ohren.« Und weil ich gerade so schön dabei war, gemein zu sein, hatte ich angefangen aufzuzählen, mit wem dertolleDominik mit densüßenblonden Locken schon alles herumgemacht hatte und wie schnell es jedes Mal vorbei gewesen war. »Wenn du mich fragst, der Typ wird von einem Hersteller für Papiertaschentücher gesponsert.« Danach waren nur noch Tränen geflossen und ich hatte meine Sachen gepackt und mich auf den Heimweg gemacht. Unterwegs ließ ich mir Zeit. Jessica wohnte ziemlich genau am anderen Ende der Stadt, das heißt, es war ein ordentliches Stück Weg bis nach Hause. Ich musste mich auch erst abregen und an den Gedanken gewöhnen, nun wieder einige Wochen ohne beste Freundin auskommen zu müssen; und außerdem wartete niemand auf mich. Meine Eltern waren zurzeit nicht da. Mutter hatte einige Monate zuvor an einem Preisausschreiben teilgenommen, was ihr noch nie vorher in den Sinn gekommen war, und mit dem Glück des blutigen Anfängers hatte sie gleich den ersten Preis gewonnen, eine zweiwöchige Kreuzfahrt durch die Karibik. Für zwei Personen selbstredend. Also waren Herr und Frau Behnert in die zweiten Flitterwochen aufgebrochen, während das brave Töchterlein Marie zu Hause blieb und derweil das Haus hütete. Was mir, ganz ehrlich, nicht das Geringste ausmachte. Genau genommen, fand ich es phantastisch. Zum ersten Mal ein ganzes Haus für mich alleine! Großartig. Nicht dass ich meine Eltern nicht liebe und so, aber ich fühlte mich, seit sie abgereist waren, so herrlich selbstständig und unabhängig, dass es von mir aus noch wochenlang so hätte weitergehen können. Ich liebte es, das Haus zu versorgen. Zu meinem eigenen Erstaunen machte ich Einkäufe, wusch Wäsche und saugte Teppiche, und das, obwohl sich in der Speisekammer die Vorräte stapelten, saubere Wäsche im Schrank lag und man von den Teppichen hätte essen können – einfach, weil ich mir so unerhört erwachsen dabei vorkam. Man bedenke: Ich hätte ohne weiteres nachts um drei nach Hause kommen können und niemand hätte auch nur die geringste Notiz davon genommen! Allein die Vorstellung war berauschend. Allerdings ist die Versuchung, derlei tatsächlich zu tun, sehr gering, wenn man morgens um halb acht in der Schule zu erscheinen hat. Ich weiß, dass etliche in meiner Klasse das anders gesehen hätten, aber deren Eltern hätten sich auch eher die Hand abhacken lassen als ihnen das Haus für zwei Wochen zu überlassen. Während ich so dahinfuhr, die Schultasche hinter mir auf dem Gepäckträger, und der Ärger über den blöden Streit mit Jessica allmählich nachließ, galten meine Gedanken dem Abend, der vor mir lag. Ich würde es mir mit einem großen Tablett voller leckerer Sachen auf der Couch gemütlich machen, und keiner würde mir ins Fernsehprogramm dreinreden. Kamen heute nicht ein paar gute Krimis? Bei diesem Stichwort fielen mir wie gesagt all die Polizisten auf, die die Innenstadt bevölkerten. Weiß-grüne Polizeiautos überall, Mannschaftswagen sogar. Ein Großaufgebot. Nicht ganz so, wie man es manchmal in amerikanischen Filmen sieht, aber für unser verträumtes Städtchen absolut ungewöhnlich. Unwillkürlich bremste ich ab. Ich bemühte mich besonders vorschriftsmäßig zu fahren, vor Zebrastreifen zu halten, vor dem Abbiegen deutlich Zeichen zu geben und all das, was sie einem immer beizubringen versuchen. Die Polizeistreifen sahen zwar nicht einmal in meine Richtung, aber sicher war sicher. Neben den uniformierten Beamten standen jeweils auffallend unauffällig gekleidete Zivilisten, die genauso wachsam die Blicke schweifen ließen. Kennt man ja aus dem Fernsehen. Großfahndung. Während ich das Stadtzentrum durchquerte, hörte ich irgendwo einen Lautsprecherwagen umherfahren und lautstark eine längere Mitteilung hinaustrompeten, aber um all die Hausecken herum war kein Wort zu verstehen. Und überhaupt beeilte ich mich jetzt nach Hause zu kommen, nicht nur um aus der Glotze Näheres zu erfahren, sondern um nicht am Ende unversehens in eine Schießerei zu geraten oder so etwas. Mir begegnete nichts, das in irgendeiner Weise gefährlich gewesen wäre, aber ich atmete trotzdem auf, als ich in unsere Straße einbog. Alles sah friedlich aus. Alles sah aus wie immer. Da war unser Haus, das erste von fünf weitgehend ähnlichen Reihenhäusern, die abwechselnd gelb und orange verputzt und stufenartig gegeneinander versetzt sind. Es lag hinter dichten Hecken und Vorgartenbäumen versteckt, die Gardinen der Fenster im Obergeschoss ordentlich zurechtgezogen, die Jalousien halb heruntergelassen gegen die Sonne – was immer auch los sein mochte, hier war ich sicher. Dachte ich. Mir stockte der Atem, als zwei Polizisten um die Ecke bogen, gerade als ich vor dem Gartentor angelangt war. Der eine hielt ein Ungeheuer von einem Schäferhund an der Leine, der andere trug eine Maschinenpistole unter dem Arm, als sei das die selbstverständlichste Sache der Welt. Für ihn war es das vielleicht auch. Ich für meinen Teil machte, dass ich ins Haus kam. Normalerweise hätte ich mein Fahrrad ordentlich in der Garage untergestellt, aber heute lehnte ich es nur gegen die Hauswand, zerrte die Tasche vom Gepäckträger und kramte hastig meinen Schlüsselbund heraus. Und ich tat etwas, das ich sonst frühestens um dreiundzwanzig Uhr tue: Ich schloss die Haustüre von innen ab. Als Erstes rannte ich ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher an. Nichts. Vorabendserien, Talkshows, der übliche Müll. Auch auf den Nachrichtenkanälen nichts; dort ging es wie all die Tage zuvor schon um einen französischen Geheimdienstler, der irgendwelche Vorwürfe gegen seine Chefs erhob, was alle Journalisten in Aufruhr versetzte, mich aber nichtdie Bohne interessierte. Ich schaltete das Ding wieder ab, marschierte in die Küche und drehte das Radio an. Hier war es dasselbe. Musik auf allen Sendern, wie immer, und die aktuellste Nachricht, die sich finden ließ, war ein Verkehrshinweis, ein Stau auf irgendeiner Autobahn. Niemand schien etwas zu wissen über irgendwelche gesetzwidrigen Vorgänge in einer süddeutschen Kleinstadt, Vorgänge immerhin, die eine regelrechte Polizeistreitmacht auf den Plan gerufen hatten. Ich drehte den Ton leiser und ging in die Garderobe. Dort gibt es ein kleines Fenster, durch das wir zum Beispiel hinausspähen, wenn jemand bei uns klingelt und wir sehen wollen, wer es ist, um eventuell so tun zu können, als seien wir nicht da. Die beiden Polizisten patrouillierten jetzt auf der anderen Straßenseite. Der eine hatte das Funkgerät am Ohr, und während er sprach, drehte er sich um und schien in meine Richtung zu blicken. Ich duckte mich unwillkürlich, obwohl er mich durch die dichte Gardine unmöglich sehen konnte. Falscher Alarm, wie es aussah. Irgendwohin muss einer schließlich schauen, wenn er die Augen offen hat. Jetzt sah er in Richtung Wald, der unweit unserer Straße anfängt und bei Joggern und Hundebesitzern gleichermaßen beliebt ist, was immer wieder zu heftigen Streitereien führt. Was mochte bloß los sein? Mir kam der Gedanke, einfach hinauszugehen und die beiden Männer zu fragen, aber dann sagte ich mir, dass ich alles noch früh genug erfahren würde. Spätestens morgen aus der Zeitung oder in der Schule, falls es nicht so wichtig war, dass es im Fernsehen kam. Ansonsten hatte ich selber nichts verbrochen, auch keine sachdienlichen Angaben zu machen – die ganze Angelegenheit ging mich schlicht und ergreifend überhaupt nichts an. Dachte ich wie gesagt. Mit einem tiefen Seufzer, der endlich den gemütlichen Teil des Abends einleiten sollte, hob ich meine Schultasche auf, stellte sie an die Treppe, wie ich es immer tat, um sie beim nächsten Gang in den ersten Stock mit in mein Zimmer zu nehmen, und zog die Straßenschuhe aus und Hausschuhe an. Als ich in die Küche kam, verlas der Radiosprecher gerade in rasender Geschwindigkeit eine Liste von Veranstaltungshinweisen für das kommende Wochenende, die überhaupt kein Ende nehmen wollte. Nervtötend. Ich schaltete den Kasten ab und machte mir Gedanken über mein heutiges Abendessen. Zu diesem Zweck schlenderte ich in die Speisekammer, musterte die dort säuberlich aufgereihten Vorräte an Dosen, Einmachgläsern und Packungen an Nudeln, Reis, Mehl und dergleichen, die Stange mit den aufgehängten geräucherten Würsten, die Flaschen mit Öl, Essig, Wein und Bier, das Regalfach mit den Tütensuppen und den Fertigspagetti und die Kiste im dunklen Eck, in der die Kartoffeln lagern. Beinahe automatisch griff meine Hand in die kleine Schublade,in der die Süßigkeiten aufbewahrt werden, und tastete nach der Erdbeerschokolade. Bloß war da keine Erdbeerschokolade. Verwundert nahm ich das Fach in näheren Augenschein. Höchst merkwürdig. Es lag eine unberührte Tafel Vollmilchschokolade darin, was in Ordnung und beruhigend war, aber ich glaubte mich deutlich zu erinnern, dass am Nachmittag zuvor noch fast eine halbe Tafel Erdbeerschokolade da gewesen war. Ich überlegte peinlich berührt, ob ich der Schokolade vielleicht irgendwann im Verlauf des gestrigen Tages den Garaus gemacht hatte, ohne es zu merken. Soll ja schon vorgekommen sein. Aber andererseits hätte dann zumindest noch das Papier irgendwo sein müssen, oder? Tatsache blieb, dass die Schokolade nicht mehr da war. Sie war auch nicht irgendwo anders in der Speisekammer. Ich durchsuchte die Fächer und Regale, sah auf dem Boden nach und sogar in der Schublade mit den Gewürzen und fand zwar nicht die Schokolade, stieß dafür aber auf etwas anderes, noch viel Merkwürdigeres: Es fehlten auch vier Scheiben Vollkornbrot. Heute Morgen hatte ich die Scheiben in der Tüte gezählt, um festzustellen, ob ich noch Brot kaufen musste, und da waren noch sieben Scheiben da gewesen. Jetzt waren nur noch drei Scheiben da. Es gibt Situationen, in denen man leicht bereit ist anseinem klaren Verstand zu zweifeln, und das hier war so eine Situation. Ich zählte noch einmal nach, natürlich mit demselben Ergebnis. Man kann im Allgemeinen bis drei zählen und auch bis sieben und überdies beides voneinander unterscheiden, wenn man die elfte Klasse eines gewöhnlichen Gymnasiums besucht. Andererseits hatte ich noch nie davon gehört, dass sich Vollkornbrot bisweilen in Luft auflöst. Da ich schon einmal dabei war, überprüfte ich die übrigen Vorräte ebenfalls, zumindest die, von denen ich ungefähr wusste, wie viel davon da zu sein hatte. Das Ergebnis war außerordentlich seltsam: Von drei Tüten Milch waren nur noch zwei da, die Zahl der Ringe harter Blutwurst war von fünf auf vier gesunken, mindestens drei Flaschen Apfelsaft fehlten, und der Camembert und die Trauben, die eigentlich auf meinem heutigen Fernsehtablett eine Hauptrolle hatten spielen sollen, waren ganz und gar verschwunden. Ich muss ein ausgesprochen belämmertes Gesicht gemacht haben, als ich mit dieser Bestandsaufnahme fertig war. Eine ganze Weile starrte ich vor mich hin, während in meinem Kopf die Gedanken kreuz und quer durcheinander stoben, dann begann mir allmählich unheilvoll zu dämmern, was ich da gerade festgestellt hatte. Im Verlauf des heutigen Tages waren Nahrungsmittel aus der Speisekammer verschwunden. Aber Nahrungsmittel hüpfen nicht von selbst aus den Regalen,und sie lösen sich auch nicht spontan in Luft auf. Normalerweise verschwinden sie nur, wenn sich jemand ihrer annimmt, für gewöhnlich, indem er sie aufisst. Und da ich das nicht getan hatte, musste es jemand anders getan haben.
Kapitel 2 |
Im nächsten Moment kam mir diese Überlegung schon wieder absolut lächerlich vor. Ich sah Gespenster. Ein Einbrecher, der Blutwurst, Milch und Käse stiehlt? Eine absurde Vorstellung. Trotzdem war ich beunruhigt. Ich ging in die Küche, ganz in Gedanken, und fand mich plötzlich vor der offenen Besteckschublade stehen, das große Fleischmesser in der Hand. War ich jetzt übergeschnappt? Ich pfefferte es zurück ins Messerfach, schob die Schublade zu und beschloss auf der Stelle einen Kontrollgang durchs Haus zu machen, um mich zu vergewissern, dass nirgendwo ein Fenster eingeschlagen oder ein Schloss aufgestemmt worden war oder sonst irgendetwas darauf hindeutete, dass jemand da gewesen war, der hier nichts zu suchen hatte. Immerhin, die Türe zum Keller war abgeschlossen, der Schlüssel steckte, und sie war aus Stahl: keine Chance für Eindringlinge. Den Keller musste ich also schon mal nicht durchsuchen und im Stillen dankte ich dem Erfinder jener Brandschutzvorschriften, denen das zuzuschreiben war. Nächste Station war das Wohnzimmer. Die Türen zur Terrasse waren fest verschlossen und unbeschädigt, die Vorhänge ordentlich zugezogen, und auch einlangsamer Rundblick ließ mich nichts entdecken, das nicht so gewesen wäre, wie es sein sollte. Als ich so im Wohnzimmer stand, wurde mein Blick jedoch wie magisch von dem schwarzen, stählernen Schürhaken angezogen, der an einem dicken Ziernagel neben dem Kamin hing. Unser Kamin, muss man dazu wissen, sieht zwar auf Fotos beeindruckend aus, ist aber ganz und gar unecht. Groß und wuchtig und wunderbar rustikal aussehend, aus echten, behauenen Steinen gemauert, könnte man nicht einmal einen Brief in ihm verbrennen, ohne das ganze Zimmer mit Rauch zu verpesten, denn er ist an keinen Schornstein angeschlossen. Um genau zu sein, es gibt überhaupt keinen für offene Kamine geeigneten Schornstein in unserem Haus. Deshalb liegt in der schmiedeeisernen Feuerstelle nur eine elektrisch betriebene Attrappe, die auf Knopfdruck aussehen kann wie dicke, glimmende Holzscheite und sogar eine gewisse Wärme ausstrahlt, und deshalb ist der Schürhaken nur eine Art Schmuckstück. Trotzdem war er aus solidem Stahl und ein schweres Ungetüm, mit dem man zur Not einem Einbrecher eins über den Schädel geben konnte. Mit diesen Hintergedanken nahm ich ihn vom Haken. Während ich meinen Rundgang fortsetzte, beruhigt, eine Waffe in Händen zu halten, und die Fenster kontrollierte, schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass ein Einbrecher sich ja nicht unbedingt nur an Lebensmitteln vergriffen haben mochte. Vielleicht hatteer in derselben unauffälligen Art einen von fünf Geldscheinen mitgehen lassen, eine von drei Perlenketten oder drei silberne Kuchengabeln aus einem ganzen Service? Wenn er das in jedem Haus so machte, kam auch etwas zusammen, und die meisten Leute würden es lange Zeit gar nicht bemerken. Ich rannte die Treppe hoch in mein Zimmer und kontrollierte hastig die Geldvorräte, die ich in meinem Schreibtisch in einem Geheimfach aufbewahre, das für den Fachmann möglicherweise so geheim doch nicht ist. Es war noch alles da. Auch sonst war in meinem Zimmer alles in Ordnung. Einen Augenblick fragte ich mich ernsthaft, ob ich dabei war, den Verstand zu verlieren. Eine neuartige Form von Alzheimer, die auch Jugendliche befiel? Ich versuchte mir vorzustellen, was ich zu hören bekäme, wenn ich die Polizei anrief und den unerklärlichen Verlust von vier Scheiben Vollkornbrot und einer halben Tafel Erdbeerschokolade meldete. Ich dachte an die Streife, der ich begegnet war, und stellte mir vor, wie die ins Haus kamen, um ihren Monsterhund in unserer Speisekammer Witterung aufnehmen zu lassen. War es nicht besser, sich damit abzufinden, dass Lebensmittel einfach verschwinden konnten? Aufgefressen von neuartigen, genmanipulierten Mäusen, die Packungen pasteurisierter Milch nicht nur austranken, sondern danach auch noch auffraßen? Mir schwirrte der Kopf. Einen flüchtigen Moment lang fragte ich mich, ob der ganze Trubel in der Stadt,dieses ungewöhnliche Aufgebot an Polizei und Streifenwagen, womöglich diesem Dieb gelten mochte. Aber dann verwarf ich diesen Gedanken sofort wieder. Hunderte von Polizisten, um einen Käsedieb zu fangen? Lächerlich. Vielleicht gab es ja eine andere, völlig harmlose Erklärung. Vielleicht war ich schlafgewandelt und hatte all das Zeug irgendwann nachts verdrückt? Bloß mag ich gar keine Blutwurst, jedenfalls nicht, wenn ich wach bin. Mein Vater kauft die immer in rauen Mengen, und er schwört darauf, dass sie monatelang hängen und trocknen muss, bis sie die Konsistenz von Lederschnürsenkeln hat. Dann sei sie ein Hochgenuss. Findet er. Als ich an Vater denken musste, musste ich auch an Mutter denken, und auf einmal wurde mir klar, dass ein Einbrecher sich kaum um die kargen Taschengeldersparnisse in Geheimfächern von Schreibtischen in Mädchenzimmern kümmern würde, sondern dass er nach richtig wertvollen Dingen suchen musste, damit die Sache sich lohnte. Das Haushaltsgeld im Wäscheschrank. Den Schmuck der Dame des Hauses. Solche Dinge. Meine Mutter besaß in dieser Hinsicht einiges. Vater ist Abteilungsleiter in der größten Maschinenbaufirma des Ortes und da finden immer wieder irgendwelche Empfänge oder Bankette oder was weiß ich statt, und bei solchen Gelegenheiten kann sich Mutter aufbretzeln, dass einem die Augen herausfallen.
Ich überlegte, wo sie ihre Schmuckschatulle aufzubewahren pflegte, und glaubte mich zu entsinnen, dass sie entweder in ihrem Nachttisch oder im Schrank bei der Bettwäsche zu finden sein musste. Ich krallte den Schürhaken und marschierte hinüber ins Schlafzimmer meiner Eltern. Auch hier war alles in einwandfreiem Zustand. Ich zog Mutters Nachttischschublade auf und öffnete das Klappfach darunter, aber da war nur allerlei Krimskrams, keine Schmuckschatulle. Also im Schrank. Ich ging zum Schrank und öffnete die Tür, und dann ging alles so schnell, dass ich mich nicht mehr an Einzelheiten erinnere. Ich weiß nur, dass ich ins obere Schrankfach blickte und nach der flachen, silbern schimmernden Kassette Ausschau hielt und stattdessen die ganzen Kleider meiner Mutter dort sah, achtlos über die Stapel weißer Bettwäsche gestopft, und ehe ich den Blick senken konnte dorthin, wo diese Kleider auf Bügeln hätten hängen müssen, kam mir eine dunkle Gestalt aus dem Schrank entgegen, ein torkelnder menschlicher Körper, der einen erstickten Laut der Überraschung von sich gab, als er hochkam. Ich sprang zurück, während der Schatten die zweite Schranktür aufstieß, und meine Hände, den Schürhaken umklammernd, diesen wie aus eigenem Entschluss in die Höhe rissen, schlagbereit hoch über den Kopf, und im Rückwärtsgang zur Tür stolpernd schrie ich, erfüllt von panischem Entsetzen, irgendetwas wie »Stehen bleiben oder ich schlage zu!«. Er blieb tatsächlich stehen, verharrte mitten in der Bewegung, geduckt und noch halb im Schrank stehend. Es war ein Junge. Nur ein ganz gewöhnlicher Junge. »Bleib, wo du bist«, sagte ich, diesmal mit etwas ruhigerer und, wie ich hoffte, drohenderer Stimme. Er wirkte nicht besonders gefährlich, dem Aussehen nach konnte er kaum älter sein als ich selber, aber andererseits weiß man ja nie. Ich wich jedenfalls zurück, bis ich den Türrahmen im Rücken spürte, erst dann hatte ich das Gefühl, die Situation einigermaßen im Griff zu haben. »Was hast du hier zu suchen?«, fragte ich finster. Er starrte mich mit großen, schlafverquollenen Augen an. Offenbar hatte er geschlafen, als ich die Tür geöffnet und ihn damit geweckt hatte. Erst jetzt sah ich, dass er sich auf dem Schrankboden mit einigen Decken, deren Verschwinden mir noch gar nicht aufgefallen war, ein richtiggehendes Nest eingerichtet hatte, auf dem man sicher nur mit einigen Verrenkungen liegen konnte – der Kleiderschrank meiner Mutter ist groß, aber so groß nun auch wieder nicht. In der Ecke dahinter erspähte ich eine Milchtüte und abgefressene Traubenstiele, die auf dem zerknüllten Einpackpapier von Erdbeerschokolade lagen, und damit war mir klar, was es mit den geheimnisvollen Vorgängen in der Speisekammer auf sich hatte. »Los, antworte!«, drängte ich. »Wie kommst du dazu, dich hier bei uns im Schrank zu verstecken? Was solldas?«»Mon dieu«,hörte ich ihn murmeln. »Ein Mädchen!«Diese scharfsinnige Bemerkung war eher eine ArtSelbstgespräch und keine Antwort auf meine Frage.Er sprach mit einem kaum wahrnehmbaren französischen Akzent.Ich musste aus irgendeinem Grund plötzlich an denStreit mit Jessica denken und wie ich gesagt hatte, mitJungs habe man nichts als Ärger. Das hier sah auchganz so aus, als würde ich Recht behalten.»Das ist keine Antwort«, erwiderte ich unwirsch.»Los, sag, seit wann versteckst du dich hier schon?«Gruselige Vorstellung, dass er womöglich schon seitTagen da im Schrank hauste, ohne dass ich auch nurdas Geringste geahnt hatte!»Seit heute Nachmittag.«Mir fiel ein Stein vom Herzen. »So, seit heute Nachmittag. Und wie bist du hereingekommen?«Er richtete sich ganz langsam, in Zeitlupe fast, vollends auf und drehte den Kopf bedächtig hin und her,so, als habe er einen ziemlich verspannten Nacken.Was auch kein Wunder gewesen wäre. »Das warleicht«, sagte er dann. »Hereinzukommen, meineich.«»Lüg nicht. Ich habe überall abgeschlossen, als ich gegangen bin.«»Ja«, nickte er. »Ich weiß.«»Was soll das Ganze überhaupt? Was suchst du hier?«
Er antwortete nicht, sah mich nur an mit einem schwer zu deutenden Blick. Er trug einen abgeschabt aussehenden graubraunen Pullover und Jeans, aber keine Schuhe, nur Strümpfe, unansehnliche, fleckige Dinger, die ich höchstens mit einer Zange angefasst hätte. »Na schön, von mir aus«, meinte ich, als ich für meinen Geschmack lange genug auf eine Antwort gewartet hatte. »Die Polizei wird das schon aus dir herauskriegen.« Ja, da zuckte er zusammen, als ich die Polizei erwähnte. Recht so, deswegen hatte ich das ja auch gesagt. Ich wollte auf seinem Gesicht endlich sehen, dass er sich bei etwas Unrechtem ertappt fühlte, nicht bloß im Schlaf gestört. Und tatsächlich, sein Kopf ruckte ein Stück höher, gerade so, als wache er jetzt erst richtig auf. Im gleichen Augenblick geschah etwas Gespenstisches. Ich hielt den Schürhaken immer noch schlagbereit, schräg über meinem Kopf, mit beiden Händen. Der Haken war etwa einen Meter lang und aus massivem Stahl, also nicht gerade leicht. Und wenn man einen schweren Gegenstand mit einigermaßen ausgestreckten Armen hält, ist es völlig normal, dass man das Gefühl bekommt, er werde immer schwerer. Das kennt jeder. Aber das, was nun geschah, war etwas anderes. Plötzlich, innerhalb weniger Sekunden, schien der Schürhaken mehrere Zentner Gewicht dazuzugewinnen, und das ging so schnell, dass ich hätte Schwergewichtsweltmeisterin sein müssen, um das verhexte Ding auch nur einen Herzschlag länger zu halten. So aber entglitt er mir und fiel zu Boden mit einem Krachen, dass man meinen konnte, ich hätte einen Schmiedeamboss fallen lassen. »Bleib stehen«, sagte der Junge und jetzt klang es drohend. »Und schrei nicht. Ich bin stärker als du. Du hast keine Chance. Nur damit du es weißt.« Schreien? Ich war außer Stande, auch nur einen Laut von mir zu geben. Ich stand bloß da, starrte den Schürhaken auf dem Boden an und wusste nicht mehr, was ich denken sollte. Das war doch nur ein Traum, oder? Einer von diesen schlechten Träumen, aus denen man mit einem Schrei aufwacht. »Es tut mir Leid«, fuhr der Junge fort, mit einer eigenartig brüchigen Stimme. »Ich musste mich irgendwo verstecken und wieder einmal essen und trinken und schlafen. Ich bin auf der Flucht. Sie jagen mich mit allem, was sie haben.« Auf der Flucht? Wie bitte? Der war wohl größenwahnsinnig. »Du willst nicht im Ernst behaupten, dass alle diese Polizisten mit ihren Hunden und Maschinenpistolen wegendirda draußen unterwegs sind?« Er furchte die Stirn. »Sie sind also schon da?« »Eine ganze Armee.« Er nickte nur, dieser seltsame Junge, der keine Handbreit größer war als ich, ein hagerer Typ in schmutzigen Klamotten, mit langen, unordentlichen schwarzen Haaren, die eine Behandlung mit viel Shampoound viel Wasser dringend nötig gehabt hätten.Und da auf dem Teppichboden lag der Schürhaken,der plötzlich eine Tonne gewogen hatte. Ich wusstenicht mehr, was ich denken sollte.»Was hast du denn . . . getan?«, fragte ich zögerlichund war mir nicht sicher, ob ich das wissen wollte.»Nichts.«»Wer nichts verbrochen hat, wird doch nicht mit so einem Aufwand verfolgt.«Er warf mir wieder einen dieser seltsamen Blicke zu,die er draufhatte. »Sie verfolgen mich nicht, weil ichetwas verbrochen habe«, sagte er. »Sie wollen michhaben.«
Ich glotzte ihn bloß an wie betäubt, während er aus dem Schrank hervorkam und die Schranktüren sorgsam hinter sich schloss. »Was soll das heißen?«, fragte ich schließlich. »Haben«, wiederholte er. »Das heißt so viel wie besitzen. Verfügen über. Kontrollieren.« Es klang ein bisschen irre, wie er das sagte. Ich schüttelte den Kopf. »Ich glaube dir kein Wort.« Meine wild rotierenden Gedanken produzierten verrückteste Vermutungen. »Ich glaube, du willst dich nur irgendwie herausreden, weil ich dich ertappt habe. In Wirklichkeit hast du dich hier versteckt, weil du...was weiß ich... weil du mich heute Nacht überfallen wolltest, zum Beispiel.«
Er sah mich überrascht an, dann grinste er schief. »So ein Unsinn.« Ich schnappte nach Luft. Das war ja wohl die Höhe! Nicht genug, dass dieser Kerl in mein Haus eingedrungen war, nun tat er auch noch so, als sei ich es, die nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, nur weil ich wissen wollte, was er hier suchte. »Zufällig finde ich das alles andere als unsinnig«, gab ich so ätzend wie möglich zurück. »Du hast doch die Polizei überall gesehen, oder?« »Es gibt hunderttausend Gründe, Polizei einzusetzen, und so ungefähr der unwahrscheinlichste davon ist, ausgerechnet dich zu suchen«, erwiderte ich bissig. In diesem Moment hörte ich wieder einen Lautsprecherwagen ganz in der Nähe, nur ein paar Straßen weiter, aber ich verstand wieder nurGwäk-gwäk-gwäk. Der Junge horchte auf und nickte wissend. »Sie sind also immer noch da«, sagte er. »Gehen wir hinunter.« Ich war gerade in ausgesprochen kämpferischer Stimmung. »Soll das etwa ein Befehl sein?« Er sah mich finster an. »Du kannst Streit haben, wenn du willst«, sagte er und seine Stimme hatte auf einmal einen harten Unterton. »Aber du wirst nicht gewinnen, das verspreche ich dir.« »Ach wirklich?« Sein Tonfall kam mir ausgesprochen arrogant vor, und das reizte mich noch mehr. Wenn ich etwas auf den Tod nicht vertragen kann, dann sind es arrogante Typen, die sich für was Besseres halten.
»Ja«, nickte er. »Wirklich.«Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Wenn dumich anfasst, werde ich schreien«, kündigte ich an.»Und ich kann laut schreien. Sehr laut. Das hört mannoch drei Häuser weiter, Minimum. Und das ist keineTheorie, sondern praktische Erfahrung.«»Dich anfassen?« Das schien ihn großartig zu amüsieren. »Ich muss dich nicht anfassen. Glaub bloß dasnicht.« Er sah sich um, deutete auf die Nachttischlampe meiner Mutter. »Achte mal auf dieses Ding dort,ja?«»Ja, und?«Es war überaus beeindruckend. Er bewegte sich nicht,es war nichts zu sehen und nichts zu hören. Ich wusste nicht, wie es geschah, aber es geschah.Der Porzellanfuß der Lampe zerplatzte in tausendScherben.Einfach so.»Wollen wir jetzt hinuntergehen?«, fragte der Junge.
Kapitel 3 |