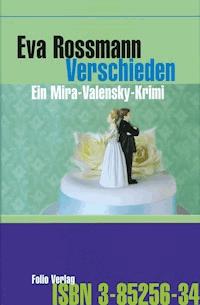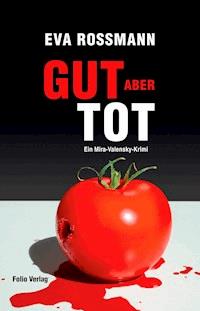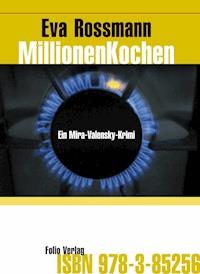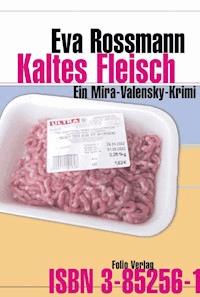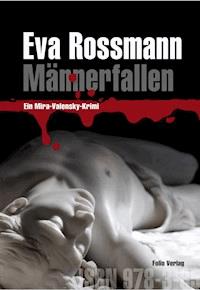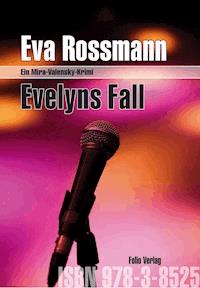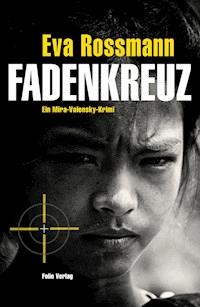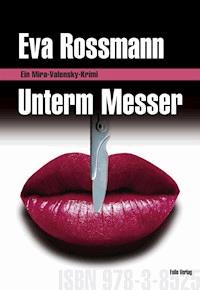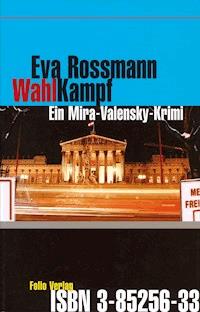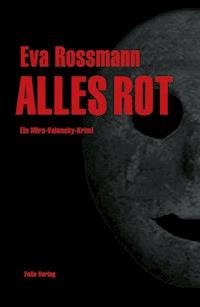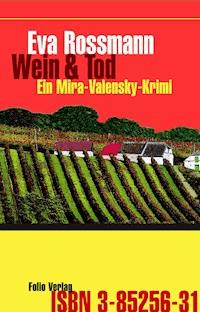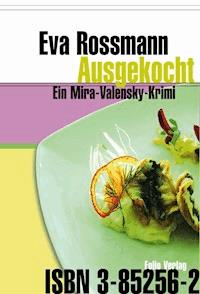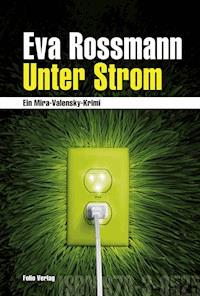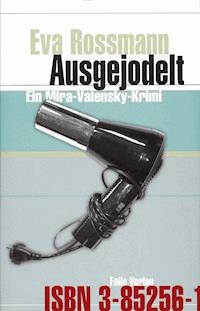
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mira-Valensky-Krimi
- Sprache: Deutsch
Schlager, Stars und Leichen - genau dort, wo die Welt doch eigentlich noch in Ordnung ist. Downhill Sepp, einstiges Ski-Ass und smarter Superstar der volkstümlichen Musik liegt tot in seiner Garderobe. War es Mord? Mira Valensky - ihres Zeichen Lifestyle-Journalistin - beginnt sofort mit der Recherche und stößt hinter Liebessehnsucht und Naturromantik auf Intrigen, Neid und Eifersucht. Wie schon im ersten "Mira Valensky-Krimi" "Wahlkampf" (Folio 1999) ist die Putzfrau Vesna Krajner mit dabei, wenn es gilt, hinter Hirschen und Trachtenblusen die weniger schöne Realität zu sehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ausgejodelt
Lektorat: Karin Astelbauer-Unger
2. Auflage 2001
© FOLIO Verlag, Wien • Bozen 2000
Alle Rechte vorbehalten
Graphische Gestaltung: Dall’O & Freunde
Druckvorbereitung: Graphic Line, Bozen
Druck: Dipdruck, Bruneck
ISBN 3-85256-139-6eISBN 9783990370018
[ 1. ]
Er fiel mir direkt vor die Füße. Seine dunklen schulterlangen Locken waren dank einer halben Dose Haarspray noch immer perfekt, seine mit grünen Glitzerfäden durchzogene Trachtenjacke funkelte wie eben noch auf der Bühne, die unglaublich blauen Augen standen weit offen. Offen war auch der Mund. In beide Mundwinkel hatten sich tiefe Falten gekerbt, aus dem linken Mundwinkel floss Speichel. Ich wusste sofort: Downhill-Sepp war tot.
Normalerweise schreit man, wenn einem eine Leiche vor die Füße fällt. Oder man läuft davon. Ich aber stand ganz still da und konnte gar nicht anders, als ihn anzustarren. Aus den Lautsprechern schallte der volkstümliche Sommerhit „Grüne Wiese, grüne Kühe, grünes Haus“. Das Telefon in der Künstlergarderobe begann zu klingeln und riss mich aus meiner Trance. Ich umkreiste den Toten vorsichtig, hob ab, ließ den Hörer aber wieder fallen. Was hätte ich auch sagen sollen?
Ich rannte zur Tür und stieß beinahe mit dem Regieassistenten zusammen.
„Was hat er denn?“, fragte der Assistent.
„Er ist tot“, antwortete ich.
„Warum tot?“
Dumme Frage. „Holen Sie die Verantwortlichen! Und die Polizei!“ Dafür waren Assistenten schließlich da. Und ich war froh, an ihn delegieren zu können. Denn langsam, ganz langsam bekam ich weiche Knie. War das der Schock? Oder war es deswegen, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte? Wie konnte ich in dieser Situation nur an Essen denken?!
Es dauerte nur einige Augenblicke, und schon war der stellvertretende Fernsehdirektor da, hinter ihm zwei aufgeregte Mitarbeiterinnen mit Stöpseln in den Ohren und einem Minimikro vor dem Mund. Der stellvertretende Fernsehdirektor ging neben Downhill-Sepp in die Hocke und legte zwei Finger an dessen Halsschlagader. Der Schweiß rann ihm dabei über die dicke Oberlippe. Als er bemerkte, dass seine Krawatte wie ein zu kleines Leichentuch am Bauch des Sängers lag, stopfte er sie mit einer raschen Bewegung zurück ins Sakko, so, als sei der Tod ansteckend.
„Schnell, einen Arzt!“, rief er. „Und jemanden von der Sicherheit.“ Eine Mitarbeiterin gab den Befehl über ihr Mikro weiter. Erst jetzt nahm mich der stellvertretende Fernsehdirektor wahr und fragte mich wenig freundlich: „Was machen denn Sie da?“
„Ich hatte mit ihm einen Interviewtermin.“
„Das hat sich ja wohl erledigt. Gehen Sie! Sofort!“
„Aber ich habe ihn gefunden.“
„Sie gehören nicht zum Sender, das ist eine interne Angelegenheit.“
„Das glauben Sie doch nicht im Ernst.“
„Sie ist vom Magazin“, zischte eine Mitarbeiterin ihrem Chef zu. Als ob man in der engen Garderobe nicht jedes Wort verstanden hätte.
„Sie werden keine Fotos machen.“
„Ich bin Redakteurin, keine Fotografin,“ erklärte ich und sah mich zum ersten Mal mit beruflichem Interesse im Raum um. Mein Blick schweifte über einen Spiegel, einige Schminksachen, Notenblätter, eine dunkelblaue Aktentasche, einen Kleiderständer mit Jeans und einem grob gewebten Leinenhemd.
„Gehen Sie!“, wiederholte der stellvertretende Fernsehdirektor.
„Ich nehme an, dass die Polizei mit mir reden will. Außerdem: Berühren Sie ja nichts!“
Er zuckte zusammen und stand auf.
Eine dumme Sache für sein Unternehmen: Gerade noch hatte Downhill-Sepp in der großen Volksmusikshow seinen Schlager „Die letzte Abfahrt“ gesungen, und jetzt lag er da. Tot. Und er war ausgerechnet einer Journalistin vor die Füße gefallen.
Immer mehr Menschen drängten sich vor der Garderobe im schmalen Gang. Die Tür stand halb offen, und ohne Downhill-Sepp wegzuziehen konnte man sie nicht schließen. Das Gemurmel wurde lauter. Ein Mann sagte: „Das war Mord, das kann nur Mord gewesen sein.“ Wenig später kämpfte sich eine Frau mit langen blonden Haaren durch die Schaulustigen und warf sich mit einem Schrei über den toten Volksmusikanten.
Ich wollte nichts wie weg, mich irgendwo in Ruhe niedersetzen. Ich taumelte durch die Menge der Neugierigen, die, bemüht mehr zu sehen, gerne Platz machten. Am Ende des Ganges stand ein Mädchen mit weit aufgerissenen Augen. Seine blonden Haare waren zu straffen Zöpfen geflochten, und es wirkte in seinem rosa Trachtenröckchen seltsam unecht. Mir fiel sein Name nicht ein. Das Mädchen war der Kinderstar der Show, aber jetzt kümmerte sich niemand um die Kleine.
„Wo ist denn deine Garderobe?“, fragte ich.
Sie schüttelte nur den Kopf und lief davon.
Zwei Stunden später saß ich in einem der Sitzungszimmer des Fernsehzentrums, beantwortete die Fragen eines Kriminalbeamten und verstand endlich, warum das in Österreich „zu Protokoll geben“ heißt. Es war ein höchst bürokratischer Vorgang, bei dem die Angabe der Adresse zumindest so wichtig zu sein schien, wie das, was ich über den Tod von Downhill-Sepp erzählen konnte.
„Name?“
„Mira Valensky.“
„Können Sie das buchstabieren?“
Ich konnte.
„Beruf?“
„Freie Redakteurin beim Magazin, ich arbeite für das Ressort Lifestyle. Ich war heute Abend hier, um an einer Reportage über das Leben der Superstars …“
Er unterbrach mich. „Geburtsdatum?“
Ich nannte es ihm und verriet ihm, dass ich somit 38 Jahre alt war. Weiters vertraute ich ihm an, dass ich einen Meter zweiundsiebzig groß war, 74 Kilo wog und braune Augen hatte. Okay, beim Gewicht hatte ich etwas geschwindelt, aber 74 hörte sich deutlich besser an als 76, und immerhin hatte ich ja seit ewig nichts gegessen.
Über das Leben der Superstars der volkstümlichen Musik sollte ich berichten, jetzt war einer von ihnen tot. Offenbar Herzversagen. Ich bin kein Fan von Volksmusik. Egal, ob sie „echt“ ist und in originalen Trachten und mit ursprünglichen Instrumenten gespielt wird oder ob sie bloß volkstümlich klingt, verstärkt wird und alles herum auch eher Talmi ist. Aber wenn ich einen Auftrag für eine große Reportage bekomme, nehme ich ihn im Allgemeinen an. Immerhin muss ich von etwas leben, und meine Schildpattkatze Gismo auch.
Mir war klar, dass die Story durch den Tod von Downhill-Sepp noch wichtiger werden würde. Ihn kannte in Österreich jeder, sogar ich. Denn Downhill-Sepp war vor rund zwanzig Jahren Abfahrtsweltmeister geworden. Und bis kurz vor seinem Tod hatte er auch noch sehr fit ausgesehen. Seine Stimme war nicht eben die eines Opernsängers gewesen, aber moderne Tontechnik vermochte so einiges. Ich versuchte, mich an Textpassagen seines Liedes „Die letzte Abfahrt“ zu erinnern, aber mir fiel keine ein. Jedenfalls war Josef Unterholzer, Künstlername Downhill-Sepp, heute zum letzten Mal abgefahren.
„Niemand stirbt einfach so“, sagte der Chefredakteur und blickte Beifall heischend in die Runde. Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Redaktionskonferenz nickten. Auch sie waren Mitte vierzig, und wer will schon wahrhaben, dass man mit Mitte vierzig einfach tot umfallen konnte? Normalerweise versuchte ich, mir Redaktionssitzungen zu ersparen. Der Hauptgrund dafür war, dass sie schon um 9 Uhr begannen. Aber mir ging auch das Ritual auf die Nerven: Die Akteure waren ein Chefredakteur, von seiner Wichtigkeit überzeugt und mit den neuesten Erkenntnissen der allerteuersten Führungskräfteseminare gefüttert, Redakteure, die sich anbiederten, Redakteurinnen, die noch nie etwas gesagt hatten. Storys und Ideen wurden verkauft, und schlussendlich musste es so aussehen, als wären die Themen dem Chefredakteur selbst eingefallen. Dazu kam noch mein alter Freund Droch, Chef des Politikressorts und Zyniker, der heute wieder einmal besonders unausstehlich war. Während ich von der Volksmusiksache erzählte, lächelte er die ganze Zeit über spöttisch. Weil seine Politiker ja um so vieles besser waren …
„Passt bloß auf!“, sagte er. „Wenn Mira über eine Leiche stolpert, gibt sie sich mit Herzversagen nicht zufrieden.“ Als ob ich es mir ausgesucht hatte, dass damals im Wahlkampf der Mediencoach ermordet worden war. Ich wollte schon aufbrausen, lächelte dann aber möglichst süß und erwiderte: „Wirst du mir wieder helfen?“
Droch verzog angeekelt das Gesicht.
Die nächste Ausgabe des Magazins erschien erst in vier Tagen. Der Tod von Downhill-Sepp bestimmte freilich schon heute die Titelblätter der Tageszeitungen.
„Mehr, wir brauchen mehr!“, forderte der Chefredakteur und sah mich eindringlich an.
„Ich habe ihn gefunden, das ist doch gar nicht so schlecht, oder?!“
„Nicht schlecht, zugegeben. Aber wir brauchen die Hintergründe, wir brauchen die trauernde Witwe, die Familie, den Fernsehdirektor, die Todesursache.“
„Und seinen Hund?“
„Und seinen Hund. Einen Rauhaardackel, nicht war?“
Ich hatte keine Ahnung.
„Er hatte einen Setter, der mit dem Rauhaardackel ist Hias.“ Das war Peter, gierig darauf, diese Reportage zu bekommen. Er kannte sich mit diesem volkstümlichen Zeug aus, aber ich brauchte die große Story dringender denn je. Das Minus auf meinem Bankkonto war durch die Anschaffung eines idiotischen multifunktionalen Fitnessgerätes beträchtlich gewachsen. Zweimal hatte ich auf dem Gerät herumgeturnt, jetzt schlief Gismo auf dessen schwarzer Lederbank. Ein teurer Katzenschlafplatz.
„Das Leben und Sterben der Superstars der Volksmusik“, sagte ich.
„Genau!“, sagte der Chefredakteur. „Wenn Sie mir mehr übers Sterben liefern, wird es die Titelgeschichte.“
„Mehr über das Sterben, mehr über das Sterben“, wiederholte ich in Gedanken, als ich wieder am Schreibtisch saß. Im Takt klopfte ich mit dem Kugelschreiber auf meinen Block. Mehr über das Sterben. Mehr, als dass er vor mir tot zusammengebrochen war? Ich konnte mich in allen Einzelheiten an seinen Gesichtsausdruck erinnern. Er hatte wie gewisse tote Fische ausgesehen – ein letztes Luftschnappen, dann nichts mehr, nur große Augen und ein offenes Maul.
Lächelnd und winkend, einer ältlichen Besucherin noch ein Küsschen auf die Wange drückend, hatte er fünf Minuten zuvor die Bühne verlassen und war in seine Garderobe gegangen. Er war zwei Minuten allein in der Garderobe gewesen, maximal. Er hatte mir noch die Türe öffnen wollen, es aber nicht mehr geschafft. Mehr über das Sterben.
Nicht, dass ich von seinem Tod allzu tief bewegt war, aber die Vorstellung, zu seiner Familie zu fahren, alle auszuhorchen, gemeinsam mit einer Schar von sensationsgierigen Medienleuten vor dem Haus zu lauern, erschien mir wenig erstrebenswert. Diesen Teil konnte Peter erledigen. Doch wenn mir der Hauptteil der Story bleiben sollte, musste ich etwas Handfestes liefern.
Ich konnte den Typen von der Kriminalpolizei, diesen Protokollierer, anrufen und ihm unter einem Vorwand, zum Beispiel, dass er vergessen hatte, meine Schuhgröße zu erfragen, neue Informationen entlocken. Haha, Mira! Hauptsache lustig. Verdammt, entweder mir fiel rasch etwas Besseres ein, oder ich musste doch selbst die Familie von Downhill-Sepp aufsuchen. Allein das Haus! Es war in den Frühnachrichten zu sehen gewesen. Eine Monstrosität aus hellem Holz mitten in einem Landschaftsschutzgebiet in den Tiroler Bergen. Neugeschnitztes, Neurustikales, Neureiches – allein für das massive Balkongeländer musste ein ganzer Wald gefällt worden sein. An allen Fenstern gab es Rüschen und Spitzenvorhänge und hinter dem Haus eine grüne Alm und einen hohen, kahlen Berg im Hintergrund und natürlich einen blitzblauen Himmel. Die Blonde, die sich gestern über ihn geworfen hatte, war seine Frau gewesen. Lange blonde Haare, dabei war sie auch schon Mitte vierzig, und die viele Schminke machte das nur noch deutlicher. Echte Trauer? Warum nicht? Nicht alle stehen auf intelligente Männer, und erfolgreich war er jedenfalls. Vielleicht auch ganz sympathisch. Allerdings kursierte das Gerücht, dass er ein Faible für junge Männer hatte. Auch schon etwas. Downhill-Sepp erlag einem Herzinfarkt und war schwul.
Ich würde den Kriminalinspektor, oder was immer er war, doch anrufen. Ich konnte ihm ja sagen, dass ich das Gefühl hatte, irgendetwas Wichtiges übersehen zu haben. Ich müsste daher noch einmal in die Garderobe, das würde mir sicher auf die Sprünge helfen. Ob er darauf eingehen würde?
Peter war mir dankbar und versprach, den Familienteil der Reportage pünktlich zu liefern. „Du bist der Boss“, sagte er und verschwand mit dem Segen des Chefredakteurs nach Tirol. Mir war absolut klar, dass er die erste Chance nützen würde, mir die gesamte Story abzujagen.
Es stellte sich heraus, dass der Polizeibeamte von gestern bloß ein kleines Würstchen war, das zufällig Journaldienst gehabt hatte. Ein Chefinspektor Müller hatte den Fall übernommen, bestritt allerdings, dass es sich überhaupt um einen Fall handelte.
„Routinemäßige Untersuchungen nach einem überraschenden Todesfall, nicht mehr“, nannte er es. Und wenn ich glaubte, noch etwas zu wissen, dann könne ich ihm das auch am Telefon sagen. Es gebe keinen Grund, deswegen noch einmal zum Fernsehsender zu fahren.
„Kennen Sie denn die Todesursache schon?“, fragte ich.
„Das kann ich Ihnen weder in Ihrer Eigenschaft als Augenzeugin noch als Journalistin sagen.“
„Ich frage Sie als Journalistin. Woran ist er gestorben? Glauben Sie, dass Sie das verheimlichen können?“
„Wir verheimlichen gar nichts. Wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind, gibt es eine Pressekonferenz.“
„Also gibt es noch Untersuchungen.“
„Sie können die Schlussfolgerungen ziehen, die Sie wollen.“
„Verzögern Sie die Ermittlungen?“
„Mit Sicherheit nicht.“
„Aber Sie sind an den Dingen, an die ich mich zu erinnern glaube, nicht sonderlich interessiert.“
„Woran glauben Sie sich zu erinnern?“
„Es ist mehr ein Gefühl … aber wenn Sie der Sache konsequent nachgehen, sollten Sie mir die Chance geben, die Garderobe noch einmal zu sehen.“
„Wenn ich Ihnen nicht nachgebe, schreiben Sie, dass wir die Untersuchungen schlampig führen. Wenn ich Ihnen nachgebe, schreiben Sie über das, was Sie als Einzige noch einmal genau sehen konnten. Und dummerweise werden Sie sich dann doch an nichts für die Ermittlungen Interessantes erinnern können.“
„Ich kann Ihnen nicht versprechen …“
„Das habe ich mir gedacht.“
„Was also?“
„Was?“
Meine Güte, der Typ war zäh. „Sind Sie eigentlich von der Mordkommission?“
„Wieso?“
„Also, das wird ja nun wirklich nicht der Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Das kann ich auch …“
„Bin ich nicht. Sonderermittlung.“
„Und was ist so besonders an dem Fall?“
„Ein ehemaliger Abfahrtsweltmeister und Star der volkstümlichen Schlagermusik stirbt plötzlich im Alter von 44 Jahren.“
„Wäre er Briefträger oder Buchhalter gewesen, würden Sie sich also nicht darum kümmern.“
„Sie etwa?“
Eins zu null für ihn.
Wir vereinbarten, uns am nächsten Tag im Fernsehzentrum zu treffen.
„Nur zwei Minuten und nur, weil ich ohnehin noch einmal mit dem Fernsehdirektor reden wollte“, beeilte Müller sich hinzuzufügen.
Den Rest meines Arbeitstages verbrachte ich vor dem Computer. In allen Details beschrieb ich Downhill-Sepps letzten Auftritt in der Show und seinen allerletzten Auftritt, bei dem er mir vor die Füße gefallen war.
In der U-Bahn knurrte mein Magen so laut, dass es schon peinlich war. Der Gedanke an gedämpften Fisch war mir ebenso zuwider wie der an rohe Salate oder gekochtes Gemüse. Selbst Garnelen erschienen mir ohne Knoblauchbutter, Sauce oder Ähnliches schrecklich langweilig. Warum kommt ein Mensch, der so gerne isst und kocht wie ich, auch auf die Idee, zehn Kilo abnehmen zu wollen? Die Sache mit dem multifunktionalen Fitnessgerät hatte ich schon als gescheitert verbucht. Eigentlich fühlte ich mich – abgesehen von meinem Hunger – ausgesprochen wohl. Ich hatte auch bisher mit der Tatsache, dass ich dem klassischen Schönheitsideal nicht vollkommen entsprach, gut leben können. Ein paar Kilo mehr, warum nicht? Besser als magersüchtig und unglücklich.
Ich betrachtete die Gesichter der Menschen im Waggon. Glücklich schienen die wenigsten zu sein. Eine Frau zuckte zusammen und blickte sofort zu Boden, als sie meinen Blick bemerkte. Ein rund fünfzigjähriger Mann in einem billigen Anzug stierte ins Leere. Zwei Frauen redeten leise kroatisch aufeinander ein. Sie wirkten müde, die eine hatte ihren Kopf gegen die Fensterscheibe gelehnt und schloss immer wieder die Augen. Halb acht am Abend. Keine Spur Lebensfreude. Hätte ich gewusst wie, ich wäre sofort ausgewandert. Wien an einem regnerisch-kalten Sommertag ist nur etwas für Depressive und überzeugte Pessimistinnen.
Im Veneto wehte sicher ein lauer Wind, und es hatte 25 oder gar 30 Grad. In einer Stunde könnte ich bei „Armando“ sitzen und eines der unüberbietbaren Spezialmenüs mit mindestens acht Gängen genießen. Zucchiniblüten könnte es geben, frittiert oder mit hausgemachter Pasta. Vielleicht würde er mir auch einige alte venetische Spezialitäten auftischen lassen. Pasta e fasoi zum Beispiel, eine dicke, wunderbar gewürzte Bohnensuppe mit geschnittenen Pastastücken und einem Hauch feinsten Olivenöls. Mir lief das Wasser im Mund zusammen. Ich musste sofort aufhören, daran zu denken. Lächerlich, dass ich nicht genügend Willensstärke aufbrachte, um zehn Kilo abzunehmen.
Die beiden Frauen stiegen aus, eine Horde junger Männer in Lederjacken polterte herein. Große Sprüche, ein wenig Gerempel, laut und harmlos und eben jung. Die Türen gingen zu. Warum abnehmen? Für diese Typen war ich eine alte fette Oma. Nicht, dass ich etwas von ihnen gewollt hätte, aber … vielleicht hatte es doch seine Gründe, warum ich allein war. Seit wann störte mich das? Ich wollte doch alleine leben. Und was hieß da alleine? Ich hatte meine Katze Gismo, eine Reihe guter Freundinnen und Freunde, gar nicht zu reden von meiner Putzfrau Vesna Krajner, die viel mehr war, als bloß eine, die meine Wohnung in Schuss hielt. Sie war keine „Bedienerin“, wie das im Wienerischen heißt, sondern eine Frau, die resolut zupackt – egal, ob es um schmutzige Böden oder schmutzige Geschichten ging.
Auch mit Droch gab es hin und wieder nette Momente. Eine gewisse Zeit hindurch hatte ich sogar den Eindruck gehabt, es könnte mit Droch mehr geben als bloß nette Momente, viele Reibereien und das eine oder andere Abendessen. Aber das war vorbei, und es hatte nichts damit zu tun, dass er im Rollstuhl saß.
Beinahe hätte ich vergessen, an der richtigen Station auszusteigen. Gerade noch rechtzeitig stieß ich die Tür auf und wandte mich in Richtung Aufzug. Du nimmst nicht den Lift, sondern die Stufen, ermahnte ich mich. Ich keuchte nach oben. Jeder keucht, wenn er so viele Treppen steigt und so wenig gegessen hat. Es war also ohnehin alles bestens. Was mir fehlte, war ausschließlich etwas zu essen. Sollte der Kampf gegen die überzähligen Kilos weniger offensichtliche Mängel in meinem Leben überdecken? Wer Hunger hat, denkt nicht daran, dass man einsam ist? Unsinn, ich war nicht einsam, ich lebte bloß allein.
Anderswo hungern und verhungern Menschen, und ich hungerte, nur weil ich in letzter Zeit irgendwie nicht ganz glücklich war. Was hatte meine Figur mit meinem Leben zu tun? Tatsache ist, dass Männer schlanke Frauen anziehender finden. Und solche Typen wollte ich? Danke.
Bettina hatte in der vorletzten Nummer des Magazins über Körpersignale, über Erfolg, Wohlbefinden und Erotik geschrieben und eine Studie zitiert, der zufolge schlanke Menschen nicht nur erfolgreicher waren, sondern sich auch besser fühlten. Am nächsten Tag hatte ich mir das Fitnessgerät gekauft und mit dem Abnehmen begonnen. Rein zufällig natürlich. Schlanke Menschen waren erfolgreicher, weil sie ehrgeiziger waren. Und sie fühlten sich besser, weil ihnen irgendeine vordergründige Ehrgeizbefriedigung ausreichte, um sich gut zu fühlen. So war es. Ja. Ich stürzte zwei Minuten vor Geschäftsschluss in einen Supermarkt, krallte mir das letzte Biobaguette und eine Schachtel sündteurer, köstlicher italienischer Cipriani-Tagliarelle und lief damit beschwingt die zahlreichen Stufen zu meiner Altbauwohnung hinauf.
Meine Katze Gismo gab mir gleich zur Begrüßung zu verstehen, dass auch sie Hunger hatte, und rieb ihren Kopf an meiner rechten Wade. Mitleidlos schob ich sie weg, nahm mein bestes Whiskeyglas, schenkte mir einen Jameson mit einem Tropfen Wasser ein und ließ mich auf einen Stuhl fallen. Gismo maunzte empört, ich trank einen großen Schluck und seufzte glücklich.
Zehn Minuten später hatte Gismo bereits eine Schüssel mit Hühnermägen leer gefressen. Ich stand am Herd, summte vor mich hin und rührte die in Butter und Öl schwimmenden Garnelenschalen um. Daneben schnitt ich junge Zucchini und Melanzani in kleine Würfel. Wunderbar, was man alles aus Gemüse und Meerestieren machen konnte. Ich gab gehackten Knoblauch und etwas Peperoncini in die Pfanne, rührte auf kleiner Hitze gut um und entfernte die Garnelenschalen. Nun kamen die Gemüsewürfelchen dazu, nur zwei Minuten, salzen, dann die Nudeln ins kochende Wasser und zwei weitere Minuten, in denen die Garnelen in der Sauce durchziehen konnten. Es war eine große Portion geworden, aber ich hatte einiges aufzuholen, und immerhin galt es auch, das schreckliche Erlebnis, einen Toten gefunden zu haben, zu verkraften. Ich grinste, aber es sah mich ohnehin niemand. Klar, jeder der tot war, tat mir Leid. Bloß war mir Downhill-Sepp eher wie ein Kunstprodukt als ein Mensch aus Fleisch und Blut erschienen. Ich jedenfalls lebte, und mein Appetit war gut.
Ich öffnete meinen Weinschrank. Jeder Mensch hat so seine Marotten, eine meiner Spinnereien war dieser wundervolle doppeltürige Weinschrank, in dem jeder Wein perfekt gelagert werden konnte und sofort verfügbar war. Ich hatte ihn mir geleistet, als das Magazin meine erste Titelstory gebracht hatte. Auf ein großes Auto konnte ich locker verzichten, auf Luxusgarderobe auch, auf diesen Schrank jedoch nicht. Ich wählte einen Rheinriesling aus dem Weinviertel. Trocken, leicht, fruchtig. Über die Nudeln mit Garnelen und Gemüse streute ich noch etwas Petersilie. Gismo starrte zu mir hoch. Gut, heute war ein besonderer Tag. Ich nahm ein Glas mit schwarzen Oliven aus dem Kühlschrank, und sie begann ganz aufgeregt zu tanzen. Nicht nur ich habe so meine Marotten, auch meine Katze hat welche. Ich legte drei Oliven auf den Küchenboden, und Gismo begann gierig und mit lautem Geschnurre an der ersten zu nagen.
Ich setzte mich mit meinem Essen an den großen Tisch im Wohnzimmer und war mit mir und meinen Kochkünsten überaus zufrieden. Vielleicht sollte ich eine Gastronomiekolumne anstreben, aber da hatte ich kaum eine Chance. Verglichen mit gewissen Gastrokritikern waren Chronik- und Sensationsjournalisten sensible, ausschließlich der hehren journalistischen Ethik verpflichtete Knaben. Nein, Essen und Kochen sollten Vergnügen bleiben. Was meinen Beruf anging … ich genoss Bissen um Bissen und ließ gleichzeitig in Gedanken meinen Blick durch die Künstlergarderobe schweifen. Ich habe kein fotografisches Gedächtnis, aber ich war sehr entspannt und erinnerte mich an viele Details: an die große Dose Haarspray, einige Schminkutensilien, die dunkle Aktentasche, seine Kleider auf dem Kleiderständer und verstreute Notenblätter. Hatte er überhaupt Noten lesen können? Vielleicht hatte er als Kind in der örtlichen Blasmusikkapelle gespielt, das ist auf dem Land nach wie vor keine Seltenheit. Die fensterlose Garderobe war eine der vielen Standardgarderoben im Fernsehzentrum, ausgestattet mit einem großen Spiegel mit Beleuchtung, einem breiten gepolsterten Hocker und einer Couch. War auf der Couch etwas gelegen? Nein, sie war leer gewesen. Teppichboden, ein Kleiderständer, ein Waschbecken. Alles in Weiß und Braun, abgewohnt, schmutzigweiß und schmutzigbraun, obwohl die Garderobe sicher täglich geputzt wurde.
Ich spießte die letzte Garnele auf und tunkte sie ins restlich Öl. Und ich genehmigte mir noch ein Glas Rheinriesling. Wer ein paar Kilo mehr hat, verträgt auch mehr Alkohol.
Irgendetwas war noch in der Garderobe gewesen. Ich war mir sicher. Aber was? Oder ging ich jetzt schon meiner eigenen Geschichte, die ich mir für den Polizeibeamten ausgedacht hatte, auf den Leim? Ich lehnte mich zurück, beschloss, für heute das Denken sein zu lassen, und schaltete den Fernseher ein.
Unglaublich schlanke Frauen mit glücklichen Gesichtern warben für Tampons, Putzmittel und Schokolade. In einem Spot wurde vor Medikamentenmissbrauch gewarnt. Man sah ein Waschbecken mit Fläschchen und Schächtelchen. Eine Frau, die zwar schlank war, aber nicht sehr glücklich wirkte, nahm von da und dort eine Tablette und schluckte sie gierig. Der Spot hatte für ziemliche Aufregung gesorgt. Die Pharmaindustrie hatte der Gesundheitsministerin vorgeworfen, die Hysterie gegen Medikamente zu schüren und damit Krankheit und Tod vieler Menschen heraufzubeschwören. Ich weiß nicht, wen ich weniger mag: die Pharmaindustrie oder die Gesundheitsministerin.
Mein Vater war lange Jahre Landesrat gewesen. Jetzt ist er in Pension, aber einmal Politiker, immer Politiker. Nun leitet er den Pensionistenverband. Meine Skepsis gegenüber Politik reicht weit in meine Kindheit zurück. Und dass ich im letzten Präsidentschaftswahlkampf die ganze Bandbreite politischer Möglichkeiten von Strahlelächeln bis Mord hautnah hatte miterleben dürfen, hatte mein Politikerbild nicht eben verbessert.
Das Waschbecken. Das war es. Es war etwas mit dem Waschbecken gewesen. Das hatte ich übersehen. Am Waschbecken der Garderobe waren ein Wasserglas, ein Tablettenfläschchen und eine Medikamentenschachtel gestanden. Aspirin war es nicht gewesen, diese Verpackung kannte ich. Die Schachtel war überwiegend weiß gewesen. Offenbar hatte Downhill-Sepp irgendwelche Medikamente genommen. Das war immerhin ein Ansatzpunkt. Ich würde Müller erzählen, was mir da eben eingefallen war. Nicht, dass die Medikamente von der Spurensicherung hätten übersehen werden können. Aber ich hatte mich nicht mehr an sie erinnert. Es würde nicht einfach sein, aber ich wollte versuchen herauszubekommen, welche Medikamente das gewesen waren, die der singende Naturbursch geschluckt hatte.
Meine Verblüffung war nicht gespielt. Ich stand mit Chefinspektor Müller in der Garderobe, wollte ihm eben sagen, was meine Irritation ausgelöst hatte, blickte zum Waschbecken, und da waren weder ein Wasserglas noch Medikamente zu. „Sie haben sie mitgenommen“, sagte ich.
„Was?“
„Die Medikamente. Um sie zu untersuchen.“
„Welche Medikamente?“
„Zugegeben. Es ist mir schon gestern Abend wieder eingefallen. Am Waschbecken standen ein Wasserglas und Medikamente, ein Fläschchen und eine Schachtel.“
„Wenn Sie auf diese Tour herausfinden wollen, ob er etwas genommen hat – nicht mit mir.“
„Ich habe ohnehin nicht erkannt, welche Medikamente es waren. Aber sie waren da.“
„Sie täuschen sich. Keine Medikamente, kein Glas. Wir haben den Tatort … den Unglücksort natürlich erkennungsdienstlich behandelt und alles fotografiert.“
„Tatort?“
„Normalerweise ermittle ich eben an einem Tatort, da kann einem das Wort schon herausrutschen.“
„Sie haben keine Medikamente gefunden?“
„Nein.“
„Als ich gestern zur Türe hereinkam, waren sie aber noch da.“
„So ein Zufall! Zuerst fallen Ihnen die Medikamente gar nicht auf, dann haben Sie auf einmal so eine Ahnung, und gestern Abend schießt Ihnen alles wieder ein. Das hat sicher gar nichts mit Ihrer Story fürs Magazin zu tun. Oder?“
„Ich bin mir jetzt absolut sicher, da waren Medikamente. Fragen Sie seinen Manager, seine Frau. Er hat sie sicher nicht nur gestern genommen.“
„Ich werde sie fragen.“
„Das ist alles?“
„Was wollen Sie mehr? Ich nehme Sie sogar so ernst, dass ich fragen werde. Danach fragen wir übrigens ohnehin immer.“
„Und?“
„Ich werde erst fragen. Aber unser Pathologe hat das wohl ohnehin schon vorab geklärt. Egal, was die Medien schreiben, wir verstehen schon etwas von unserem Geschäft.“
„Und die Todesursache?“
„Die Pressekonferenz findet übermorgen statt.“
„Nicht alle Medikamente sind nachweisbar.“
„Sie spinnen sich da eine Geschichte zusammen.“
Ich sah mich noch einmal genau um. Alles andere war so, wie ich es in Erinnerung gehabt hatte. Dann ging ich zur Türe und sagte einigermaßen theatralisch: „Wenn ich Ihnen also nicht weiterhelfen kann …“
Chefinspektor Müller wurde zum ersten Mal menschlich und grinste, wahrscheinlich weil die gute Chance bestand, mich gleich los zu werden. „Können Sie nicht, trotzdem: Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!“ Das klang ganz schön ironisch. Ich rauschte hinaus und verirrte mich prompt im Labyrinth der Gänge des Fernsehzentrums. Ich wollte schnellstens hinaus und den Manager von Downhill-Sepp anrufen. Beinahe wäre ich am Regieassistenten vorbeigelaufen.
„Welche Medikamente hat Downhill-Sepp genommen?“, fragte ich ihn ansatzlos.
„Ich darf der Presse nichts sagen.“
„Ich habe die Medikamente gesehen. Ich weiß also, dass er welche genommen hat, ich kann’s mir auch zusammenreimen.“
„Es war nichts Schlimmes.“
„Jedenfalls keine Kopfwehpulver.“
„Viele nehmen sie, aber das kann nichts mit seinem Tod zu tun haben. Er war nicht krank und hat sie auch sicher nicht immer genommen. Nur vor großen Auftritten, zumindest bei uns. Und vor der Hauptprobe. Dabei ist doch eh alles Playback. Aber er war eben nervös.“
„Also waren es Beruhigungsmittel?“
„Nein! Betablocker. Damit wird die Herzfrequenz verlangsamt, der Blutdruck kann nicht unendlich steigen, man bekommt kein Herzrasen oder so etwas.“
„Und er stirbt an Herzversagen.“
„Das hat damit sicher nichts zu tun. Das hat auch unser medizinischer Betreuer gesagt.“
„Sie haben ihn gefragt?“
„Ich sage nichts mehr.“ Unruhig sah sich der junge Mann nach einem Fluchtweg um.
„Welcher medizinische Betreuer?“
„Aber von mir haben Sie das nicht. Wir haben für eine Arztserie einen medizinischen Betreuer. Einen Fachmann eben. Er war gerade zufällig da. Und wir haben ihn gefragt, ob wir der Polizei sagen müssen, dass er hin und wieder solche Mittel genommen hat. Und vielleicht auch etwas zum Entspannen. Aber der Arzt hat gemeint, wenn er sie nicht aus Krankheitsgründen genommen hat, dann können sie eigentlich nichts damit zu tun haben.“
„Und Sie haben die Medikamente weggeräumt.“
„Nein, haben wir nicht. Natürlich nicht. Ich weiß nicht, wo sie sind, wir haben nur entschieden, dass sie für die polizeilichen Ermittlungen nicht von Bedeutung sind.“
„Und was wäre dabei gewesen, es der Polizei zu erzählen und diese entscheiden zu lassen?“
„Imagegründe.“ Der Regieassistent sah jetzt so wichtig drein, dass mir völlig klar war: Dieses Argument war nicht auf seinem Mist gewachsen. Aber es war schon etwas dran. Zünftige volkstümliche Schlagermusik und Beruhigungspillen passen nicht gerade gut zusammen. Bier ja oder fettes Schweinefleisch und danach Schnaps. Aber Tranquilizer oder Betablocker gehören eher zu dem, was mein Großvater immer als „Negermusik“ bezeichnet hatte. Betablocker waren einfach nicht volkstümlich genug.
Bevor mir der Regieassistent entkommen konnte, packte ich ihn am Ärmel. Er sah mich erschrocken an.
„Wie komme ich da hinaus?“
Erleichtert zeigte er mir den Weg und ging mit schnellen Schritten davon.
Downhill-Sepp hatte also Betablocker genommen. Ich hatte die Medikamente gesehen. Wenn man dem Chefinspektor glauben konnte, waren sie und das Glas vor dem Eintreffen der Spurensicherung verschwunden. Dutzende Menschen hatten sich vor der Garderobe gedrängt. Aber um in den Raum zu kommen, war jeder gezwungen gewesen, über Downhill-Sepps Beine zu steigen. Der stellvertretende Fernsehdirektor, seine zwei Mitarbeiterinnen, Polizeibeamte und Downhill-Sepps Frau waren in der Garderobe gestanden. Aber was hätte es schon ausgemacht, wenn die Medikamente gefunden worden wären? War dem Fernsehdirektor das Image so wichtig, dass er mögliches Beweismaterial verschwinden ließ?
Vergiftet hatte Downhill-Sepp nicht ausgesehen. Ich stelle mir Vergiftete eher mit Schaum vor dem Mund vor, dramatisch verkrampft und womöglich von einem leichten Bittermandelgeruch umgeben. Wie kommt man heute schon an Gifte wie Arsen und Zyankali? Da sind Beruhigungsmittel weit einfacher zu beschaffen. Wie viele Betablocker muss man schlucken, um daran zu sterben?
[ 2. ]
Am Nachmittag traf ich mich in einem Kaffeehaus in der Wiener Innenstadt mit drei der fünf Frohsinn-Mädel. Der Termin war schon vor einer Woche fixiert worden. Die fünf Frohsinn-Mädel waren so etwas wie eine Institution der volkstümlichen Musikszene. Es hatte sie schon gegeben, als ich noch ein Kind gewesen war. Wer aber glaubt, dass es sich bei dieser Gruppe um durchwegs ältliche Mädchen handelte, täuscht sich. Nur der Agent der Frohsinn-Mädel war von Anfang an mit dabei. Er hatte immer auf eine behutsame Verjüngung gedrängt. Alle paar Jahre wurde das jeweils älteste Mädel durch ein deutlich jüngeres ersetzt. Und er war klug genug, der mittleren Generation ihre Identifikationsmädel zu lassen.
Der Manager machte mich mit den drei Sängerinnen bekannt und verschwand dann zu einem offenbar wichtigeren Termin. Wir ließen uns in einer der plüschigen Nischen nieder. Frau Klein war mit ihren vierzig Jahren momentan die Älteste, Frau Handlos etwa in meinem Alter, und das dritte der zum Gespräch erschienenen Mädel schätzte ich auf fünfundzwanzig. Statt ihrer Bühnendirndlkleider mit tiefem Ausschnitt und hoch geschnürtem Busen trugen sie Röcke und Blusen, die Jüngste einen violetten Hosenanzug. Sie sahen wie adrette Büroangestellte aus, nicht wie Superstars der Volksmusik. Was hatte ich erwartet? Dass sie sich mit einem Jodler auf mich stürzen würden?
„Schlimm, was mit dem Sepp passiert ist“, sagte Frau Klein. „So jung.“
„Naja“, meinte die Jüngste, „er hat sich immerhin schon die Haare färben lassen.“
„Über Tote sagt man nichts Böses.“
Ich fragte die drei über ihre Pläne aus, über ihr Leben, und es kamen Antworten, die sie mit Sicherheit schon häufig gegeben hatten. Sie liebten ihre Musik und führten ein ganz normales Leben. Vier von fünf waren verheiratet und hatten Kinder. Das viele Geld, das sie verdienten, sei ihnen nicht das Wichtigste, und so viel werfe die Sache auch wieder nicht ab. Sie wären jedenfalls zufrieden. Der Stress der Tourneen ließe sich zu fünft gut durchstehen, zwischen guten Freundinnen gäbe es eben immer viel zu lachen.
Ich glaube nicht an Idyllen. Wahrscheinlich wäre es besser, ich würde mich mit einer von ihnen zu einem Einzelgespräch treffen.
„Nehmen Sie vor Ihren Auftritten auch irgendwelche Beruhigungsmittel, Betablocker oder so ein Zeug?“
Die Mittlere lachte etwas schrill. „Wenn ich aufgeregt bin, trinke ich vielleicht einen kleinen Schnaps, aber nur einen kleinen, und normalerweise bin ich gar nicht aufgeregt.“
„Es ist ja nicht verboten, solche Medikamente zu nehmen“, sagte ich.
„Betablocker sind keine Beruhigungsmittel, sondern Herzmittel. Er hat welche genommen, nicht wahr?“ Das war wieder die Jüngste. „Und es war auch kein Wunder, dass er Herzklopfen gehabt hat. Sich mit einer solchen Stimme auf die Bühne zu trauen … gut, das meiste ist eh Playback, aber trotzdem. Er hat überhaupt keine Ahnung von Musik gehabt. Ich mache Volksmusik, seit ich drei war.“
„Sei doch ruhig!“, zischte Frau Klein.
„Sie dürfen aber nicht schreiben, dass ich das gesagt habe. Aber es ist einfach ungerecht, dass er, nur weil er ein berühmter Skifahrer war, als Supermusiker gilt. Das ist er wirklich nicht. Dabei verdient er Millionen, Millionen sage ich.“
„Verdiente“, verbesserte ich sie.
Sie stutzte. „Ja, das mit seinem Tod tut mir natürlich trotzdem Leid. Aber viele Freunde hatte der nicht mehr. Früher, da war er noch nett und überhaupt nicht arrogant. Aber in der letzten Zeit hat er abgehoben, alles was recht ist.“
„Das dürfen Sie natürlich auch nicht zitieren“, stellte Frau Klein klar.
Ich nickte und fragte: „Haben Sie eine Idee, woran er gestorben sein könnte?“
„An Herzversagen“, sagte sie mit fester Stimme, „ich denke, das steht fest.“
„Als ob der ein Herz … und gesehen hat er auch schon schlecht. Und er hat blau gefärbte Haftschalen benutzt“, empörte sich die Jüngste.
Daher also die unglaublich blauen Augen. Alles Talmi.
Das mittlere der Frohsinn-Mädel hatte unterdessen begonnen, mir von der nächsten Super-Sommer-Hitparade der Volksmusik zu erzählen. „Ab übermorgen sind wir wieder im Studio. Hinter solchen Shows steckt eine Menge Arbeit.“
Ich nickte. Dann würden wir einander also in ein paar Tagen wieder sehen. Der Fernsehsender hatte beschlossen, trotz des Todes von Downhill-Sepp mit der wöchentlichen Hitparade weiterzumachen. Immer am Samstag im Hauptabendprogramm, acht Sommerwochen hindurch hohe Einschaltziffern. „Downhill-Sepp hätte es so gewollt, es passiert ganz in seinem Sinn“, hatte der Fernsehdirektor mit beinahe brechender Stimme in den Frühnachrichten verkündet. Und im Sinn des Unternehmens. Wie hätte man auch auf die Schnelle einen Ersatz für einen solchen Quotenschlager finden können?
Herzversagen. Das war die offizielle Todesursache, verkündet von Chefinspektor Müller, im Beisein des zuständigen Pathologen und des Sicherheitsdirektors. Kamerateams, Fotografen, Journalistinnen und Redakteure drängten sich, um Näheres über den Tod von Josef Unterholzer zu erfahren. Aber viel mehr gab es nicht zu hören. Eine leichte Schwäche des Herzmuskels war festgestellt worden, an sich kein Grund für Herzversagen. Aber die Anstrengungen in den letzten Wochen seines Lebens und die Aufregung während der Show hätten dann wohl doch dazu geführt.
Ein junger Redakteur fragte Müller: „Wurde er auf Gifte hin untersucht?“
„An welche Gifte denken Sie?“
„Ich weiß nicht …“
„Ja, wir haben ihn auf die gängigen Gifte hin untersucht, das gehört zur Routine.“
Jetzt meldete ich mich zu Wort. „Haben Sie Spuren von Medikamenten entdeckt?“
„Wonach hätten wir suchen sollen?“ Die Gegenfragen des Chefinspektors gingen mir auf die Nerven.
„Zum Beispiel nach Beruhigungsmitteln.“
„Die hätten ja wohl einem Herztod entgegengewirkt. Wir haben jedenfalls keinerlei Spuren gefunden, die mit dem Tod von Josef Unterholzer in Verbindung zu bringen wären. Er ist eines tragischen, aber natürlichen Todes gestorben.“
Für mich hörte sich das so an, als ob in der Autopsie sehr wohl Medikamentenspuren festgestellt worden wären, aber ich wollte nicht weiterbohren. Sonst wäre noch die ganze Meute auf dumme Ideen gekommen. Ich musste die Story noch heute schreiben. Und sie war noch ziemlich dünn.
Die Titelgeschichte lautete schlussendlich: „Starb Downhill-Sepp den Drogentod?“ Das Coverfoto zeigte den Volksmusiker mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund – offensichtlich singend. Mir war das Ganze entsetzlich peinlich. Gut, ich hatte die Sache mit den Medikamenten etwas aufgeblasen. Ich berichtete von mysteriösen Medikamenten, die jedoch vor den polizeilichen Ermittlungen verschwunden waren. Ich erzählte von Kriminalbeamten, die mir zumindest ausweichende Antworten gegeben hatten. Aber die Schlagzeile auf dem Cover war nicht von mir, und ich hatte davon auch nichts gewusst. Eigentlich sollte ich sofort kündigen. Protestieren und kündigen. Wozu kündigen? Ich hatte schließlich keinen Dienstvertrag, sondern war eine so genannte fixe Freie, die pro Auftrag bezahlt wurde. Ich brauchte bloß nicht mehr zu erscheinen. Und dann? Wahrscheinlich habe ich einfach einen miesen Charakter. Ich sandte dem Chefredakteur eine E-Mail-Nachricht, in der ich mich über die Vorgangsweise beschwerte. Keine direkte Konfrontation. So macht man das heutzutage.
Die ursprünglich geplante große Story über das Leben der Stars der Volksmusik sollte es übrigens neben der aktuellen Berichterstattung immer noch geben. Nur dass die Story jetzt vom Leben und Sterben der Stars handeln sollte. Gut für mein Konto, schlecht für meine Nerven. Drei Tage im Fernsehzentrum, Proben und die anschließende Liveshow lagen vor mir, und alle würden glauben, dass ich das Titelblatt verbrochen hatte. Das würde für ein nettes Gesprächsklima sorgen. Die Vorstellung, weiterhin dieser Art von Musik ausgesetzt zu sein, tat ein Übriges, um meine Stimmung auf einen Tiefpunkt zu bringen.
Wenn wenigstens Vesna Krajner da gewesen wäre. Aber meine Putzfrau machte Urlaub in Bosnien. Vesna hätte es sicher geschafft, über ihre bosnischen Putzfrauenconnections eine Raumpflegerin aufzutreiben, die im Fernsehzentrum arbeitete. Und die hätte vielleicht mehr über die Medikamente erzählen können. Was wollte ich überhaupt noch mit den Medikamenten? Downhill-Sepp war von Amts wegen eines natürlichen Todes gestorben. Strich drunter. Das Begräbnis in den Tiroler Bergen würde sicher eindrucksvoll werden. Aber warum waren die Medikamente verschwunden?
Ich verstaute meinen Timeplaner und das Handy in der Handtasche, aktivierte den Anrufbeantworter und stand auf, um heimzugehen. Da klingelte das Telefon. Die konnten mich. Doch es war wie immer: Ich war einfach zu neugierig, um es klingeln zu lassen. Also warf ich die Tasche auf den Tisch und hob ab.
„Ich wollte Ihnen nur zu Ihrem Artikel gratulieren“, sagte eine Männerstimme.
„Danke. Mit wem spreche ich?“
„Pardon. Siegbert Heinrich.“ Er machte eine eindrucksvolle Pause.
Offenbar sollte mir sein Name ein Begriff sein. Ich kannte ihn aber nicht und sagte daher noch einmal: „Danke!“
„Heinrich. Ich moderiere die Volksmusiksendung im Radio. Mit echter Volksmusik.“
„Ah, ja.“
„Sie haben völlig Recht, die Geschichte dieses Downhill-Sepp hat es wieder einmal gezeigt. Es geht nur ums Geschäft. Mit Kunst hat das nichts zu tun, mit Kultur auch nicht. Manager, Millionen, Beruhigungsmittel, Drogen. Die echten Volksmusikanten brauchen fast immer noch einen anderen Beruf, um überhaupt leben zu können. Haben Sie das gewusst? Was das Fernsehen hier betreibt, ist totale Volksverblödung. Höchste Zeit, dass das einmal ans Licht kommt.“
Einer, der die Wahrheit für sich gepachtet hatte. Das auch noch.
„Wenn Sie an Volksmusik interessiert sind, kommen Sie zu unserem Festival im Waldviertel. Hier gibt es Weltmusik. Einheimische Weltmusik. Ohne dieses ganze verlogene volkstümelnde Getue. Echte Künstler. Echte Instrumente. Echte Musik.“
„Danke, ich werde es mir überlegen.“
„Es wäre schön, wenn gerade Ihr Blatt …“