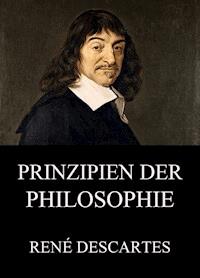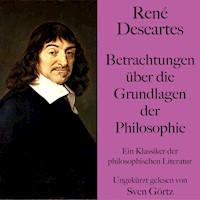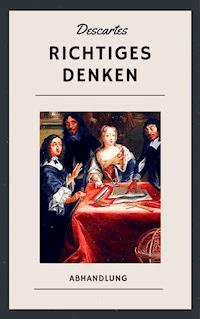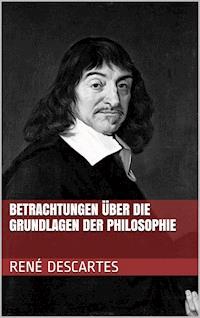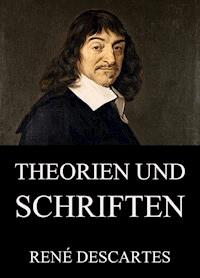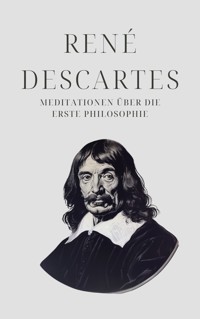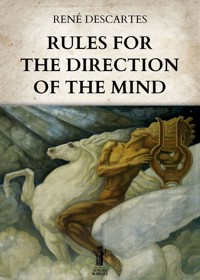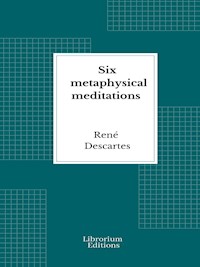14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die den Beginn neuzeitlicher Philosophie und Naturwissenschaft markierenden Lehren des René Descartes sind geprägt vom Pathos der Aufklärung und lassen Herkunft und Eigenart abendländischer Erkenntnishaltung deutlich erkennen. Auch wenn seine Metaphysik der Vergangenheit angehört, so fordert der Denker und Theoretiker exakter Forschung doch bis auf den heutigen Tag zu Diskussionen heraus. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Ähnliche
René Descartes
Ausgewählte Schriften
FISCHER Digital
Ausgewählt und mit einer Einleitung versehen von Ivo Frenzel
Inhalt
Einleitung
»Meine Absicht hat sich nie weiter erstreckt als auf den Versuch, meine eigenen Gedanken zu reformieren und auf einem Grunde aufzubauen, der ganz in mir liegt.« Descartes, der mit der Attitüde solcher Bescheidenheit im ›Discours‹ seine Lehre vorlegt, hat in Wahrheit das philosophische Denken überhaupt reformiert. Mit der Heraufkunft der cartesischen Philosophie hat die Scholastik am Beginn der Neuzeit ihren entscheidenden Gegner gefunden, der der traditionellen Metaphysik des Mittelalters den Kampf ansagt und das Ende der scholastischen Ontologie einleitet. Über die Entschiedenheit dieser Gegnerschaft und über die Radikalität des Neuanfangs ist kein Zweifel möglich; Respekterweise vor der kirchlichen Autorität, die sich bei Descartes ebenso häufig finden wie jener zitierte Satz über den rein privaten Charakter seines Denkens, sind Ausflüchte eines Philosophen, der persönlich die Inquisition zu fürchten hatte, Vorsichtsmaßregeln, von denen sich schon die hellhörigen Zeitgenossen nicht täuschen ließen. Gegen die Meinung, der in den entscheidenden Jahren seines Schaffens völlig zurückgezogen meditierende Edelmann habe nur für sich und am Leben vorbei philosophiert, spricht nicht nur das Ausmaß seiner gelehrten Korrespondenz, sondern sein Werk selbst. Descartes, der der Ansicht ist, daß sehr viele Menschen fraglos sehr viel klüger seien als er selbst, vertritt zugleich die Meinung, daß der ›bon sens‹, der gesunde Menschenverstand, die bestverteilte Sache der Welt sei und es mithin allen Menschen möglich sein müsse, zu sicheren und wahren Urteilen über die Dinge dieser Welt zu gelangen, sofern sie nicht nur Verstand haben, sondern ihn auch auf die rechte Weise gebrauchen könnten. Denn es genügt, »gut zu urteilen, um gut zu handeln«: Dieses Credo und die Einsicht, daß der Grund für alles Urteilen in den Menschen selbst liegen müsse, bedingt das Ethos der in Wahrheit auf einen universalen Anspruch zielenden cartesischen Philosophie.
Die historische Wirkung dieses Denkens ist vergleichbar nur mit der eines Platon, Aristoteles, Thomas, Kant und Hegel. Die Tatsache, daß mit Descartes die neuzeitliche Philosophie beginnt, wäre schon Grund genug, die Beschäftigung mit seinen Texten als unerläßlich anzusehen für die Erziehung philosophierender Menschen. Darüber hinaus hat aber Descartes, dessen ›System‹ im ganzen längst der Vergangenheit angehört, als erster die Eigentümlichkeiten unserer wissenschaftlichen Erkenntnishaltung bewußt gemacht. So ist er zum grundlegenden Theoretiker der modernen Wissenschaft in der Epoche ihrer Entstehung geworden, dessen Einsichten auch heute noch überall dort, wo methodisch und kritisch Forschung betrieben wird, diskussionswürdig sind.
In dem Maße, wie der Fortschritt der Wissenschaften im Hinblick auf die menschliche Daseinsbewältigung fragwürdig wurde, haben die cartesischen Einsichten erbitterte Gegner gefunden. Der Anti-Cartesianismus in der Philosophie ist heute sehr allgemein und besonders in Deutschland in den letzten Jahrzehnten herrschend geworden. Der Protest irrationalistischer Denker gegen Descartes gehört freilich zur Tradition der deutschen Philosophie: Hamann, Herder, Nietzsche können als typische Vertreter dieses Protests gelten. Die scientifische Philosophie hingegen hat sich noch bis zum ersten Weltkrieg gern auf Descartes berufen. Franz Brentano und die Neu-Kantianer Cohen, Natorp, Cassirer und ihr Schüler Heimsoeth, schließlich Edmund Husserl wußten, was die Philosophie dem Werke des Cartesius verdankt. »Sind wir in dieser Gegenwart nicht in einer ähnlichen Situation, als welche Descartes in seiner Jugend vorgefunden hat? Ist es also nicht an der Zeit, seinen Radikalismus des anfangenden Philosophen zu erneuern … Ist nicht am Ende die Trostlosigkeit unserer philosophischen Lage darauf zurückzuführen, daß die von jenen Meditationen ausstrahlenden Triebkräfte ihre ursprüngliche Lebendigkeit eingebüßt haben … weil der Geist des Radikalismus philosophischer Selbstverantwortlichkeit verlorengegangen ist?« Husserls beschwörende Worte haben bei seinen Nachfolgern wenig Widerhall gefunden. Mit Heideggers »Sein und Zeit« setzt die jüngste Phase der Descartes-Auseinandersetzung in der deutschen Philosophie ein. Das von Heidegger inaugurierte Denken läßt sich als dezidiert anti-cartesianisch bezeichnen. Berief sich Husserls Phänomenologie noch auf die cartesische Idee einer rationalen Welt mit einer systematischen, sie beherrschenden, rationalen Wissenschaft, so wird der methodische Sinn phänomenologischer Deskription bei Heidegger als »Auslegung« begriffen, was heißen soll, daß »Hermeneutik in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes« mit einer »Phänomenologie des Daseins« gleichgesetzt wird. Diese gewinnt ausdrücklich ihren Ansatz in der Gegenorientierung an Descartes, genauer gesagt in Heideggers Abhebung der Analyse der Weltlichkeit gegen die Interpretation der Welt bei Descartes. In der Nachfolge Heideggerschen Denkens ist – ungeachtet oft sehr weitgehender Differenzen in der Schülergeneration – an dieser ursprünglichen Gegenorientierung festgehalten worden. Der damit in Deutschland zur Herrschaft kommende Anti-Cartesianismus hat aber gerade von seiten der hermeneutisch orientierten Philosophie nicht zu einer durchgreifenden Neuinterpretation Descartes’ geführt. Was seitdem zur Situation neuzeitlichen Denkens von dorther gesagt worden ist, beruht auf der Voraussetzung der Descartes-Kritik in »Sein und Zeit«, die auch außerhalb der von Heidegger beeinflußten Philosophie zu den am wenigsten angefochtenen Partien in Heideggers Werk zu rechnen ist. Für Heidegger selbst gilt, daß sein Anti-Cartesianismus einen Grundzug seines ganzen Denkens bis ins Spätwerk hinein bildet. Die unversöhnliche, ins Weltanschauliche gesteigerte Kritik zeigt sich auch in Heideggers Aufsatz »Überwindung der Metaphysik«: »Die Verwüstung der Erde beginnt als gewollter, aber in seinem Wesen nicht bewußter und auch nicht wißbarer Prozeß zu der Zeit, da das Wesen der Wahrheit sich als Gewißheit umgrenzt, in der zuerst das menschliche Vorstellen und Herstellen seiner selbst sicher wird.« Eine solche Aussage zeigt typisch ein Hauptmoment der anti-cartesianischen Kritik: die Abwertung des mit Descartes einsetzenden kritisch-rationalen Denkens und damit die Herabsetzung des neuzeitlichen Wissenschaftsgedankens. Ähnlich versteht Jaspers in Descartes eine »der gefährlichen Gestalten, welche mit der zündenden Anregung doch zugleich immer zu Abgleitungen verführen«.
Diese Haltung Descartes gegenüber gibt zu denken. Sie fordert eine kritische Erörterung ihrer Motive um so mehr heraus, als in der weiteren Versteifung heutiger Kritik an Descartes diesem geradezu die Verantwortung für die Profanität der modernen Welt und damit für die »Ursünde« neuzeitlichen Denkens zur Last gelegt wird. Diese Aufgabe und die damit verbundene Neuinterpretation des cartesischen Werkes muß in kommenden Jahren um so mehr geleistet werden, als die physikalischen Diskussionen über die Lage in der Quantentheorie neue Einwände gegen den cartesianischen Wissenschaftsgedanken gebracht haben. So hat etwa Heisenberg versucht, am Modellfall der modernen Physik die Ergebnisse einiger wichtiger philosophischer Systeme nachzuprüfen, die freilich für einen sehr viel weiteren Anwendungsbereich als den der Physik gedacht waren. Hinsichtlich der Philosophien von Descartes und Kant kommt Heisenberg dabei zu folgendem Schluß: »Alle die Begriffe und Worte, die sich in der Vergangenheit durch das Wechselspiel zwischen der Welt und uns selbst gebildet haben, sind hinsichtlich ihrer Bedeutung nicht wirklich scharf definiert. Damit ist gemeint: Wir wissen nicht genau, wie weit sie uns dazu helfen können, unseren Weg durch die Welt zu finden. Oft wissen wir, daß sie in einem sehr weiten Bereich innerer und äußerer Erfahrung angewendet werden können, aber wir wissen niemals ganz genau, wo die Grenzen ihrer Anwendbarkeit liegen … Daher wird es niemals möglich sein, durch rationales Denken allein zu einer absoluten Wahrheit zu kommen.« Die Antwort der modernen Physik auf Descartes kommt nun freilich aus einem ganz anderen Bereich als die Kritik der Existenzphilosophie. Dennoch gälte es auch hier, die weiterwirkende Fruchtbarkeit einzelner cartesischer Einsichten zu bedenken und Descartes gegen seine vermeintliche Überholtheit in Schutz zu nehmen. Das kann selbstverständlich nicht in der Form einer Verteidigung des unwiderruflich vergangenen metaphysischen Systems geschehen, wohl aber in der Herausarbeitung jener Thesen, deren bleibende Bedeutung unter der Trümmerschicht des Systems verborgen liegt. Der Descartes der ›Regulae‹ und der ersten Partien des ›Discours‹ muß uns deshalb heute wichtiger erscheinen als der Metaphysiker des ›Cogito ergo sum‹ und der Zwei-Substanzen-Lehre.
Descartes’ bleibende Leistung ist vor allem im methodologischen Ansatz seiner Philosophie zu sehen. Die ›Regulae ad directionem ingenii‹ belegen diesen Ausgangspunkt cartesischen Denkens, dessen ursprüngliche Intentionen hier noch am unmittelbarsten greifbar werden. »Nie und nirgends noch in der Philosophie der christlichen Völker war mit solcher Energie nach einem festen, von aller Autorität freien Angelpunkt der Erkenntnis gestrebt worden, als es hier geschah.« (Vorländer.) In einem auf Kant vorausweisenden Sinne stellt Descartes die Frage nach der Möglichkeit und den Grenzen menschlicher Erkenntnis. Die Frage, wie man in den Wissenschaften zu wahren und begründeten Urteilen (und das heißt für ihn: zu einem zweifelsfrei sicheren Wissen) gelangen kann, stellt die Aufgabe, kritisch festzustellen, was wir überhaupt wissen können. Descartes faßt deshalb »in einer einzigen Frage zusammen, was menschliche Erkenntnis sei und wieweit sie sich erstrecke«. Nichts läßt sich eher erkennen als der Verstand selbst (intellectus), »da von ihm die Erkenntnis aller anderen Gegenstände (res) abhängt und nicht umgekehrt«. Damit ist nicht nur der Vorrang der gnoseologischen Ordnung vor der ontologischen bezeugt, sondern gefordert, daß der erste Gegenstand der Erkenntnis das Erkennen selbst sein müsse. Es wäre müßig, sich an die »Geheimnisse der Natur, den Einfluß der Gestirne auf die Welt, die Vorausbestimmungen der Zukunft und dergleichen« heranzuwagen, ohne zuvor die Grenzen des Geistes (ingenii limites) zu bedenken.
Da Wahrheit und Irrtum »allein dem Verstande entstammen«, muß aus ihm selbst auch die Begründung des Wissens herzuleiten sein. Daß der menschliche Verstand aber stets ein und derselbe bleibt, ist am Beginn der ›Regeln‹ ausdrücklich festgehalten. Da er allein zur Erkenntnis fähig ist, sind seine Prinzipien zugleich Bedingungen des Wissens, das sich als »cognitio certa et evidens« bestimmt. Das aber heißt: die kritische Begründung des Wissens ist immer dieselbe, ohne Ansehen dessen, was als Gewußtes Inhalt des Wissens wird. Das, was man »einmal im Leben« zu tun hat, tut man damit zugleich ein für allemal: hat man nur erst erforscht, was als Wissen zu gelten hat und woran sich das Erkennen halten muß, um zum Wissen zu gelangen, so sind die Wegzeichen verläßlich gesteckt, nach denen man sich guten Gewissens richten kann.
Dieses »Einheitsgesetz der Erkenntnis« (Heimsoeth) kann die Vernunft aus sich selbst herleiten. Es ist ihr eigenes Prinzip, das sie an sich selbst entdeckt und dem sie sich bewußt zu unterwerfen hat. Die ›Vorschriften‹, die Descartes fordert, um »die Vernunft« gut zu leiten«, sind also nicht äußere methodische Richtlinien, sondern rein innergesetzlicher Natur. In diesem Sinne spürt Descartes den »wurzelhaften Grundlagen der menschlichen Vernunft« nach und stößt dabei zunächst auf einige »offenbar unserem Geiste eher eingeborene als kunstvoll zubereitete Vorschriften«. So bekunden die ›Regeln‹ als Grundzug cartesischen Denkens die Überzeugung der Regelhaftigkeit alles Erkennens. Denn die ›praecepta‹ sind solche, die die Vernunft von sich aus immer schon hat, die sich jeder Mensch aber einmal bewußt zu eigen machen muß.
Beachtet man sie, so darf man gewiß sein, daß einem »kein Wissen durch einen Mangel des Geistes oder der eigenen Fertigkeit versagt bleiben wird und daß kein Mensch dort irgend etwas wissen kann«, zu dessen Erkenntnis man nicht auch selbst fähig wäre. Diejenigen Probleme aber, die sich durch die Anwendung der Regeln nicht derart bewältigen lassen, daß deren Lösung fertiger Besitz des Wissens werden kann, bleiben der Erforschung durch den menschlichen Verstand unzugänglich. Die Wahrheit, die sie verbergen, hat keine Chance, je eine Gestalt des Wissens anzunehmen. Zu wissen, daß hier nichts Wißbares vorliegt, muß dem Wissensverlangen der Menschen reichlich genügen.
»De omnibus quae occurrunt veritatem quaerere« heißt demnach, die Wahrheit zu erforschen in der Befolgung der allem Erkennen eigenen Regeln, denn nur das kann Wissen werden, was im Spielraum der Vernunftregeln als das Wißbare begegnen kann.
Diese formalen Bestimmungen haben freilich eine durchaus praktische Absicht. Descartes’ totaler Wissensanspruch erstreckt sich auf alle Dinge dieser Welt und zwar »en dehors de la foi.« Bei respektvoller Anerkennung der Glaubenswahrheiten richtet sich sein Philosophieren auf praktische Lebensweisheit, auf eine glückliche Lebensführung und auf eine Verbesserung der irdischen Existenz. Ausdrücklich spricht der ursprüngliche Titel des ›Discours‹ von einem »projet d’une science universelle qui puisse élever notre nature à son plus haut degré de perfection«. Und im letzten Kapitel des ›Discours‹ verweist Descartes wiederum auf seine Absicht, »statt jener theoretischen Schulphilosophie eine praktische zu erreichen, wodurch wir die Kraft und die Tätigkeiten des Feuers, des Wassers, der Luft und der Gestirne, der Himmel und aller übrigen uns umgebenden Körper ebenso deutlich als die Geschäfte der Handwerker kennenlernen und also im Stande sein würden, sie ebenso praktisch zu allem möglichen Gebrauch zu verwerten und uns auf diese Weise zu Herren und Eigentümern der Natur zu machen«. Es ist kein Zweifel, daß die im Gefolge der Aufklärung sich formierende neuzeitliche Naturwissenschaft dieses Programm mit all seinen Folgen für die Scheidung von Glauben und Wissen vollzogen hat.
Der geschichtliche Erfolg dieses Programms lag aber in Descartes’ Einsicht begründet, daß die Prinzipien der Vernunft mit denen unseres möglichen Wissens identisch sind. Folglich mußte auch die Wissenschaft diesen Prinzipien gehorchen. Der Einheit der Vernunft entspricht die der einzelnen Wissenschaften, die alle untereinander verknüpft und voneinander abhängig sind. Wissenschaft folgt den stets gleichen Erkenntnisgesetzen, festen methodischen Regeln. Deshalb lassen sich wissenschaftliche Aussagen objektivieren und von jedermann auf ihren Wahrheitsgehalt hin kontrollieren. Der Schluß der ersten Regel spricht eindeutig aus, daß das von Descartes angestrebte Wissen nicht in der Summe der Erkenntnisse der Einzelwissenschaften liegt, sondern in der Erkenntnis des allen Disziplinen gemeinsam Zugrundeliegenden und des Grades ihrer Abhängigkeit von demselben. Nicht um ein quantitatives Wissen geht es zunächst (wie noch bei Bacon), sondern um ein qualitatives, kritisch gesichertes, strukturiertes Wissen. Der Schlüssel zur Erforschung der Wahrheit liegt in der Kenntnis des prinzipiellen Zusammenhanges der Einzelerkenntnisse. Diesem Bemühen dient das Projekt einer Universalwissenschaft, die in der vierten Regel unter dem Begriff einer ›Mathesis universalis‹ entworfen wird.
Die Vorzugsstellung, die alles Mathematische bei Descartes hat, hängt mit einer wesentlichen bleibenden Entdeckung zusammen. Zunächst haben Arithmetik und Geometrie bei ihm nur exemplarische Bedeutung, denn was er anstrebt, ist eine den arithmetischen und geometrischen Beweisen gleichwertige Gewißheit in allen Dingen. Da Geometrie und Arithmetik (d.h. die damalige Mathematik) aber selbst Einzelwissenschaften sind, müssen sie Prinzipien gehorchen, die noch weitaus allgemeiner sind als ihre eigenen. Daher stellt Descartes ausdrücklich fest, daß er hier nichts weniger als die gewöhnliche Mathematik im Sinne habe, »sondern eine ganz andere Wissenschaft, von der die erwähnten (nämlich Arithmetik und Geometrie) eher eine Hülle, denn Teile sind«. Denn die neue Wissenschaft muß »die wurzelhaften Grundlagen der menschlichen Vernunft enthalten und ihre Aufgabe auch dahin ausdehnen, die Wahrheiten aus jedem Gegenstande herauszuziehen«. Der Schritt zur ›Mathesis universalis‹ vollzieht sich nun ganz im Sinne der cartesischen Methodenlehre durch eine Verknüpfung von grundlegenden Einsichten in der Arithmetik und Geometrie. Eine Mathematik kann nur dann universell sein, wenn sie den Dualismus in den beiden Zweigen der Mathematik überwindet: die Arithmetik hat es mit diskontinuierlichen Größen zu tun, die Geometrie aber mit kontinuierlichen. Dieser Dualismus der Betrachtungsweisen, der sich als scheinbarer Dualismus der mathematischen Objekte zeigt, kann überwunden werden, wenn man die einfachste dieser beiden Größen als Symbol für die andere wählt. Alle Zahlenverhältnisse lassen sich dann durch kontinuierliche Größenverhältnisse ausdrücken. Dieser Sachverhalt läßt in der Tat zahlreiche Wissenschaftsbereiche mathematisierbar erscheinen:
»Betrachtet man dies aufmerksamer, so erkennt man schließlich, daß man zur Mathematik genau alles das rechnen muß, wobei nach Ordnung und Maß geforscht wird, und daß es hierbei gar nicht darauf ankommt, ob man dieses Maß nun in Zahlen oder in Figuren oder den Gestirnen oder den Tönen oder in irgendeinem anderen Gegenstand zu suchen hat, so daß es also eine bestimmte allgemeine Wissenschaft geben muß, die all das erklären wird, was der Ordnung und dem Maß unterworfen, ohne Anwendung auf eine besondere Materie, als Problem auftreten kann. Diese kann man nicht durch ein fremdes, sondern durch ein altes und in allgemeinen Gebrauch übergegangenes Wort als ›Mathesis universalis‹ bezeichnen, weil in ihr der Grund dafür enthalten ist, weswegen man auch die übrigen Wissenschaften als mathematische Lehren bezeichnet.« (Reg. IV)
Die Prinzipien des Wissens beruhen also auf einer Logik der Relationen und Proportionen. Ganz im Sinne moderner mathematischer Strukturforschung geht es Descartes in seiner Universalmathematik nicht nur um Aufgaben des Zählens und Messens, sondern um die Funktion der Ordnung und um die Auffindung isomorpher Ordnungsstrukturen, durch die verschiedene Gegenstandsbereiche (zum Beispiel Zahlen, Figuren, Gestirne, Töne) aufeinander beziehbar werden. Descartes hat diese Isomorphie, die in der Mathematik heute eine so große Rolle spielt, gesehen und ihre möglichen kosmologischen Aspekte wohl wenigstens geahnt, später während der Ausbildung seiner Metaphysik aber kaum weiter verfolgt.
Die neue Logik, die hier bei Descartes noch in vagen Umrissen auftaucht und die später von Leibniz aufgegriffen wird, weiß sich in entschiedener Gegnerschaft zur aristotelisch-scholastischen Syllogistik. Descartes’ Haupteinwand gegen die traditionelle Logik geht im ›Discours‹ dahin, daß die Syllogismen der Logik und der größte Teil ihrer anderen Vorschriften nur dazu dienen, anderen zu entwickeln, was man selbst schon weiß. Die Logik ist keine ›ars inveniendi‹, sondern nur eine ›ars demonstrandi‹.
Descartes hat gewußt, daß praktisches Erkennen in tätiger Forschung sich anders vollzieht als in der Weise der aristotelischen Schlußformen, deren Gültigkeit unabhängig von ihrem Gehalt besteht. In der »vera logica«, die Descartes vorschwebt, sind daher die logische Form und der Wahrheitsgehalt der Aussage unlöslich miteinander verknüpft. Die ›Regeln‹ zeigen den operationalen Charakter des Erkennens. Das heißt aber, daß wissenschaftliche Erkenntnis nicht als eine starre Beziehung zwischen einem abstrakten Subjekt und dem Erkenntnisobjekt verstanden wird, sondern als dynamischer Vorgang eines praktischen Tuns zu begreifen ist, bei dem es um die Lösung von Problemen (quaestiones) geht. Ausschlaggebend für das Verfahren wird methodische Sicherheit, Vorgehen nach strengen Regeln. Der Umstand, daß ›quaestio‹ und ›ordo‹ scholastische Begriffe sind, darf nicht über den völlig unscholastischen Charakter der cartesischen Wissenschaft täuschen. Mittelalterliche Wissenschaft hatte statischen Charakter: das vorliegende Wissensgut galt als in sich abgeschlossen, die Lehre antwortete auf Fragen aus dem Fundus vorhandener, dogmatisch geltender Erkenntnisse. Mit Descartes bekommt die Forschung ihren dynamischen Charakter: die Gegenstände haben ihre offene, unentdeckte Seite, dem Erkennen stellen sich Probleme, die es methodisch zu lösen gilt, ohne daß die Antwort im voraus bereitliegt. Philosophie wird auf diese Weise weitgehend Frage nach der Erkenntnis und verliert ihren alten Charakter als Frage nach dem Sein und dem Seienden.
Wir haben hier versucht, einige Momente cartesischen Denkens zu verdeutlichen, die vor der Ausbildung der so oft beschriebenen Zweifelsmethode und der Metaphysik liegen und über die Jahrhunderte hinweg für den Charakter der neuzeitlichen Wissenschaft typisch bleiben. Blickt man auf den cartesischen Ansatz im ganzen, so kann man, wie es H. Scholz vor einigen Jahren in überzeugender Weise getan hat, die Umgestaltung des abendländischen Denkens, die mit Descartes einsetzt, durch vier Axiome bestimmen: 1. durch das Axiom von der Unübertrefflichkeit eines wohlerworbenen Wissens mit dem Vorrang der Mathematik und der Möglichkeit, Wissenschaft zu mathematisieren; 2. durch das Axiom vom profanen Charakter der Wissenschaft mit seinen Folgen für die Trennung von Glauben und Wissen in der modernen Welt; 3. durch das Axiom vom dynamischen Charakter der Wissenschaft mit seinen Folgen für die Trennung von Forschung und Lehre und für die Ansprüche, die an die Forschung zu stellen sind; 4. durch das Axiom von der Aufteilbarkeit der Welt in ein reduzierbares Subjekt der Erkenntnis und eine ihm unverbunden und unabhängig als Objekt gegenüberstehende Natur. Das vierte Axiom ist im Zuge der jüngsten Entwicklung der Physik, insbesondere durch erkenntnistheoretische Folgerungen, die sich aus der Formulierung der Unbestimmtheitsrelation ergeben, weitgehend hinfällig oder doch zutiefst problematisch geworden. Die anderen drei Axiome sind in Kraft. Von ihnen her kann das Gespräch mit Descartes geführt werden.
Ein heutiger Zugang zu Descartes brauchte aber nicht allein von der Naturwissenschaft her zu geschehen, sondern könnte sich anthropologischer Argumente bedienen. Wiederum gälte es, die cartesische Metaphysik und den anthropologisch unhaltbaren Zwei-Substanzen-Dualismus auszuklammern und auf den Descartes der ersten Abschnitte des ›Discours‹ zurückzugreifen, worauf H. Wein verschiedentlich aufmerksam gemacht hat. Wir sahen schon: für Descartes, dem sich Wahrheit zur Gewißheit eingrenzt, geht es nicht um ein Wissen, das um seiner selbst willen gewußt werden soll, – weder in der Art, wie Aristoteles am Anfang der ›Metaphysik‹ eigentliches Wissen als Selbstzweck versteht, noch wie in der späteren Neuzeit ein Wissensbesitz, der sich selbst genug ist, als Bildungsideal auftaucht. Das ist auch immer gesehen worden. So hat man mit einigem Recht bemerkt, daß Descartes’ Instrumentalismus, wie ihn unter anderem die vierte Regel und der sechste Abschnitt des ›Discours‹ unbestreitbar belegen, auf den Erfolgen der geistigen und technischen Weltbemächtigung der Neuzeit beruht. Dem historischen Blick müssen Bacons ehrgeiziges Streben und Descartes’ einsames Philosophieren als Phänomene ein und desselben Vorgangs erscheinen, der in der metaphysischen Begründung einer Technik profaner Weltbemächtigung aus dem Selbstvertrauen der Ratio zu begreifen ist. Kann man aber die dem Descartes eigentümliche Erkenntnishaltung wirklich mit der Bacons gleichsetzen? Die rationale Selbständigkeit ist bei Descartes am Beginn seiner Philosophie im Unterschied zu Bacon doch frei von jenem Optimismus, der den Glauben an die beliebige Verfügbarkeit über die Welt begleitet. Statt des Willens zur Macht über die Welt, der als Motor der neuzeitlichen Wissenschaft ausgegeben wird, geht es Descartes schlichter zunächst nur um ein Bestehen in der Welt. Aus der Sorge, eine das Leben bedrängende und herausfordernde Wirklichkeit bestehen zu müssen, scheint Descartes’ umfassendes Wissenwollen zu resultieren. Wenn man die ersten Seiten des ›Discours‹ nicht als rhetorischen Kunstgriff des ›homme en masque‹ abtut, sondern sie als einen Lebensbericht auffaßt, der von einem Bildungsgang Zeugnis ablegt, wird man schwerlich an einer Stelle wie der folgenden vorbeikommen: »Et j’avais toujours un extrème désir, d’apprendre à distinguer le vrai avec le faux, pour voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie.« Das Selbstvertrauen als gewisse Zuversicht (assurance) ist nicht vorgängig, sondern soll vielmehr erst gewonnen werden, um in der praktischen Sphäre dem Handeln eine Richtung zu weisen. Hier geht es also um die ganz persönliche Daseinsbewältigung eines Menschen, der in der sich auflösenden mittelalterlichen Welt seinen Weg zu gehen hatte. Dieses existentielle Moment des cartesischen Denkens wird von der neueren Philosophie bei Sartre gewürdigt, aber sonst gern übergangen.
Dabei zeigen gerade die im Stil der persönlichen Aussage gehaltenen Partien des ›Discours‹ und viele von Descartes’ Briefen, welchem Zwang zur Selbstbehauptung dieses Leben ausgesetzt war. Descartes’ Werk ist die Antwort auf eine Epoche, dadurch erhält es eine so einzigartige Stellung in der europäischen Geistesgeschichte. Während Richelieu in Frankreich den Absolutismus durchsetzt und der größte Teil Europas in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges verwüstet darniederliegt, während Galilei mit seiner neuen Physik von der Inquisition in große Bedrängnis gebracht wird und Kepler dauernden Schikanen ausgesetzt ist, während der zu lebenslänglicher Haft verurteilte Grotius aus Holland nach Frankreich flieht, meidet Descartes sein Heimatland Frankreich, um nach einem unsteten Leben, das ihn durch viele europäische Länder führte, in Holland unterzutauchen, wo er sich vor kirchlichen Verfolgungen einigermaßen geschützt wissen darf.
Während die alten Autoritäten noch mächtig sind, hat der heraufkommende neue Geist sie schon entthront. Reformation und Humanismus haben den Boden vorbereitet, auf dem sich jetzt, im Übergang von der Renaissance zum Barock, die Stimme der beginnenden Aufklärung erhebt: die unüberhörbare Stimme nicht nur einer neuen wissenschaftlichen Weltansicht, sondern auch einer neuen Humanität und Toleranz, demokratisch und auf die Freiheit des Individuums bedacht schon in einem Augenblick, da der Absolutismus sich erst formiert. Während die politische Geschichte der ersten Jahrhunderthälfte dem Chaos zutreibt, gefallen sich seine Denker im Erschaffen fester und klarer Formen, streben sie zu Ordnung, Einheit und Regelmaß. »Es gibt kein anderes Jahrhundert, in dem das Ideal so schwer auf der Wirklichkeit gelastet, in welchem das Leben ein solches Bild irdischer Vollkommenheit in den Spiegel des Geistes geworfen hätte«, weiß Huizinga in seiner Gedenkrede auf Hugo Grotius zu bekunden. Descartes’ Leben und Werk bezeugt die scharfe Spannung zwischen den Extremen der Zeit, die für die Gestimmtheit des Barock im ganzen charakteristisch sind. Der vagabundierende Edelmann nimmt am Weltprunk seiner Zeit teil, studiert, darin Montaigne verwandt, »im großen Buche der Welt«, zieht sich bald darauf aber wenn nicht im Erlebnis der Weltnichtigkeit so doch in einem stoischen Rückzug in die Einsamkeit zurück. Seine Philosophie antwortet der zerbrechenden Welt des Mittelalters mit einer ›provisorischen Moral‹ und mit dem ›Ego cogito‹ als einem unangreifbaren Innenpunkt, von dem her das eigene Leben und seine Beziehung zu allem, was in seiner Überfülle draußen bleibt, zur Gesellschaft und zur Natur, neu zu ordnen ist. Die gleichen Gegensätze, deren Dialektik Benjamin, Cysarz, Ermatinger und Rütsch in der Barockdichtung aufgewiesen haben, lassen sich auch aus dem Werk des Cartesius entwickeln.
Damit hängt die Ambiguität vieler Formulierungen bei Descartes zusammen. Historische Forschung und interpretatorische Aneignung haben in drei Jahrhunderten die hermeneutische Situation nicht dahin zu klären vermocht, daß wir uns Descartes gegenüber beruhigen können. Die Schlichtheit seines Stils läßt auf den ersten Blick durchsichtig scheinen, was bei eingehenderem Studium sich oft nur als Index für höchst komplexe Problemgebilde erweist, die vielleicht vom Autor mitgedacht und mitgemeint worden sind, aber am Text sich eindeutig nicht belegen lassen. Das gilt auch angesichts des Umstands, daß vor allem die französische Descartes-Forschung in den letzten fünf Jahrzehnten philologisch erstklassige Arbeiten vorgelegt hat, das gesamte Werk durch die Ausgabe von Adam und Tannery textkritisch vorbildlich gesichert ist und wir zudem aus der Feder Etienne Gilsons einen Kommentar zum ›Discours‹ besitzen, der als unüberholbares Standardwerk der Descartes-Literatur zu bezeichnen ist. Für eine Neuinterpretation Descartes’ sind so die denkbar besten Voraussetzungen gegeben. Solche erneute Aneignung des cartesischen Werkes dürfte nicht der Philologie entraten, hätte aber gleichwohl die legitime Verpflichtung, an manchen Stellen des Textes eigenständig weiterzudenken. Ginge es doch dabei nicht um eine Ehrenrettung des Descartes oder gar des Cartesianismus, sondern lediglich um einen problemgebundenen Dialog, aus dem neue Antriebe für ein rationales Philosophieren erwachsen können, dessen unsere zu Irrationalismen neigende Zeit so sehr bedarf.
Aus den Regeln zur Leitung des Geistes
Regulae ad Directionem Ingenii
Regel I
Es muß das Ziel der wissenschaftlichen Bestrebungen sein, den Geist so zu lenken, daß er über alle sich ihm darbietenden Gegenstände begründete und wahre Urteile fällt.
1. So oft die Menschen irgend eine Ähnlichkeit zwischen zwei Dingen bemerken, pflegen sie von beiden, mögen diese selbst in gewisser Hinsicht voneinander verschieden sein, das auszusagen, was sie nur bei einem als wahr erfunden haben. So vergleichen sie ungerechtfertigterweise die Wissenschaften, die gänzlich in der Erkenntnis des Geistes bestehen, mit den Künsten, die einer gewissen körperlichen Gewöhnung und Anlage bedürfen. Sie sehen nämlich, daß derselbe Mensch nicht alle Künste zugleich erlernen kann, sondern daß der eher ein ausgezeichneter Künstler wird, der nur eine einzige pflegt, weil schwerlich dieselben Hände zu Ackerbau und Zitherspiel oder mehr dergleichen Verrichtungen nebeneinander im selben Maße geschickt sind, wie zu einer einzigen von diesen.
2. Dasselbe haben sie auch von den Wissenschaften angenommen, haben diese je nach der Verschiedenheit ihrer Gegenstände voneinander gesondert und geglaubt, man müsse sie nun jede für sich und ohne Berücksichtigung der übrigen untersuchen. Darin haben sie sich aber sicherlich getäuscht. Denn da alle Wissenschaften insgesamt nichts anderes sind als die menschliche Vernunft, die stets eine und dieselbe bleibt, mag man sie auf noch so viele Gegenstände anwenden, und die von diesen keine größere Verschiedenheit empfängt als das Licht der Sonne von der Mannigfaltigkeit der von ihr beleuchteten Dinge, – so liegt kein Grund vor, den menschlichen Geist durch irgendwelche Schranken einzuengen; hindert doch in der Tat die Erkenntnis einer Wahrheit nicht an der Auffindung einer anderen. Ganz im Gegensatz zu der Kunst, wo die Ausübung der einen der Aneignung einer anderen im Wege steht, findet hier vielmehr eine wechselseitige Förderung statt. Und fürwahr, es scheint mir wunderlich, daß die meisten Menschen die Kräfte der Pflanzen, die Bewegungen der Gestirne, die Umwandlungen der Metalle und Gegenstände ähnlicher Wissenschaften aufs sorgfältigste erforschen, während so gut wie niemand über den Geist selbst (bona mens) oder über diese universelle Wissenschaft (universalis sapientia) nachdenkt, wenngleich doch alles übrige nicht so sehr an und für sich Wert hat, als sofern es hierzu einen Beitrag liefert.
3. Es hat also seinen guten Grund, wenn wir diese Regel an die Spitze aller übrigen stellen, da uns nichts eher von dem richtigen Wege zur Erforschung der Wahrheit ablenkt, als wenn wir unsere Studien nicht auf dieses allgemeine Ziel, sondern auf irgendwelche besondere richten. Ich rede hier gar nicht von den schlechten und verwerflichen Zielen, wie eitler Ruhm oder schmählicher Gewinn es sind: ist es doch klar, daß allerlei zurechtgestutzte Gründe und dem Geschmack der Menge angepaßte Spielereien einen weit kürzeren Weg dazu bahnen, als es eine gründliche Erkenntnis der Wahrheit vermöchte. Vielmehr beziehen sich meine Worte auch auf die würdigen und lobenswerten Ziele, da wir uns durch sie häufig in recht feiner Weise täuschen lassen, wie wenn wir z.B. in den Besitz von nützlichen Wissenschaften gelangen wollen, sei es nun zum Zwecke eines behaglichen Lebens oder wegen der Freude, die man in der Betrachtung der Wahrheit findet und die fast das einzige völlige und durch keinerlei Schmerz getrübte Glück in diesem Leben ist. Diese regelmäßigen Früchte der (einzelnen) Wissenschaften dürfen wir zwar erwarten; denken wir aber während des Studiums immer wieder an sie, so mag es oft vorkommen, daß wir vieles, was zur Erkenntnis der anderen Dinge notwendig ist, vernachlässigen, weil es uns entweder auf den ersten Blick als zu wenig nützlich oder zu wenig interessant erscheinen wird.
4. Man wird also zu der Annahme geführt, daß alle Wissenschaften untereinander derart verknüpft sind, daß es bei weitem leichter ist, sie alle insgesamt zu erlernen, als eine einzige von den übrigen loszulösen. Will also jemand ernsthaft die Wahrheit erforschen, so darf er sich nicht um eine Einzelwissenschaft bemühen – denn sie alle sind untereinander verknüpft und voneinander abhängig –, sondern er denke nur daran, das natürliche Licht seiner Vernunft zu steigern, nicht um diese oder jene Schulschwierigkeit aufzulösen, sondern damit in den einzelnen Wechselfällen des Lebens der Intellekt dem Willen vorweise, was zu wählen ist. Dabei wird er erfahren, daß er binnen kurzem wunderbare und bei weitem größere Fortschritte gemacht hat als die, welche sich mit Sonderproblemen beschäftigen, und daß er nicht nur alles das erlangt hat, wonach die übrigen streben, sondern außerdem Höheres, als sie jemals erhoffen dürfen.
Regel II
Man sollte sich nur den Gegenständen zuwenden, zu deren klarer und unzweifelhafter Erkenntnis unser Geist zuzureichen scheint.
1. Alles Wissen besteht in einer sicheren und klaren Erkenntnis. Auch ist, wer an vielen Dingen zweifelt, nicht gelehrter, als wer über eben diese niemals nachgedacht hat, sondern er erscheint nichtsdestoweniger eben darin weniger gelehrt, falls er sich nämlich über manche Dinge eine falsche Meinung gebildet hat. Es ist demnach besser, überhaupt nicht zu studieren, als sich mit so schwierigen Gegenständen zu beschäftigen, daß man, nicht in der Lage, Wahres von Falschem zu unterscheiden, sich genötigt sieht, das Zweifelhafte als gewiß anzunehmen; darf man doch hierbei weit weniger hoffen, sein Wissen zu vermehren, als man fürchten muß, es zu verringern.
2. Wir weisen also der obigen Regel gemäß alle bloß wahrscheinlichen Erkenntnisse zurück und stellen fest, daß man nur denen Glauben schenken darf, die vollkommen erkannt sind und an denen sich nicht zweifeln läßt. Die Gelehrten freilich dürften sich vielleicht für überzeugt halten, daß es nur sehr wenige derartige Erkenntnisse gibt. Denn sie hielten – ein dem Menschengeschlechte gemeinsamer Fehler! – diese Erkenntnisse für gar leicht und selbstverständlich und versäumten daher, darüber weiter nachzudenken. Ich mache jedoch darauf aufmerksam, daß es deren weit mehr gibt, als sie glauben, und daß derartige Erkenntnisse genügen, um unzählige Voraussetzungen, über die jene Gelehrten sonst nur mit Wahrscheinlichkeit etwas aussagen konnten, sicher zu beweisen. Da sie es nämlich eines gelehrten Mannes für unwürdig hielten, zuzugeben, etwas nicht zu wissen, so gewöhnten sie sich so sehr daran, ihre bloß erdichteten Gründe herauszustreichen, daß sie nach und nach schließlich sich selbst davon überzeugt glaubten, und sie so als wahr anpriesen.
3. Wenn wir indes diese Regel streng befolgen, so wird sich recht wenig darbieten, mit dessen Studium wir uns beschäftigen dürfen. Denn es gibt kaum eine Frage in den Wissenschaften, über die nicht die Männer von Geist häufig verschiedener Ansicht gewesen wären. Wenn aber die Urteile zweier über einen und denselben Gegenstand auseinandergehen, so ist so viel sicher, daß einer zum mindesten sich irrt. Ja, es scheint hierbei keiner von beiden im Besitze eines eigentlichen Wissens zu sein; denn wären seine Gründe sicher und klar, so könnte er sie dem andern auch so vortragen, daß er ihn schließlich zur Zustimmung zwänge. Es scheint also, daß wir von allen derart nur wahrscheinlichen Ansichten kein vollkommenes Wissen erlangen können, da es doch nicht ohne Verwegenheit angängig ist, von uns selbst mehr zu erhoffen, als andere geleistet haben. Wenn demnach unsere Berechnung stimmt, so bleiben von den bereits vorhandenen Wissenschaften allein Arithmetik und Geometrie, auf welche die Beobachtung unserer Regel uns zurückführt.
4. Trotzdem verurteilen wir darum nicht die Art und Weise, nach der die übrigen bisher philosophiert haben, ebensowenig wie die Anwendung der wahrscheinlichen Syllogismen, die zu den Wortgefechten in den Schulen außerordentlich geeignet sind. Denn sie üben den Geist der Knaben und dienen durch den Wetteifer, welchen sie hervorrufen, ihrem Fortschreiten. Ist es doch weit besser, daß sie sich über derartige Ansichten – wenngleich sie offenbar unsicher, weil unter den Gelehrten strittig – unterrichten, als wenn sie sich selbst frei überlassen blieben; denn sie würden ohne Führer vielleicht bis zu Abgründen gelangen. Solange sie jedoch in den Spuren ihrer Lehrer einhergehen, verfolgen sie, wenngleich sie sich von der Wahrheit bisweilen entfernen, doch immerhin einen Weg, der wenigstens in der Hinsicht sicherer ist, als ihn bereits die Klügeren erprobt haben. Wir selbst freuen uns, daß man uns einst in den Schulen so unterwiesen hat. Da wir jetzt aber der Verpflichtung enthoben, die uns auf die Worte des Meisters schwören hieß, und alt genug sind, um unsere Hand der strafenden Rute zu entziehen, so ist es, wenn wir uns ernsthaft selbst Regeln vorschreiben wollen, um mit deren Hilfe zum Gipfel der menschlichen Erkenntnis zu gelangen, vonnöten, die unter die ersten zu setzen, welche uns verbieten, unsere Zeit zu mißbrauchen, wie das viele tun, die alles, was leicht ist, vernachlässigen und sich nur mit schwierigen Dingen beschäftigen. Hierüber stellen sie dann allerdings die feinsten Vermutungen und recht wahrscheinliche Gründe in geistreichster Weise auf, bis sie am Ende nach vieler Mühe zu spät bemerken, daß sie bloß die Menge des Zweifelhaften vermehrt, aber keine Wissenschaft kennengelernt haben.
5. Wir haben nun oben gesagt, daß von allen durch andere bereits erkannten Wissenschaften allein Arithmetik und Geometrie jedes Fehlers der Falschheit oder Ungewißheit bar sind. Um aber genauer zu begründen, warum dem so ist, bemerken wir, daß wir auf zwiefache Weise zur Erkenntnis der Dinge gelangen: durch Erfahrung nämlich oder durch Deduktion. Ferner ist zu bemerken, daß unsere Erfahrungen von den Dingen häufig trügerisch sind, die Deduktion dagegen – oder die reine Ableitung des einen aus einem anderen – zwar bisweilen, wenn sie etwa nicht einleuchtet, unterlassen werden, niemals aber, selbst von einem noch so wenig geschulten Verstande, schlecht angestellt werden kann. Hierzu scheinen mir jene Fesseln der Dialektiker, durch welche sie die menschliche Vernunft zu lenken meinen, recht wenig zu nützen, wenngleich ich nicht leugnen möchte, daß eben diese zu anderen Zwecken recht geeignet sein mögen. Entsteht doch alle Täuschung, die den Menschen – sage ich, nicht den Tieren – zustoßen kann, niemals aus einer mangelhaften Ableitung, sondern nur daraus, daß man gewisse nur unzulänglich begriffene Erfahrungen zugrundelegt oder unbesonnene und unbegründete Urteile fällt.
6. Hierdurch wird klar, weshalb Arithmetik und Geometrie mit weit größerer Sicherheit vor allen übrigen Wissenszweigen bestehen: weil nämlich sie allein sich mit einem so reinen und einfachen Gegenstand beschäftigen, daß sie gar nichts voraussetzen, was die Erfahrung unsicher zu machen imstande wäre, sondern gänzlich in verstandesmäßig abzuleitenden Folgerungen bestehen. Sie sind daher am leichtesten und durchsichtigsten von allen und haben einen Gegenstand, so wie wir ihn fordern, da hierbei der Irrtum, von Unaufmerksamkeit abgesehen, wohl kaum Menschenlos sein dürfte. Trotzdem darf es nicht in Verwunderung setzen, wenn sich der Geist vieler aus freien Stücken eher anderen Studien oder der Philosophie zuwendet: es kommt das nämlich daher, daß ja ein jeder es sich kecker herausnimmt, bei einem dunkeln, als bei einem klaren Gegenstande Vermutungen aufzustellen, und es weit leichter ist, bei einer beliebigen Frage irgend etwas zu mutmaßen, als bei einer noch so leichten bis zur Wahrheit selbst vorzudringen.
7. Fürwahr, aus alledem folgt, nicht zwar, daß man allein Arithmetik und Geometrie betreiben soll, aber doch, daß die, welche den rechten Weg zur Wahrheit suchen, sich mit keinem Gegenstand beschäftigen dürfen, von dem sie nicht eine den arithmetischen und geometrischen Beweisen gleichwertige Gewißheit zu erlangen imstande sind.
Regel III
Bei den von uns vorgenommenen Gegenständen dürfen wir nicht das, was andere darüber gemeint haben, noch was wir selbst mutmaßen, untersuchen, sondern allein das, was wir durch klare und evidente Intuition oder durch sichere Deduktion darüber feststellen können; denn auf keinem anderen Wege kann die Wissenschaft erworben werden.
1. Lesen muß man die Werke der Alten; ist es doch eine große Wohltat, daß wir uns die Arbeiten so vieler Männer zunutze machen können: sowohl um das, was bereits früher richtig gefunden worden, zu erkennen, als auch, um darauf aufmerksam zu werden, was noch darüber hinaus in all den Einzelwissenschaften zu erforschen übrigbleibt. Es ist jedoch dabei die große Gefahr vorhanden, daß sich uns, wenn auch durchaus unwillkürlich und trotz aller unserer Vorsicht, doch infolge der allzu gründlichen Lektüre der Makel von Irrtümern anhefte. Solchen Sinnes pflegen nämlich die Schriftsteller zu sein, daß, so oft sie auf die Entscheidung irgendeiner strittigen Ansicht infolge schlecht beratener Leichtgläubigkeit verfallen sind, sie stets den Versuch machen, uns mit den feinsten Argumenten auf ihren Standpunkt hinüberzuziehen. Haben sie im Gegenteil wirklich einmal glücklich etwas Gewisses und Evidentes gefunden, so ist ihre Darlegung stets mit großer Umständlichkeit verbunden: sie fürchten nämlich, es möchte der Würde der Erfindung die Einfachheit der Begründung Abbruch tun, oder aber sie mißgönnen uns die offenkundige Wahrheit.
2. Ja, wenn sie selbst alle gerade heraus und offen wären und uns nie etwas Zweifelhaftes als Wahrheit aufdrängten, sondern alles in gutem Glauben auseinandersetzten, so blieben wir doch stets in Ungewißheit, wem wir nun glauben sollten, da ja trotzdem kaum einer etwas sagt, dessen Gegenteil nicht ein anderer behauptet. Dabei würde es auch zu nichts führen, die Stimmen zu zählen, um dann der Ansicht der Mehrzahl zu folgen. Denn handelt es sich um eine schwierige Frage, so ist es weit wahrscheinlicher, daß der wahre Sachverhalt von wenigen als von vielen gefunden wird. Wenn aber auch alle untereinander übereinstimmten, so würde dennoch selbst ihrer aller Gelehrsamkeit nicht genügen; und wir würden z.B. niemals Mathematiker werden, wenngleich wir alle von anderen gefundenen Beweise im Gedächtnis behielten, wofern nicht auch unser Geist imstande wäre, Probleme aller Art selbst aufzulösen; und ebensowenig Philosophen, wenn wir auch alle Argumente von Plato und Aristoteles gelesen hätten, aber über die vorliegenden Gegenstände ein festes Urteil zu fällen nicht imstande wären: alsdann nämlich hätten wir offenbar nicht Wissenschaft, sondern Geschichte gelernt.
3. Denken wir zudem daran, daß wir unseren Urteilen über die Wahrheit der Dinge überhaupt niemals Vermutungen beimischen! Dies zu beobachten ist von nicht unbeträchtlicher Bedeutung. Auch ist der Grund dafür, daß man jetzt in der Vulgär-Philosophie nichts so Evidentes und Gewisses findet, daß es nicht strittig gemacht werden könnte, wohl am ehesten darin zu suchen, daß die Gelehrten, nicht zufrieden damit, die klaren und gewissen Dinge zu erkennen, es auch gewagt haben, Behauptungen über Dunkles und Unbekanntes aufzustellen, an das nur wahrscheinliche Vermutungen heranzureichen vermochten. Hieran haben sie dann nach und nach selbst ohne alle Einschränkung geglaubt, es mit dem Wahren und Evidenten unterschiedslos vermischt und schließlich überhaupt keinen Schluß mehr ziehen können, der nicht von einem derartigen Satz abhing und demnach ungewiß war.
4. Um nicht in denselben Irrtum zu verfallen, sollen hier alle Tätigkeiten unseres Intellekts aufgezählt werden, durch die wir ohne jede Furcht vor Täuschung zur Erkenntnis der Dinge zu gelangen vermögen: es sind aber nur zwei zulässig, nämlich Intuition und Deduktion.
5. Unter Intuition verstehe ich nicht das mannigfach wechselnde Zeugnis der Sinne oder das trügerische Urteil, das sich auf die verworrenen Bilder der sinnlichen Anschauung stützt, sondern ein so einfaches und instinktes Begreifen des reinen und aufmerksamen Geistes, daß über das Erkannte weiterhin kein Zweifel übrigbleibt, oder, was dasselbe ist, das über jeden Zweifel erhabene Begreifen eines reinen und aufmerksamen Geistes, das allein dem Lichte der Vernunft entspringt. Und zwar ist die Intuition gewisser, weil einfacher selbst als die Deduktion, die ja ebenfalls, wie oben bemerkt, von uns unmöglich fehlerhaft angestellt werden kann. So kann jeder durch Intuition mit dem Geiste erfassen, daß er existiert, daß er Bewußtsein hat, daß das Dreieck bloß durch drei Seiten begrenzt wird, die Kugel durch eine einzige Oberfläche und dergl.; welcher Sätze es bei weitem mehr gibt, als man gemeinhin denkt, weil man es verschmäht, seinen Geist auf derart Einfaches zu richten.
6. Damit man sich übrigens nicht etwa über den neuen Gebrauch des Wortes ›Intuition‹ aufregt, imgleichen über den anderer Worte, die ich ebenso im folgenden in einer von der gewöhnlichen abweichenden Bedeutung notgedrungen gebrauchen werde, so mache ich hier allgemein darauf aufmerksam, daß ich mich wenig darum kümmere, wie alle diese Worte in der letzten Zeit in den Schulen gebraucht worden sind, da es ja äußerst schwierig wäre, dieselben Bezeichnungen zu gebrauchen und dabei etwas ganz anderes im Sinne zu haben. Ich achte vielmehr einzig darauf, was die einzelnen Worte im Lateinischen bedeuten, um dann, so oft spezielle Ausdrücke fehlen, denen von den vorhandenen, die mir hierzu am geeignetsten zu sein scheinen, die von mir festgestellte Bedeutung beizulegen.
7. Nun ist aber diese Evidenz und Gewißheit der Intuition nicht nur bei den einfachen Aussagen, sondern auch bei jeder beliebigen Erörterung erforderlich. Denn es sei z.B. die Folgerung gegeben, daß 2 + 2 gleich 3 + 1 ist, so muß man nicht nur durch Intuition einsehen, daß 2 + 2 vier und 3 + 1 ebenfalls vier gibt, sondern außerdem, daß aus diesen beiden Sätzen der ersterwähnte dritte sich notwendig ergibt.
8