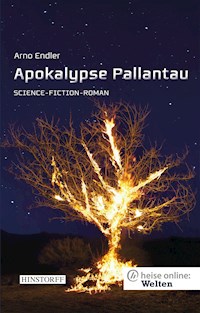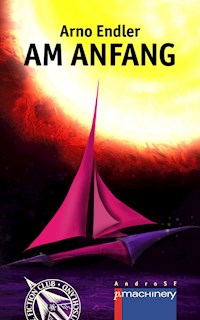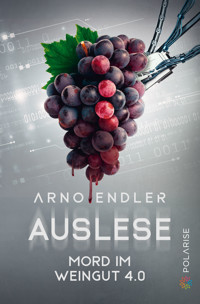
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Polarise
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein herzliches Willkommen im Weingut der Zukunft! Maries neuer Job scheint vielversprechend. Ihr einstiger Professor hat sie als Life-Coach in ein preisträchtiges Forschungsprojekt eingeladen – eine Weinkellerei, die mithilfe einer künstlichen Intelligenz autark geführt werden soll. Schnell merkt Marie, dass nicht alles nach Plan verläuft: Mitglieder des Teams verschwinden spurlos oder werden in rätselhaften Unfällen verletzt. Nachdem auch noch sämtliche Maschinen auf dem abgeschotteten Gebiet offen ein Eigenleben entwickeln, sucht Marie mit Unterstützung von Ego – ein Programmierer mit besonderer Begabung – fieberhaft nach der Ursache und riskiert dafür weitaus mehr als nur ihre Anstellung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ARNO ENDLER
AUSLESE
MORD IM WEINGUT 4.0
© 2023 Polarise
Ein Imprint der dpunkt.verlag GmbH
Wieblinger Weg 17
69123 Heidelberg
www.polarise.de
1. Auflage 2023
Lektorat: Dr. Benjamin Ziech
Copy-Editing: Irina Sehling
Satz: inpunkt[w]o, Haiger, www.inpunktwo.de
Herstellung: Stefanie Weidner
Umschlaggestaltung: Christin Giessel, www.giessel-design.de
ISBN:
978-3-949345-36-4
978-3-949345-37-1
ePub
978-3-949345-38-8
mobi
978-3-949345-39-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind über www.dnb.de abrufbar.
Inhalt
PROLOG
1. EGO
2. EMMA
3. EGO
4. EMMA
5. EGO
6. EMMA
7. EGO
8. EMMA
9. EGO
10. EMMA
11. EGO
12. EMMA
13. EGO
14. EMMA
15. EGO
16. EMMA
17. EGO
18. EMMA
19. EGO
20. IM SPIEGEL
21. EMMA
EPILOG – EGO
PROLOG
Weichgezeichnete Wolkenfetzen stürzten sich über den Kamm des Hangs hinab. Wie eine Herde von Schafen, die dem Leittier folgten. Die Sonne stand recht tief, beleuchtete daher nur die Schwaden, die direkt oberhalb des Hangs schwebten und dann in die Kuhle des Moseltals fielen. Terrassenstufe für Terrassenstufe füllte sich mit sinnesverwirrendem Dunst.
Noch störte kein Verkehrslärm die landschaftliche Ruhe, obwohl sich weit unten die Straßen zu beiden Seiten der Mosel schlängelten. Die ersten Vögel starteten ihr Rufkonzert, trotzten der morgendlichen Kühle.
Eine Gestalt in Sportfunktionshose und Hoodie, dessen Kapuze tief über der Stirn hing, tauchte oben wie aus dem Nichts auf. Schlank, sportiv wirkend, mit sparsamen, effektiven Bewegungen lief der Joggende einen Trampelpfad entlang, stoppte plötzlich und blieb stehen.
Behutsam schlug er die Kapuze zurück. Der Kopf eines Mannes wurde sichtbar. Kurzgeschnittene blonde Haare, die wie aufgemalt wirkten. In seinem Gesicht breiteten sich erste permanente Falten aus. Ein unvoreingenommener Beobachter hätte ihn auf etwa Anfang 30 geschätzt, doch Sven hatte vor wenigen Tagen in einer improvisierten Feier seinen 39. Geburtstag gefeiert.
Er checkte die Anzeige seiner Smartwatch und spazierte zielgerichtet auf einen im Schatten gelegenen Steinhaufen zu.
Dicht daneben führten Treppenstufen, grob behauene Schieferplatten, die vom Wetter gezeichnet waren, hinab auf die oberste Weinbergterrasse.
Er folgte der provisorisch wirkenden Treppe abwärts, hielt sich nahe an der in den Hang geschmiegten Mauer aus Natursteinen und mied die Berührung der Weinreben an den Rebstöcken, die in regelmäßigen Abständen standen. So verhinderte er eine Berührungsmeldung an den Zentralrechner, die sicherlich zu einer Inspektion geführt hätte. Er wollte keine Aufmerksamkeit, suchte die Ruhe, um die nächsten Schritte zu überdenken. Der 5-Kilometer-Lauf hatte seine rasenden Gedanken noch nicht zum Stillstand gebracht oder ihm gar Klarheit beschert.
Zehn Meter weiter gab es eine breitere Lücke zwischen den Pflanzen und eine nach unten führende, modern wirkende puristische Treppenanlage.
Sven stieg insgesamt drei Terrassen tiefer, bis er den Aussichtspunkt erreichte. Eine Nische mit Sitzgelegenheit, die man in die Hangmauer gebaut hatte. Dort war man vor allen Blicken geschützt. Nur ein Beobachter von der gegenüberliegenden Seite des Moseltals hätte ihn mit etwas Glück entdecken können. Doch er saß im Schatten der hinter dem Hang aufsteigenden Sonne. Kein Autofahrer würde ihn hier sehen und auch niemand, der sich oberhalb aufhielt.
Er spürte die Kühle des Morgens, roch förmlich den Tau auf den Blättern und dem Bodengrün. Kräftig einatmend genoss er die Aussicht ins Tal. Erste Scheinwerferstrahlen küssten die Straße. Ein Stromer surrte tief unten vorbei.
Sven unterdrückte den Impuls, nach seinem Smartphone zu greifen. Ein Blick auf die Smartwatch reichte ihm. Achtzehn Dateien in der Warteschleife. Noch hielt er sich in dem Bereich des Störfeldes auf, das einen Internetzugang verhinderte. Auf dem gesamten Gelände hatte man Störsender errichtet.
Er senkte den Arm wieder, seine Faust schmerzte von der Prügelei mit Matti, einem verpickelten Techniker, der ihm seinen fehlenden Erfolg bei Frauen anlastete. Sven schüttelte den Arm aus. Er musste weiter unten am Hang den Bereich finden, in dem die Störsender nicht mehr wirkten. Der Weinberg war gespickt mit metallenen Rebstöcken, in denen Sensoren und Funkanlagen verbaut waren, damit die KI über die Verhältnisse im Weinberg jederzeit informiert war. Störwellen durch Internetfunkmasten hätten die Ergebnisse verfälschen können.
Dabei war die Versuchsanordnung ein Erfolg. Das Experiment kurz vor der Evaluation.
Sven haderte mit sich und seinen Zweifeln. Sollte er wirklich …?
Achtzehn Dateien in die Cloud zu laden, stellte so etwas wie den Bruch seines Vertrages dar. Im schlimmsten Fall würde man ihm Betriebsspionage vorwerfen. Er gab sich einen Ruck und stiefelte entlang der Reben auf die nächste Treppe zu. Weiter unten, sagte er sich. Weiter unten würde der Sendebefehl greifen und die Dateien in seine Cloud übertragen.
In den metallenen Rebstäben summte es unerwartet. Sven kannte jedes technische Gimmick, das in ihnen verbaut worden war. Doch der Schlag von der Seite, der seinen Kopf traf, erwischte ihn unvorbereitet. Er stürzte, seine klare Sicht getrübt von Fehlbildern. Die Ohnmacht kam näher, doch er fing sich auf allen vieren kniend wieder. Ein Tinnituston in seinem rechten Ohr verhallte. Sven sah auf. Aus einem der Rebstöcke hatte sich die Hagelschutzvorrichtung entfaltet. Er griff sich an die Schläfe und spürte dort eine brennende kleine Wunde. An seinem Finger klebte Blut, als er ihn betrachtete.
»Was zum Henker geht hier vor?«, murmelte er und sah sich um. In der gesamten Rebenreihe waren die Hagelschutzschirme ausgefahren. Einer musste ihn im Vorbeigehen am Kopf erwischt haben.
Das leise Geräusch einer Raupenantriebsdrohne näherte sich von rechts. Im dichten Dunst, der sich auf der Grundebene der Terrassenstufe gebildet hatte, konnte Sven nicht erkennen, welches Modell da auf ihn zurollte.
Er wollte der Arbeitsdrohne ausweichen, als ein zweites Abrollgeräusch an sein Ohr drang. Durch den Nebel stach der Aufbau einer Schneide- und Greifdrohne mit dem für die Fortbewegung in schwierigem Gelände genutzten Raupenantrieb. Die einzelnen Kettenglieder aus griffigem Ökokunststoff.
Was machte die Drohne hier? Ein Arbeitsauftrag um diese Uhrzeit?
Sven glaubte nun auch das Surren einer Flugdrohne zu hören.
Was war hier los?
Er bewegte sich langsam von der heranrollenden Drohne weg, immer auf den Untergrund achtend, soweit das möglich war. Die Feuchtigkeit der Nacht hatte zum Teil den Boden aufgeweicht und vereinzelt frei liegende Schieferplatten in eisglatte Rutschfallen verwandelt.
Zweimal zuckte es in Sven. Er glitt aus, ruderte mit den Armen um sein Gleichgewicht. »Nur nicht stürzen«, murmelte er leise. Ihm schienen nun mindestens drei Arbeitsdrohnen zu folgen, was überhaupt keinen Sinn ergab.
Er suchte eine weitere Natursteintreppe, die irgendwo sein musste. In dem halbdämmrigen Licht vermochte er sie nur noch nicht zu sehen.
Er hielt mit der rechten Handfläche Kontakt zur Hangmauer, strich entlang der Steine und beschleunigte seine Schritte.
Ein scharfer Schmerz schnitt von hinten durch beide Kniekehlen, gefolgt von einem glühend heißen Schlag in seinen rechten Knöchel. Sven schrie, stürzte, die Beine trugen ihn nicht mehr. Er verlor die Orientierung, schlug mit den Armen voraus der Länge nach hin. Sein weit aufgerissener Mund biss in den lehmigen Untergrund. Er spuckte aus, stützte sich auf die Ellenbogen und hob den Kopf.
An der Seite parkte eine Raupenantriebsdrohne, die wirbelnden Werkzeugarme im Mittelsteg hielten Messer und eine Zange. War das Blut an dem Messer? Sein Blut?
Die Drohne bewegte sich auf ihn zu. Sven krabbelte los, er hatte jegliche Kraft in den Beinmuskeln verloren.
So schnell er konnte, kroch er zwischen zwei Rebstöcken auf den Rand der Terrasse zu, schrie erneut auf, als sich messerscharfe Klingen in seine Unterschenkel bohrten.
Zwei Schneid-Drohnen attackierten ihn. Sie reagierten nicht auf Sprache, das war ihm klar, dennoch brüllte er sie an. »Stopp! Hört auf!«
Er fingerte jetzt doch nach seinem Smartphone, zog es hervor und entsperrte den Monitor. Er wollte Hilfe rufen, jemanden in der Zentrale benachrichtigen. Sie mussten erfahren, was hier vorging.
Die Anzeige für den Empfang zum internen Netzwerk stand auf zero.
Er hob das Smartphone in die Luft.
Ein lautes Surren pfiff heran. Der Schatten einer Flugdrohne sauste vorbei. Reißender Schmerz in seiner Hand. Fassungslos betrachtete Sven die fehlenden Fingerglieder. Das Telefon war verschwunden, wahrscheinlich irgendwo unterhalb aufgeprallt. Blut sickerte aus den offenen Stellen. Sven wandte den Blick ab, wollte das Weiß der Knochen nicht sehen.
Er langte nach den Randsteinen, zog kräftig, bis er mit dem Kopf darüber hinausschauen konnte. Zwei Meter, vielleicht etwas weniger. Da unten musste sein Handy sein.
Erneut schlugen die Drohnen zu. Stiche und Hiebe in Füße und Unterschenkel.
Auf einen weiteren Angriff wollte er es nicht ankommen lassen. Kopfüber stürzte er sich hinab, hielt sich fest, wo es ging. Doch es reichte nicht. Er verlor völlig die Kontrolle über seine Glieder. Ein Stein lag dort unten. Ein Findling.
Svens Kopf prallte dagegen. Der Wucht hatte sein Genick nichts entgegenzusetzen. Es brach.
Er bewegte sich nicht mehr. Seine Smartwatch sendete Alarm, übertrug das Ausbleiben des Herzschlags als Herzinfarktnotfall an das Muttergerät. Das Smartphone lag jedoch in Dutzende Teile zersplittert meterweit unterhalb des Toten.
Wie aus dem Nichts tauchten weitere Drohnen neben der Leiche auf. Greifarme packten zu, E-Motoren summten bis an die Belastungsgrenze, als der Körper weggezerrt wurde.
An den Rand der gepflegten Terrassenstufe schloss sich ein unkultivierter Natursteilhang an. Dichtes, wildes, von Menschen lange nicht bekämpftes Buschwerk. Wie der Korpus eines Crashtestdummys segelte Svens Leichnam hinab, als die Drohnen ihn über die Kante drückten.
Die dornigen Büsche öffneten sich ihm, verschluckten den Toten und bargen ihn sicher vor jedweder Entdeckung.
Der Arbeitsauftrag war vollendet. Die Maschinen drehten ab.
Auf der Straße sausten E-Autos unbekannten Zielen entgegen.
Das Display der Smartwatch am Handgelenk der Leiche zeigte neben dem Notfallalarm auch noch die Zahl 18 an. Achtzehn Dateien, die nicht in der Cloud landen würden.
Die Drohnen im Weinberg kehrten zu ihrem Tagwerk zurück. Nichts deutete darauf hin, dass sie einen Menschen getötet hatten.
Sie entfernten Unkraut, suchten nach Schädlingen und bekämpften sie. Der Tag startete wie jeder andere.
1. EGO
Wach auf!
Eine Stimme, ein Flüstern. Ein eindringlicher Befehl.
Es riss mich aus dem Schlaf und ich lauschte, ob es im Traum geschehen war oder wirklich jemand zu mir gesprochen hatte.
Stille. Doch auch das Grundrauschen meiner Implantate schien verschwunden. Dabei hatte es mich in den letzten Tagen so sehr gestört, dass ich sogar in den einschlägigen Patientenforen auf dem Uniserver recherchiert hatte, ob nicht ein weiterer Proband der Versuchsreihe von Störungen in den Geräten berichtet hatte.
Meine Suche war ergebnislos verlaufen.
Es ist Zeit, verhieß das heisere, aber deutlich zu verstehende Wispern.
Ich schlug die Bettdecke zur Seite, schwang die Beine über die Kante und setzte die Fußsohlen plan auf den angenehm temperierten, staubfreien Boden. Die Sensoren erfassten die Bewegung und die Lichtleisten in den Wänden spendeten warmweißes Licht. Ich atmete dreimal tief ein und aus.
Die Stimme schwieg. Ich musste mir eingestehen, dass es mir Unbehagen bereitete, neben meinen vielen anderen Einschränkungen nun noch einen unsichtbaren und wahrscheinlich eingebildeten Fremden flüstern zu hören. Ich, der Sonderling. Ego, wie ich von den meisten Kollegen genannt wurde.
Nackt, wie ich war, verließ ich den Schlafraum, öffnete die Tür zu meinem kleinen Bad und wusch mir das Gesicht. Im Spiegel entstand das Oval mit den Augen, den Ohren, der Nase, dem Mund.
Versuchsweise zog ich die Mundwinkel hoch und zur Seite, bleckte die Zähne. Ein armseliger Moment. Das Prozedere des Lächelns.
Ich griff nach der Zahnbürste und putzte mir die Zähne. Das leise Brummen des verbauten Motors drang klar zu mir durch.
Die Implantate funktionierten einwandfrei. Woher war dann die Stimme gekommen?
Als das Signal der smarten Bürste erklang, nahm ich sie heraus und schaltete ab.
Zurück im Schlafraum zog ich mich an. Eine graue Sporthose, die an mir schlackerte, wie mir zwei meiner Kolleginnen mit einem Kichern anvertraut hatten, und einen ebenso grauen Sweater, dessen Innenstoff sich angenehm anfühlte.
Grau, um nicht aufzufallen, um jederzeit mit der Umgebung verschmelzen zu können. Nur nicht ICH sein. Beachtet mich nicht. Ich bin Ego.
Licht füllte den Wohnraum, an dessen Seite eine Küchenzeile angebracht war. Den Tisch hatte ich unter dem Fenster positioniert. Daran sitzend aß ich mein Müsli und trank den heißen grünen Tee mit viel Zucker. Die Limettennote des Tees stach mir in der Nase.
Meine Aussicht war nicht so spektakulär wie die von Andy, deren Kubus dicht am Hang gelegen war. Wenn ich hinausschaute, sah ich Himmel, die Reihe von weiteren Wohnkuben und ein Stück weit den gegenüberliegenden Hang des Moseltals. Der Bereich gehörte zur Eifel und eine Straße verlief dort oben. Lastwagen mit hohem Aufbau konnte man vereinzelt sehen.
Ich kaute die Haferflocken methodisch. Der Tee schmeckte zu süß.
In der Kühlschranktür blitzte der Monitor auf und gab Alarm. Der Wecker, der mich an meine Arbeitszeit erinnern sollte.
Heute benötigte ich ihn nicht. Ich hatte gut geschlafen und war ausgeruht. Mit den letzten kühlen Schlucken des Tees warf ich zwei Tabletten ein, statt der meist verwendeten Maximaldosis von vier Einheiten.
Ich stellte Tasse, Schüssel und die Löffel in den Minigeschirrspüler. Anschließend setzte ich mich auf das Sofa und betrachtete meinen Zimmerbonsai. Den Literatenbaum hatte ich während meiner Kindheit im Zentrum erhalten. Mit einem wahrscheinlichen Alter von rund fünfzig Jahren hatte man mir die Pflege anvertraut und mir den Baum zum Abschied geschenkt.
Ich öffnete das Lederbündel neben der Schale, breitete es ordentlich aus und griff nach der Nigiri-Schere, die sich wie eine Verlängerung der Finger anfühlte. Am sechsten Ast spross ein neues, sehr vorwitziges Blatt heraus. Es verunstaltete den Gesamteindruck.
Ich legte die Nigiri an und schnippte es ab. Ein kleiner Tropfen entstand an der verletzten Stelle. Ich tippte ihn mit meinem Zeigefinger weg und leckte die Flüssigkeit auf. Es schmeckte nach Wald, oder so, wie ich mir Wald vorstellte. Erdig, frisch, moosig, als würde ich mit dem Kopf hineintauchen und Erde atmen können.
Natürlich schauderte mir davor, tatsächlich einen Wald zu betreten. Niemals, wenn ich es nicht musste.
Der zweite Alarm plingte. Zehn Minuten waren vergangen.
Ich musste los, strich die Schneiden der Nigiri ab, benetzte sie mit Öl und wischte sie mit einem Tuch trocken. Sorgfältig steckte ich sie an ihren Platz und rollte das Lederetui zusammen.
Ich erhob mich, bestätigte den Alarm am Kühlschrankmonitor und ging zur Tür. Mir schlug eine kühle Luft entgegen, als ich sie öffnete, gleichzeitig blendete mich die Sonne.
Ich entschied mich gegen eine Jacke, schloss die Tür hinter mir und joggte auf dem Weg zwischen den Wohnkuben in Richtung der Versuchsanlage. Dort wartete Arbeit auf mich.
Ich nutzte den Seiteneingang, der direkt in den technischen Bereich führte. So musste ich nicht durch die Weinkellerei, in der sich zu viele Menschen aufhielten.
Die KI öffnete mir bei Annäherung die Tür. Das gesamte Gelände war videoüberwacht, nur Befugte oder Registrierte hielten sich hier auf. Ich betrat das Innere, meine Implantate übertrugen ein kurzes Summen, wie sie es immer taten.
Raffaele trug eine übervolle Henkeltasse aus der Teeküche, kleckerte auf den Boden. Er sah mich, verriss die Hand und heißer Kaffee verbrühte ihn leicht. »Scheiße!«, stieß er hervor, blieb stehen, trank einen Schluck ab. »Ah, Scheiße! Zu heiß! Verdammte Maschine!«
Raffaele fluchte in 35 Prozent seiner Sätze. Andy hatte etwas von italienischem Temperament angedeutet. Ich hatte es gegoogelt und beschlossen, dass ich es sowieso nicht verstehen würde.
»Ah, Ego, mio caro. Der Prof hat dich gesucht. Er hat dir eine Mail geschickt.« Raffaele wartete nicht auf eine Bestätigung, sondern balancierte Tasse und sich selbst in sein Büro. Zusätzliche Flecken entstanden auf dem Boden, bildeten eine nachverfolgbare Spur.
Ich ging weiter, umkurvte die Verunreinigung auf dem glatten Linoleumboden. Wollte auch den Putzrobotern nicht im Weg sein, die sicherlich bereits auf dem Weg waren. Ich bog rechts ab entlang der Türenfluchten. Zwei Dutzend eingerichtete technische Arbeitsplätze, vierzehn waren derzeit belegt. Am Ende des Ganges, kurz vor dem Durchgang zu der eigentlichen Kellerei, öffnete sich mir die Tür zu Raum 132.
Darin befand sich mein Terminal. Ein Schreibtisch mit vier großen halbrunden Monitoren, die Tastatur, drei PC-Mäuse und mein anatomisch geformter Bürostuhl mit Kopfstütze.
Ich setzte mich, sank in die körperwarme Polsterung.
Die vier im Quadrat angebrachten Monitore flammten auf. Oben rechts ergossen sich Codezeilen von oben nach unten in dem Bildschirm. Ich musterte die Farben, die entstanden.
Ein ruhiges Violett waberte heraus. Störendes Rot blitzte auf und verschwand sofort wieder.
Natürlich sah nur ich diese Farben. Die Schrift selbst war neutralweiß und der Hintergrund dunkelgrau, fast schwarz. Aber meine Inselbegabung versetzte mich in die Lage, Codezeilen in Farben zu übersetzen. So wenig, wie andere es konnten, war ich fähig zu erklären, wie es funktionierte.
Und dennoch war der Professor mit mir zufrieden und hatte mich mit in dieses Projekt genommen.
Professor Leinefelde.
Ich checkte die Mails in dem Arbeitsmonitor unten links. Dorthin hatte ich das Intranet, unser Mail-Programm und die Daueranwendungen geschoben.
Im Postkorb blinkte ein grellroter Eintrag mit Ausrufezeichen auf.
Ich doppelklickte darauf.
Die E-Mail von Professor Leinefelde war kurz und enthielt einen Anhang.
- Isaia! – Er nutzte stets diesen ersten Vornamen, den meine Mutter ausgewählt hatte.
- Isaia!
Hier nun die zusätzlichen Codezeilen für das Unterprogramm 1705/2032 wie besprochen. Damit endet dieser Probelauf ab sofort. Bitte prüfe die Integrität von 2032 und die damit verbundenen 4215 und A4215.
Danke. -
Ich sah mir den Anhang näher an, schob die Programmzeilen auf den Arbeitsmonitor unten rechts. Ich vergrößerte die Anzeige, lehnte mich im Stuhl zurück. Der Scrollmodus setzte ein, ich vertiefte mich in die Datensätze, von denen es gleich achtzehn gab. Nichts Außergewöhnliches geschah. Es wirkte, als würde, bis auf wenige minimale Veränderungen, der Ursprungscode des 2032er-Algorithmus wiederhergestellt.
Ich hoffte, dass es ohne Probleme umsetzbar war, denn die neue Versuchsreihe war erst vorgestern von mir auf Anweisung installiert worden. Bedingt durch die dauerhafte Evolution der KI stellte jeder Rücksetzversuch ein Risiko dar. Datenverlust, falsch einsetzende Routinen, im schlimmsten Fall ein Notaus.
Ich würde vorsichtig sein müssen.
Aber dies gehörte zu meinen Aufgaben.
Ich rief das Arbeitsmenü auf, suchte nach den 2000ern und checkte, wann der letzte Zugriff auf 2032 erfolgt war.
Zu meiner Erleichterung hatte nur ich daran gearbeitet. Damit lag das Risiko eines Datencrashs schon nur noch bei unter fünf Prozent, wie die Vergangenheit bewiesen hatte.
Auf dem Monitor oben links flammte grellrot der Begrüßungsbildschirm der KI auf.
GUTEN MORGEN, EGO
Ich tippte ebenfalls ein Guten Morgen ein. Die KI interagierte mit uns ausschließlich im Spiegelraum. An diesem Terminal arbeitete ich nur mit einem Interface, das mir zu dem offiziellen, später für Besucher vorgesehenen Klon der KI Zugriff gewährte. Hier konnte ich dann auch die Auswirkungen zunächst testen. Wenn der Klon stotterte, durfte ich die Änderungen in den Codezeilen nicht freigeben.
Ich informierte die KI über die Trennung des Klons.
BESTÄTIGT,
erschien die Antwort unter meiner Begrüßung.
Nun isolierte ich in dem 2032er die Veränderungen im Unterprogramm 1705 und ersetzte sie durch die neuen Zeilen. Prüfsummen und Grundcheck schienen in Ordnung.
Ich drückte auf confirm und verfolgte den Ersetzungsvorgang.
Dann fütterte ich den Klon mit dem neuen 2032er.
Ich zwang mich zur Konzentration, musste an die Stimme in meinem Kopf denken, die mich geweckt hatte.
Konzentrier dich, Ego, ermahnte ich mich, ließ den abgewandelten 2032er in Dauerschleife ablaufen, versank in der kontinuierlichen Abfolge von wie Wasserfarben verlaufenden Schlieren, die aus dem Monitor flossen. Grün, gelb, ein wenig lila, alles in Ordnung.
Ich atmete dreimal tief durch.
Selbsttest, tippte ich die Anweisung an den Klon.
SELFCHECK RUNNING
PLEASE WAIT
Ich wartete.
NO OBSTACLE DETECTED
ALL SYSTEMS RUNNING
Zufrieden mit dem Ergebnis löste ich die Trennung des Klons auf.
Eine Instant-Message erschien auf dem Arbeitsmonitor.
- Isaia? -
Es war der Professor.
- Ja? -, sendete ich zurück.
- Wie weit bist du mit 2032? -
- Check abgeschlossen. Ich nehme jetzt die Eingabe vor. -
- Gut -, schrieb mir der Professor und gleich darauf noch ein – Danke -.
Ich öffnete die Übertragungsprogramme und transferierte die Veränderungen in Echtzeit in die KI.
Auf dem Hauptmonitor veränderte sich die Farbe der ablaufenden Zeichen nur minimal. Alles im Lot, wie Andy immer so schön zu sagen pflegte.
Ich rief die Aufgabenliste für den heutigen Arbeitstag auf. Viel Routine, was mir gefiel, zwei Prüfaufträge der Technik und gleich vier Anfragen zu heiklen Bereichen der Winzer und der Besucherzentrumssteuerung.
Ich schätzte den zeitlichen Anspruch auf etwa vierzehn Stunden, bei schlechtem Verlauf eher zweiundzwanzig. Daher priorisierte ich die Aufgaben neu.
Die Schicht startete jetzt erst richtig. Ich bildete mir ein, dass meine Implantate voller Freude surrten.
Für einen kurzen Moment quälte mich jedoch ein bohrender Zweifel.
Warum hatte der Professor die Änderungen an der 2032 wieder entfernen lassen? Eine Programmierung zurückgenommen?
Er musste wissen, dass nichts für immer gelöscht oder rückgängig gemacht werden konnte. Jede Veränderung des Codes zeigte eine Nachwirkung.
Der Vorhang aus Farben rann über den Monitor. Alles schien in Ordnung. Aber in meinem Kopf war eine Stimme gewesen.
Wach auf, hatte sie geflüstert.
Das Mittagessen in der Technik-Kantine gehörte nicht zu meinen bevorzugten Tageszeiten. Mein Therapeut hatte jedoch darauf bestanden, dass ich mich der Interaktion mit Menschen stellte. Professor Leinefelde hatte dem beigepflichtet und es angeordnet.
Meinen unzureichenden Versuchen, die Zeiten abzukürzen, war er mit einem straffen Zeitplan für die menschlichen Kontakte entgegengetreten.
So betrat ich pünktlich um 12 Uhr und 30 Minuten die Kantine, wich den wenigen Blicken aus, die beim Öffnen der Tür zum üblichen Verhalten der Anwesenden gehörten. Drei aßen bereits, Summer und Indira wie immer zusammen an einem der acht Tische.
Zu meiner Erleichterung war Andy zugegen. Sie löffelte achtlos eine heiße, dampfende Suppe in sich hinein, während sie gleichzeitig den Monitor ihres Tablets anstarrte.
Sie war die Unkomplizierteste der Normalen, akzeptierte meine mangelnde Kommunikationsbereitschaft, landläufig als selektiver Mutismus bezeichnet.
Ich durchquerte den Raum, wählte aus dem Menü der Automatenküche eine vegane Brühwurst mit Senf und Kartoffelsalat. Die Klappe öffnete sich binnen Sekunden.
Ich entnahm das Tablett und setzte mich Andy gegenüber. Sie sah kurz auf, die strahlend blauen Augen unter den dunklen Haaren verwirrten mich.
»Hi, Ego«, grüßte sie. Ihre Stimmlage war sehr tief für eine Frau. Sie sprach beinahe akzentfrei. Nur wenn sie aufgeregt war, hörte man eine regionale Färbung. Sie besuchte regelmäßig ihre Großeltern in Norditalien, war jedoch ganz in der Nähe der Versuchsanstalt geboren und aufgewachsen.
»Hallo«, antwortete ich, musste dabei eine hohe Klippe überwinden. Es fiel mir schwer, in den Small-Talk-Modus zu wechseln.
»Alles im Lot?«, fragte sie. Ihre Gesichtsmuskeln bewegten sich heftig. Die Augen etwas schmaler, die Mundwinkel … Sie lächelte mich an.
»Ja. Ich habe eine Menge Aufgaben.«
»Hast du auch mein Ticket gesehen?« Sie legte das Tablet beiseite und den Löffel in die Schüssel. »Boah, die Suppe ist schon kalt.«
Andy wusste, dass es mich verwirrte, wenn sie zu viele Informationen gleichzeitig über mich ergoss, es sei denn, sie hatten mit der Arbeit zu tun.
»Soll ich dir eine neue holen?«, erkundigte ich mich.
»Suppe? Nein. Das kann ich selber. Iss lieber deine Veggie-Frankfurter, bevor sie die Temperatur der Genießbarkeit unterschreitet.«
Ich biss gehorsam in die Wurst. Sie war äußerst fade.
»Wir müssen die Sensorik auf den Rebstäben neu programmieren, Ego. Es ist wichtig, dass wir in den kommenden Tagen die Hagelschirme ausfahren können. Es sind Unwetter prognostiziert.«
»Okay.« Meine Prioritätenliste der Aufgaben verschob sich erneut.
»Kann ich später zu dir kommen? Wir spezifizieren die Parameter und kontrollieren dann im Spiegelraum. Ist das okay für dich?«
Ich nickte mit vollem Mund.
Andy wischte sich durch die Anzeigen auf ihrem Tablet. »Wir können einen Zeit-Slot um 16 Uhr im Spiegelraum für eine Stunde haben. Passt das?«
Ich überschlug die anstehenden Arbeitsanweisungen, fügte Andys Ticket dazwischen und errechnete einen Puffer für Unvorhergesehenes. »Wenn du um 15 15 bei mir bist, sollte es klappen.«
»Du bist ein Schatz, Ego«, rief sie aus. »Ich reserviere uns den Spiegelraum.« Sie ließ ihre viertelvolle Schüssel auf dem Tisch stehen, als sie ging.
Ich genoss es, wieder alleine an meinem Platz zu sitzen, aß in Ruhe den Veggiefurter, übertünchte den fehlenden Geschmack mit viel Senf. Der Kartoffelsalat war matschig und übersäuert.
Als die halbe Stunde endete, stellte ich auch Andys Sachen auf mein Tablett und brachte es zur Rückgabe.
Raffaele tauchte mit großem Getöse auf, begrüßte die sechs Mitarbeiter, die inzwischen an den Tischen saßen. Keiner hatte mich angesprochen. Im Stillen dankte ich ihnen.
Andy traf pünktlich ein. Sie trug ihr Umhängeband mit dem Zugangs-QR-Code bereits bei sich.
Andrea Merino war unter ihrem Foto vermerkt.
Ich zog einen Rollhocker aus einer seitlichen Nische hervor und bot ihn ihr an.
Sie setzte sich. »Ah, du hast mein Ticket schon aufgerufen«, sagte sie.
»Ja.« Ich wollte ihr nicht erklären, wie ich die Zeit bei anderen Aufgaben eingespart hatte, also ließ ich es. Stattdessen öffnete ich die Datensätze mit den neuen Anordnungen für die KI.
Während des Kopiervorganges brach sich ein unerwarteter, weil spontaner Impuls Bahn. Ich sah Andy nicht an, aber plapperte einfach los, bevor mich der Mut verließ. »Hast du schon mal Stimmen in deinem Kopf gehört?«
»Stimmen? Du meinst nicht Selbstgespräche? Wenn man mit sich selbst schimpft, zum Beispiel?«
Andy war wirklich eine, die mich so gut es ging verstand.
»Nein. Eine echte fremde Stimme, die dir einen Befehl erteilt.«
»Hm.« Sie ruckte mit dem Hocker nach vorne, wie um etwas mehr in meinem peripheren Sehen aufzutauchen. »Du hast mir erzählt, dass du taub warst und man Implantate in die Ohren gesetzt hat, die es dir ermöglichen zu hören, nicht wahr?«
»Ja.«
»Könnte es dann nicht sein, dass die Implantate eine Fehlfunktion aufweisen? Stimmen vorgaukeln, die nicht real sind?«
»Im Forum hat niemand davon berichtet. Und es gibt Probanden, die diese Geräte deutlich länger tragen.«
»Okay.«
Ich schloss die Übertragung ab und ließ den Prüfvorgang folgen.
»Was ist mit einer Beeinflussung von außen? Könnten Funkwellen dafür verantwortlich sein?«
»Es geschah in meinem Wohnwürfel.«
»Oh.« Andy begriff.
»Meine Implantate sind zudem gegen Funk abgeschirmt. Aber solange ich mich hier auf dem Gelände der Versuchsanlage aufhalte …«
»Kann kein externer Funksender eine Rolle spielen«, ergänzte Andy. »Unsere Sperren sollten das verhindern. Ich werde mal bei Matti nachfragen, ob es eine Lücke in der elektronischen Sperrvorrichtung gab. Das könnte ja dann auch unsere KI beeinflussen.«
»Das ist korrekt«, sagte ich und gab die neuen Routinen frei. »Hast du schon einmal Stimmen in deinem Kopf gehört?«
»Nein, Ego. Es tut mir leid. Möglicherweise hat dir dein Gehirn auch nur einen Streich gespielt.«
Ich nickte. »Fertig.«
»Oh, das ging aber schnell.«
»Ja.« Ich checkte die Uhrzeit. »Wenn wir sofort losgehen, können wir vorab noch in die Kantine und uns Muffins holen.«
»Mit Kirsche und Schokolade?«, fragte Andy.
Mir lief das Wasser im Mund zusammen.
Ich sperrte das Terminal, hängte mir mein Band mit der Zugangscode-Karte um. Unter dem Foto standen alle Vornamen, die mir mein Vater und meine Mutter mitgegeben hatten.
Isaia, Constantin, Hannibal, Eike, Gunnar und Ove.
Eine Zeile tiefer der Nachname. Fielding.
Auf dem Foto hatte ich versucht zu lächeln.
Niemand störte uns in der Kantine. Andy bestellte je zwei Muffins für uns beide. Meine mit Kirschen und Schokolade. Ihre enthielten Karotten und Nüsse.
Als ich in den ersten Muffin biss, konnte ich kaum an mich halten. Umso größer war meine Enttäuschung. »Die Kirschen fehlen«, sagte ich.
»Was? Nein. Zeig mal.«
Ich tat es.
»Und der andere Muffin?«
Der versöhnte mich mit dem wunderbaren Geschmack von saftigen Sauerkirschen und dunkler Schokolade.
»Besser?«, riss mich Andy kurzzeitig aus dem wohligen Augenblick.
Ich nickte und spürte ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit.
2. EMMA
Die Videositzung war in wahren Sturzbächen aus Tränen abgesoffen. Marie-Alina glaubte nicht daran, dass es ihrer Mandantin am Ende geholfen hatte. Ein Termin für eine Offline-Sitzung schien bitter nötig.
»Aber es geht mir deutlich besser. Ich sehe wirklich klar«, behauptete die Mittdreißigerin mit den verheulten, rotgeränderten Augen tapfer. Ihr Gesicht teigig, der Teint verfleckt.
»Dennoch lege ich es Ihnen ans Herz, Frau Kwiatkowski«, insistierte Marie. »Wir sind gerade erst zum Kern durchgedrungen. Jetzt gilt es, neue Wege zu versuchen, in die Zukunft zu schauen und dorthin auch zu gehen.«
»Ich melde mich«, entgegnete die Mandantin und klickte sich aus dem Videochat.
Marie starrte den schwarzen Bereich auf ihrem Monitor an, betätigte zwei-, dreimal die Ruftaste. Aber ihre Mandantin nahm nicht ab.
»Life-Coach für’n Arsch«, murmelte sie, obwohl ihr klar war, dass solche Momente zu ihrem Berufszweig gehörten wie Stürze vom Dach zu einem Dachdecker.
Marie verließ den Platz in der Ecke ihrer Wohnung, den sie so sorgfältig hergerichtet hatte, um die Online-Beratungen mit einem ordentlichen Hintergrund auszustatten. Dabei wirkte es in ihren eigenen Augen künstlich, beinahe wie ein Bühnenbild. Der niedliche kleine Tisch mit dem gekauften Bonsai, der sich nicht gut hielt, neben dem Sessel, in dem sie saß und zentral in die Kamera des Monitors blicken konnte, sodass ihr digitales Gegenüber immer den Eindruck haben musste, dass sie ihm in die Augen sah.
Höhnisch blinkte die Abbruchmeldung.
»Ach, Scheiße«, fluchte sie hemmungslos. Sie nahm ihr Smartphone zur Hand und checkte die Termine für die kommenden Tage. Die Selbstständigkeit hatte sie sich anders vorgestellt. In ihren Träumen hatte sie an den romantischsten und schönsten Ferienorten der Welt gearbeitet, Menschen geholfen, ihr Leben zu verändern.
In der Realität lebte sie immer noch in dem winzigen Ein-Zimmer-Apartment, das ihre Eltern bezahlt hatten und in dem sie seit ihrer Studienzeit wohnte.
Der Kühlschrank füllte sich mit billigen Lebensmitteln leichter und an den letzten Einkaufsbummel, um sich neue Kleider zu kaufen, erinnerte sie sich kaum mehr.
Sie benötigte dringend lukrative Aufträge.
Sie rief die Mail der Uni auf. Die Einladung, als Life-Coach an einem Forschungsprojekt zu arbeiten. Die Bezahlung war in Ordnung, der Ort nicht allzu weit entfernt. Was sie aufgehalten hatte, den Job zu akzeptieren, lag in der Person des Projektleiters.
Professor Leinefelde hatte sie angefordert. Ausgerechnet ihr ehemaliger Prof für drei Semester.
Marie-Alina vergewisserte sich über die Summe der Dotierung. Es klang so einfach. Vier Wochen. Vier Wochen würde sie es schon aushalten.
Sie bestätigte die Mail und gab ihr Einverständnis. Lange musste sie nicht warten.
Das AD-Car von Auto-Drive-Car-Concept meldete ein Hindernis. Marie schickte die Textnachricht ab, steckte das Smartphone weg und blickte sich um. Von einem beinahe wolkenlosen Himmel strahlte die Sonne herab, füllte den Innenraum des selbstfahrenden Autos mit Wärme. Marie hatte nicht auf den Weg geachtet und stellte erstaunt fest, dass eine Schrankenanlage die weitere Zufahrt verhinderte.
Sie öffnete die Tür und stieg aus. Offenbar war das Auto vor etlichen Minuten in einen Feldweg abgebogen. Das erklärte dann auch das Ruckeln, welches sie ignoriert hatte.
Im böigen Wind wirbelten ihr die Haare immer wieder ins Gesicht. Sie hielt sie mit den Händen weg und sah zurück. Schnurgerade verlief der schmale Weg, vereinzelt schimmerte es silbern, wo Pfützen sich breitgemacht hatten. In einiger Entfernung stieß der Weg in einen Mischwald mit dichtem Baumbewuchs. »Bin ich etwa durch einen dunklen Wald gefahren?«, murmelte Marie. Sie checkte mit dem Smartphone ihren Standort. Die angegebene Adresse lag laut Anzeige noch rund einen halben Kilometer jenseits der Schranke, die mit einem geländegängigen Wagen kein Hindernis dargestellt hätte. Denn es gab keinen Zaun links und rechts der Schrankenanlage, die aus einem einfachen rechteckigen Kasten und dem daraus ragenden rot-weiß gestreiften Balken bestand.
Marie trat näher heran, fand heraus, dass es keine Gegensprechanlage gab.
»Mist!« Sie versuchte vergeblich die Schranke anzuheben. »Was soll das?«, stieß sie hervor. In der Ferne sah sie ein paar graue Würfel. Der Gebäudekomplex der Versuchsanstalt?
Sie überlegte, das AD-Car wegzuschicken und zu Fuß weiterzugehen. Dann dachte sie an den schweren Koffer und fluchte innerlich.
Der Wind trug ein leises Rattern mit sich.
Marie sah sich um. Von jenseits der Schranke rumpelte eine Art Golf-Karren über den unebenen Weg auf sie zu. Darin saß ein Mann, nein, ein Junge, verbesserte sich Marie, als er nahe genug heran war.
Schlamm spritzte auf, kleine Steine flogen durch die Luft, als der Karren auf dem nassen, unbefestigten Weg heranbrauste.
Der Fahrer schien Spaß zu haben. Sein Gesicht wirkte begeistert, während er das Lenkrad ausgiebig bediente. Er umkurvte mit waghalsigen Manövern einige Pfützen.
Kurz vor der Schranke winkte er, brachte das Gefährt zum Stehen. Es schlingerte ein wenig, die weiße Verkleidung an den Seiten färbte sich bräunlich.
»Hi!«, rief er, schwang die Beine heraus und kam näher. »Holten?«, fragte er. »Marie-Alina Holten?« Seine überlang wirkenden Arme bewegten sich wie Gummischläuche. Der ganze schlanke, fast zwei Meter hohe Körper verfügte über seltsame Proportionen. Ein Ziegenbärtchen schmückte das Kinn. Strahlend blaue Augen unter blonden Locken lächelten sie an.
Marie nickte. »Du kannst mich Emma nennen.«
»Emma also. Okay. Hi, Emma. Dein persönlicher Transporteur ist zur Stelle. Ismael.«
»Nenn mich Ismael?«, hakte Marie nach.
»Jep. Paps war Fan von Moby-Dick. Ich nicht. Ismael van der Houten.«
Marie sah an ihm vorbei. Der Karren bot gerade Platz für zwei Insassen. Ihr Gepäck würde gerade so auf die schmale Ladefläche passen. »Mein Koffer …«, begann sie. »Ich meine, kann ich nicht mit dem AD-Car zur Einrichtung fahren?« Sie dachte an den halsbrecherischen Fahrstil Ismaels.
»Nope! Schick die E-Schleuder weg. Ich nehme dich mit. Der Koffer ist im Auto?«
»Ja.« Marie ergab sich in ihr Schicksal. Während Ismael den Koffer heraushievte und ihn locker bis zum Golfkart trug, gab sie das Ende der Fahrt in den Bordcomputer ein und bestätigte die Rückfahrt.
Das AD-Car fuhr rückwärts auf dem Weg davon.
Ismael baute sich vor ihr auf. Marie musste zu ihm aufblicken. Er imitierte einen militärischen Gruß. »Bin bereit.«