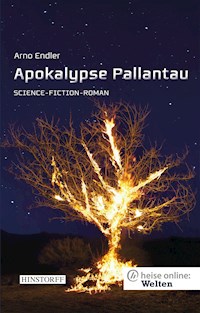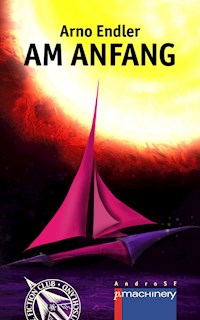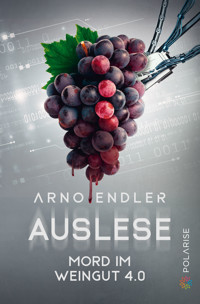Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Fälle der Charlotte Polson
- Sprache: Deutsch
Die schottischen Highlands. Atemberaubende Aussichten, Berge, das Meer, einsame Strände und zerklüftete Klippen. Charlotte liebt ihre Heimat, die Menschen und den Whisky. Mit ihren achtzig Jahren hat sie so einiges erlebt. Aber ein Toter? ... Hier? Beinahe vor ihrer Haustür? Dann verschwindet die Leiche und bevor jemand an ihrer Entdeckung zweifelt, beschließt die Betreiberin eines B&B, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen. Erstaunt muss sie feststellen, dass die langjährigen Freunde und Bekannten viele Geheimnisse hüten. Ist einer von ihnen ein Mörder?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover
Prolog
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Nach Kapitel Fünfzehn
Nachwort
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
— Gestatten? Eine wahre Maid of the Highlands — Heimat — Die Spürnase der Charlotte Polson —
Im Spülbecken gluckerte das restliche Schmutzwasser in den Abfluss.
Charlotte Polson spülte mit klarem Wasser nach, trocknete anschließend den letzten Teller, stellte ihn zurück in den Schrank zu seinen Verwandten und hing das Abtrockentuch an den Haken. Sie sah sich in der leeren Küche um, alles war sauber. Ihr Blick fing die schmucklose Wanduhr ein. Der Tag war noch jung, ihr einziger Gast bereits aufgebrochen und das Bett in dem Zimmer frisch gemacht. Nichts zu tun, außer dem Verstreichen der Zeit zu lauschen.
Charlotte lächelte bei dem Gedanken. Sie cremte sich die Hände ein und hypnotisierte das Smartphone auf der Tischplatte. »Melde dich, Darling«, murmelte sie leise, dann schnappte sie sich das Handy und verließ die Küche.
Es war einsam ohne ihre Freundin Mona, die heute jedoch endlich aus Deutschland zurückkehren würde.
Mona musste einige Dinge in ihrer alten Heimat klären, doch nun würde sie wirklich heimkehren.
Heim nach Lochaber, den vergessenen Streifen Landes abseits der Road to the isles, die von zahlreichen Touristen heimgesucht wurde. Was gab es an der Verbindungsstraße zwischen den Orten Fort William und Mallaig nicht alles zu sehen. Neben der fantastischen Aussicht auf das Meer, die Seen mit winzigen Inseln darin, den Silver Sands of Morar und schroffer natürlicher Landschaft, führte auch die Bahnlinie ein scheinbares Eigenleben, gekrönt vom weltbekannten Glenfinnan Viadukt. Der Jacobite-Train stampfte in der Saison darüber hinweg, verhüllte das liebliche Tal, in dem Highland-Games stattfanden, mit dichtem Dampf. Nahe des Lochs Shiel gab es auch noch das Mahnmal mit dem Highlander auf der Spitze.
Welchen Touristen interessierte da die unscheinbare Straße, die sich Richtung Nordwest davonschlich?
Charlotte trat vor die Haustür ihres Hauses, in dem sie zusammen mit Mona das Bed and Breakfast Quiet Place betrieb.
Neben der Haustür hing das Schild mit der Aufschrift, wunderschöne Lettern, frisch von Mona aufgepinselt.
Unter der Tafel schmiegte sich eine gemütliche Holzbank an die Mauer.
Charlotte ächzte ein wenig, als sie sich setzte. An niemandem gingen achtzig Jahre spurlos vorbei, dachte sie und begrüßte die bekannten Schmerzen in Hüften und Beinen mit einem Lächeln.
Die Seniorin mit den breiten Hüften und den schmalen Schultern hatte beinahe ihr gesamtes Leben in Schottland verbracht. Eine wahre Maid of the Highlands. Kein Grund, vor ein paar winzigen Unannehmlichkeiten wie kleine Alterswehwehchen zu kapitulieren.
Sie blickte auf die wunderschöne Szenerie, die sie umgab.
Quiet Place mochte als Bezeichnung für Touristen taugen, doch Charlotte hörte die vertrauten Laute ihrer Heimat. Der böige Westwind umschmeichelte sie, Möwen kreischten und ein leises Schafgeblöke erreichte ihre Ohren. Sie schloss die Augen und genoss den Augenblick. Ja, Charlotte liebte diesen Ort, saugte alle Geräusche in sich auf und schöpfte aus dem Konzert der Natur ihre Kraft.
Es kribbelte in ihrer Nase. Sie hob die Lider, betrachtete den Wolkenzug am Himmel. Es würde ein Unwetter geben, soviel spürte sie.
Doch ihre Nase meldete sich selten ohne Grund. Etwas würde geschehen.
Nur was?
Charlotte erhob sich, strich Dreck von der Hose.
Ein Kribbeln in der Nase. Hoffentlich ist Mona bald zu Hause, dachte die Schottin.
Wenn sie geahnt hätte, dass in den folgenden Tagen eine verschwundene Leiche, sie und alle ihre Freunde und Bekannten in helle Aufregung versetzen würde, wäre sie nicht so ruhig zurück ins Haus gegangen.
Aber noch war es nur ihre Spürnase, die von den kommenden Ereignissen zu wissen schien.
Kapitel Eins
— Eine Heimkehrerin hört Nachrichten — Im Pub wird über Probleme diskutiert — Eine Influencerin sucht nach dem Netz — Im Old-McManor-House herrscht schlechte Stimmung — Scones werden gebacken — Der Sturm kommt —
Der Duft des Ginsters nahm sie gefangen. Durch das geöffnete Fenster ihres Mietwagens fegte der Geruch herein, durch sie hindurch und wärmte ihr Herz.
Mona hob den Fuß vom Gaspedal und ließ den klapprigen Wagen, der inzwischen drei Dellen mehr hatte, ausrollen. Sie bremste in einer der zahlreichen Haltebuchten ab, die für die Single-Line-Traffic-Road typisch waren, damit zwei Fahrzeuge aneinander vorbeikamen.
Noch befuhren nur wenige Touristen die Straßen, da die Hauptsaison erst bevorstand. Daher begegneten der jungen Frau so gut wie keine Autos.
Mona stellte auf P und drückte die Stop-Taste des Vauxhall. Der Motor erstarb und nun hörte sie es endlich:
Das Geräusch der Wellen unten an den Felsen, das Rauschen des Windes in den Bäumen und den dichten Büschen voller gelber Blütenblätter.
Sie stieg aus. Ein metallisches Quietschen der schlecht geölten Tür klang überlaut in ihren Ohren. Sie warf die Autotür zu, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Seite des Wagens und blickte sich um.
Das wohlige Gefühl, eine Mischung aus Entzücken und Erleichterung, übermannte sie beinahe. Wieder zurück. In der Wahlheimat, dem Schutzhafen Schottland. Zu dem Duft des Ginsters gesellte sich die frische Brise des Meeres.
Endlich weg vom Verkehrslärm und Gestank, den tausenden Menschen, die nur Hektik und miese Laune verbreiteten. Weg von Hamburg, wo nur die Erinnerungen an eine gescheiterte Ehe und eine furchtbar arrogante Scheidungsanwältin lauerten.
Möwen kreischten und jagten sich gegenseitig.
Mona lächelte. Am Horizont über der offenen See braute sich eine dunkle Wolkenmasse zusammen. Hier wechselte das Wetter schnell und man musste deshalb jeden Sonnenstrahl genießen.
Es wurde Zeit. Charlotte wartete sicherlich schon auf sie.
Wind kam auf, packte Monas lange braune Haare und wirbelte sie umher.
Sie stieg wieder in den Vauxhall und startete den Motor.
Das Radio sprang an und silberklare Harfenklänge füllten das Auto, bis sie endeten und eine Frauenstimme die eingetretene Stille ablöste. Sie betonte die Worte mit hartem Akzent, mehr walisisch als schottisch, aber dennoch sprach sie Loch wie Loch aus und nicht lock, wie es beinahe jeder in Großbritannien tat, außer den Schotten.
»Heimatkunde und Heimatnews mit Sally von Sender Four-o-four. Danke, dass ihr zuhört!«
Ein kurzer Jingle aus schottischen Bagpipes und Drums erklang, dann setzte die Radiomoderatorin wieder an: »Da leben wir nun, umgeben von Bergen und Loches inmitten einer der schönsten Landschaften. Nicht weit entfernt, befinden sich die Tourismusmagneten: Das Glenfinnan-Viadukt und Monument, das Eilean Donan Castle, die Road to the Isles und die Inseln Skye, Rum und Eigg. Doch verirren sich mehr als ein paar Hundert Besucher im Jahr zu uns? Nein. Trotz der grandiosen Schönheit der Natur, des Meeres, der Buchten, der Berge, Moore und dem Wild, das hier ungestört lebt.«
Eine Pause entstand. Die Frau holte tief Luft, als würde sie Anlauf nehmen, um von Klippe zu Klippe zu springen. »Die Zentralregierung in London kümmert sich nicht darum, schützt mehr oder weniger nur die Umwelt, was selbstverständlich auch gut ist, uns aber nicht weiterhilft. Die Übernachtungszahlen in den Lodges und den B&Bs sind weiter zurückgegangen. Trotz aller Bemühungen. Ich persönlich genieße die Einsamkeit und Ruhe. Für unsere Wirtschaft sind es doch Pluspunkte, Aktivposten, mit denen wir aus der Masse herausstechen. Aber es ist problematisch, wenn die Touristen uns links liegen lassen. Es sind nur wenige, die von den Reisenden leben, aber diese sehen sich einem Problem ausgesetzt.«
Ein leises Pfeifen erklang, mit dem die Sendung unterbrochen wurde.
»Dies sind die News für Lochaber. Es sind keine guten. Aber wann verkünden die Nachrichten schon mal Good News.«
Die Moderatorin setzte nach einer Pause erneut an: »Unser Paradies könnte bedroht sein. Ein lange Ferngebliebener ist zurück. Der Erbe des Hauses McManor ist back in town. Und ihr, meine lieben Zuhörer, wisst, was das bedeutet. Alte Rechnungen werden präsentiert, Schulden eingetrieben, Gefallen eingefordert. Bereitet euch vor. Ich bin Sally vom Sender Four-o-four, das Wetter wechselt auf stürmisch. Weiter geht es mit Musik.«
Mona fuhr mit gemäßigtem Tempo die Straße entlang. Ob die Wolkenwand über dem Meer schon von Sallys angekündigtem Sturm getrieben wurde?
Sie lenkte den Wagen in eine enge Rechtskurve, ein Reifen sackte in ein tiefes Schlagloch und es schepperte vernehmlich.
Mona machte sich jedoch mehr Gedanken um den Erben des Hauses McManor. Seit sie hier lebte, war der alte Herr von Old-McManor-House noch nie vor Ort gewesen. Drei Angestellte wohnten dort und hielten Anwesen und Garten in Ordnung. Martha Bientowitz war ihr eine gute Freundin geworden und das, obwohl ihr Ehemann Tymi ein recht zwielichtiger Mensch zu sein schien.
Der dritte im Bunde kümmerte sich um die Grünanlagen des herrschaftlichen Anwesens. Peter, der in jeder Siebzigerjahre-Brit-Crime-Serie als Ermittler durchgegangen wäre.
Auch er war immer nett zu Mona gewesen und beherrschte sogar ein paar Brocken Deutsch. Er versorgte Charlottes und Monas B&B mit frischem Gemüse und Salat aus dem Garten des Old-McManor-Houses.
Jetzt trat ein Erbe auf den Plan. Das würde Unruhe bringen. Und wenn die Bewohner dieses einsamen Landstriches eines wussten, dann, dass Unruhe nicht gut war.
In der nächsten engen Rechtskurve klapperte es vernehmlich vorne rechts. Die Straße verbreiterte sich danach, die Aussicht öffnete sich hin zum Meer. In Sichtweite lag die Tankstelle mit dem angeschlossenen kleinen Tesco-Supermarkt.
Mona steuerte den Vauxhall auf den Parkplatz, stoppte und stieg aus.
Die Automatiktüren der Tankstelle glitten zur Seite und Sophie Hall trat heraus. »Mona!«, grüßte sie die Wahlschottin. Seitdem sie zusammen mit Charlie das B&B betrieb, waren die Sympathien, die Charlotte entgegengebracht wurden, zum Teil auch auf sie übergegangen. Niemand störte sich an Monas deutschem Akzent, jeder freute sich, dass Charlotte Gesellschaft hatte.
»Hi, Soph«, erwiderte Mona den Gruß und beugte sich herunter, um in den Radkasten des vorderen rechten Rads zu spähen.
»Was ist geschehen?«, fragte Hall, deren kurze blonden Haare im Sonnenlicht leuchteten.
»Schlagloch. Es klappert.« Mona sah, dass der Kotflügel ein wenig verrutscht war.
»Nichts, was man mit Panzertape nicht fixen könnte.« Hall inspizierte die losen Teile. »Ich mach das schon.« Sie lächelte. »Und du solltest schnell nach Hause. Charlotte macht sich sicher schon Sorgen, denn es zieht ein Unwetter auf.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass Charlotte sich vor einem Sturm sorgt. Es wird nicht der erste sein«, meinte Mona.
»O ja. Das ist richtig. Und ich denke, sie sorgt sich mehr um dich als um sich selbst. Dennoch ist jedem hier wohler, wenn du bei ihr bist. Sie ist nicht mehr die Jüngste.«
»Aber wettererprobt.«
»Wetterfest. Stimmt. Ja. Ich hole das Tape.«
Karg eingerichtet und zu dunkel. Es war die einzige Bewertung in einem der zahllosen Pub-Guides und die lag auch schon einige Jährchen zurück. The Pirates Parrot!
Doch obwohl der Besitzer gewechselt hatte, die Zeit gerast und das Internet alles verändert hatte, bis auf das Leben der Menschen in den abgelegensten Regionen der Highlands, hätte jeder dieser abfälligen Aussage wahrscheinlich zugestimmt.
Zwei Flachbildfernseher von minderer Qualität hingen an den Seitenwänden und wirkten wie schwarze Löcher, in die sämtliches Licht hineingesogen wurde.
Hinter dem Tresen putzte Connor Askaig Gläser und stellte sie zurück in die Schränke. Musik drang aus der schmalen Durchreiche zur Küche. Eine Sängerin war zu hören, die auf Gälisch eine Ballade vortrug. Connor summte die Melodie falsch mit.
Ein Touripärchen, Studenten, wie Connor vermutete, saßen an einem der flachen runden Tische neben dem Ausgang und diskutierten leidenschaftlich über eine neue Wandertour. Beide hielten Smartphones gezückt und deuteten auf die jeweiligen Displays. Ihr breiter amerikanischer Akzent hallte durch den Raum. Es war elf Uhr, gerade mal eine halbe Stunde seit Öffnung. Adam Kieran saß mit düsterem Gesichtsausdruck am Tresen und beobachtete, wie die dünne Schaumschicht auf seinem Bier sich auflöste.
Connor griff sich zwei schmale Gläser für die kleinen Tröster, wie er es immer nannte. An der Wand hingen kopfüber acht Flaschen mit einem Portionierer am Ausguss. Er entschied sich für einen Talisker und presste die Gläser gegen den Ausguss, die sich mit goldgelber Flüssigkeit füllten.
Er stellte eines neben das Bierglas Adams und stieß mit dem zweiten dagegen. »Nimm einen Single, Adam. Du siehst so aus, als hättest du ihn nötig.«
Kieran sah mit dunklen Ringen unter den Augen zu ihm auf und verzog das Gesicht zu einer Art dankbaren Lächelns.
»Ärger zu Hause?«, erkundigte sich Connor.
Kieran schüttelte den Kopf, »Nein. Mit Elsie ist alles in Butter.« Er zog den kleinen Tröster zu sich heran, beugte die Nase vor und nahm einen kräftigen Zug der alkoholhaltigen Dünste. »Mhm. Der Atem der Engel. Talisker?«
»Was sonst«, bestätigte Connor. Er nickte dem Mittfünfziger mit den schütteren Haaren und der Hakennase zu.
Beide tranken einen Schluck.
»Ahh. Lecker«, bekannte Kieran, dessen Falten sich auf der weiten Stirn geglättet hatten. »Wenn nur alles auf der Welt mit einem Single Malt zu klären wäre.«
»Erzähl.« Connor beugte sich vor, lehnte sich mit den Unterarmen auf den Tresen und sah Adam Kieran auffordernd an. »Schmerzen? Sorgen? Geld?«
»Geld, was sonst.« Kierans Blick verlor sich im Rest des bernsteinfarbenen Malts. »Es war eine Scheiß-Saison im letzten Jahr. Wenn es so weitergeht, können wir die Lodges nicht halten.«
Connor wusste von der schlechten Auslastung der Ferienhausanlage, die nur ein paar Meilen von seinem Pub entfernt direkt am Meer gelegen war. Adam und seine Frau Elsa betrieben sie nun im zehnten Jahr. Je nach Wetter gingen die Geschäfte mal besser, mal schlechter. Die Touristenhotspots lagen nun mal nicht in dieser menschenleeren Gegend, sondern entlang der Road to the isles. Es verirrten sich nur wenige Touris hierher.
»Die Kredite sind einfach erdrückend. Liegen manchmal nachts wie tonnenschwere Betonbrocken auf mir.«
»Das Geld. Das liebe Geld«, murmelte Connor. »Ihr schafft das bestimmt. Ihr habt es bisher noch immer hingekriegt.« Er spürte jedoch selbst, wie schwach seine Aufmunterung klang, kannte diese Art von Ängsten nur zu gut.
Auch er hatte solche Zeiten erlebt. Wenn die Schulden einen erdrückten und man nicht mehr atmen konnte. Er war dem Teufel von der Schippe gesprungen. Aber für wie lange?
»Wie schaffst du das nur?«, fragte Adam, sah sich um und deutete in den weiten Raum hinein. »Das kann doch nicht reichen.«
»Maddie und ich brauchen nicht viel. Und ich habe ein Haus in Morar, meine Sicherheit, falls es mit dem Geld doch mal knapp werden sollte.« Connor verstummte abrupt. Denn was er nicht erwähnte, war, dass irgendwo in London noch ein Schuldschein in den Händen von Männern lag, mit denen man besser keine Geschäfte machen sollte.
Er durfte nicht daran denken, was passieren würde, wenn diese herausfanden, wo er lebte. Ein Versteck am Ende der Welt und ein Name, der nicht der seine war. Siebzehn Jahre hielt seine Tarnung nun bereits.
»Sorry«, unterbrach nun der amerikanische Student die beiden Männer. Er hatte sich zu ihnen gesellt.
Connor sah ihn an. »Hm?«
»Ähm. Dieser Weg hier«, sagte der Tourist in den wetterfesten Wanderklamotten und legte sein Smartphone mit dem übergroßen Display auf den Tresen. Darauf war eine Karte der Umgebung zu sehen. Ein blaues Band schlängelte sich in die Berge. »Ist der Weg begehbar? Da sind Flüsse und ein Moor, nicht wahr?«
»Haben sich schon viele in den Bergen verirrt«, gab Connor zurück. »Nicht alle sind wiedergekommen.«
»Hören Sie nicht auf ihn«, widersprach Adam Kieran. »Es sind nur zwei Stellen, an denen Sie durch Wasser müssen. Hier und hier. Aber es hat in den letzten Wochen nicht so viel geregnet. Der Wasserstand der Bäche wird nicht allzu hoch sein. Mehr als nasse Schuhe werden Sie sich da nicht holen.«
»Super! Fantastisch. Danke.« Der junge Amerikaner packte sein Handy weg und vibrierte nur so vor Energie, als er zu seiner Freundin an den Tisch zurückkehrte.
Connor spürte einen Hauch von Neid, konnte sich aber nicht erklären, woher diese Empfindung kam.
Die Doppelflügeltür des Eingangs schwang kraftvoll auf.
»Doc!«, grüßten Adam Kieran und Connor im Chor.
Der alte Arzt trug sein typisches Outfit: grüne Jägerklamotten, Gummistiefel und einen australischen Outbackhut, von dem die Bommeln abgefallen waren. Er humpelte ein wenig, was der kühleren Jahreszeit geschuldet war. Im Sommer schienen seine Muskeln und Knochen besser zu funktionieren.
»Connor, Adam. Ein schöner Tag ist es heute, nicht wahr?« Der Arzt kam an den Tresen und keuchte. »Trockene Kehle. Zwei Helle bitte.«
»Zwei?« Connor musste schmunzeln, schnappte sich aber die Gläser, und begann zu zapfen.
»Eines für Paul. Der kommt gleich.«
Auf Kierans Stirn bildeten sich Falten. »Mittags an einem Werktag? Ist er nicht im Dienst?«
Doc schüttelte den Kopf. »Ich musste ein Schaf von McDougal einfangen. Auf dem Rückweg habe ich Paul eingesammelt. Er war in ein Loch getreten. Hab sein Bein getapt und ihn auf ein Trostbier eingeladen.«
»McDougal und seine Schafe«, warf Connor dazwischen. »Er sollte endlich den verfluchten Zaun reparieren. Eines Tages wird ihm mehr als ein Tier abhandenkommen.«
Doc nahm sein Bier in Empfang, hob es wie zum Gruß in die Höhe, bewunderte kurz die Farbe und trank einen kräftigen Schluck.
»Ahh. Das kühlt.« Er legte seinen Hut auf einem der beiden Barhocker ab, die niemand je benutzte, weil sie wackelten wie nach einem Erdbeben. »Es waren diesmal wohl Wanderer, die an einer unübersichtlichen Stelle den Zaun plattgetreten haben.«
»Hey! Macht keinen Unsinn!«, appellierte Connor in Richtung des amerikanischen Pärchens. »Bleibt auf den Wegen und tretet nicht irgendwelche Drähte nieder.«
»Yes, Sir!«, rief der junge US-Boy, grüßte und schulterte den mächtigen Rucksack. Seine Freundin nahm den kleineren. Sie winkten zum Abschied und verließen das Pirates Parrot.
Die Schwingtür stand kaum wieder still, als ein schlanker, in ziemlich verdreckten Tweedklamotten gekleideter, durchtrainiert wirkender Mann mittleren Alters eintrat.
»Paul!« Doc hob die Hand und deutete auf das volle Glas. »Hier ist dein Helles.«
Paul Laing wohnte zusammen mit seiner Mutter in einem kleinen Haus mitten in Morar. Er hatte bereits drei Beförderungen zum Detective Inspektor abgelehnt, um weiterhin in der Mallaig-Station als einfacher Officer arbeiten zu können. Tatsächlich lief wenig ohne den ortskundigen Laing, wenn es denn mal zu einer Ermittlung kam.
Laing sah sich um, dann humpelte er weiter auf den Tresen zu. »Hat den beiden gut ausgestatteten Touristen jemand gesagt, dass sie keine Zäune umtreten sollen?«
»Haben wir«, meinte Adam
Connor schob das Glas dem Polizisten in Zivil zu. »Hast du frei?«
»Ja, zwei Tage. Habe Maire nach Inverness ins Krankenhaus gefahren.«
»Wieder diese Strombehandlung?«, erkundigte sich Doc.
Paul Laing nickte und trank in großen Schlucken von seinem Bier. »Ihr tut es gut. Dann geht sie für einige Zeit schmerzfrei.«
»Wenns hilft«, murmelte Doc. »Ich denke, sie sollte sich mehr bewegen.« Er widmete sich seinem Bier.
»Was hast du mit deinem Bein gemacht?«, fragte Connor den Polizisten.
Paul Laing trank, wischte sich danach Flüssigkeit von der Lippe und wirkte plötzlich übel gelaunt. »Nicht aufgepasst, ich Idiot. Manchmal möchte man sich für die Blödheit, die man an den Tag legt, selbst schlagen.«
»Stimmt«, bekräftigte der Doc. »Warst du wandern?«
»Jepp. Wollte den Küstentrail nehmen, wo ich schon mal frei hab. Die Gelegenheit war günstig. Und dann das. Meine Karre steht da noch auf einem Parkplatz.«
»Ich kann dich fahren«, meinte der Arzt und leerte sein Glas. »Noch eins, bitte«, bestellte er bei Connor. »Mit dem Tape wirst du Gas geben und bremsen können. Du hast auf jeden Fall Glück gehabt«, sagte er an Paul gewandt.
»Wieso?«
»Ist heftiges Wetter auf dem Weg«, trug Adam zur Unterhaltung bei. »BBC2 hat einen Sturm angekündigt.«
»Wer traut schon BBC2«, zweifelte Paul. »Was berichtet denn Four-o-four?«
Connor nahm das als Aufforderung und sah auf die Uhr. An der hinteren Wand, direkt zwischen Kasse und Getränkeregal, war ein altes Radio verbaut worden. »Ist gleich 12.«
Sender Four-o-four war der einzige Kanal, den er im Pirates Parrot empfangen wollte. Ein illegaler Piratensender, allerdings eine unverzichtbare Quelle für lokale Neuigkeiten.
Leise Musik kam aus den Lautsprechern. Eine unbekannte schottische Folkband, die einen gefühlvollen Vortrag über die Einsamkeit und Schönheit der Highlands zum Besten gaben. Der Dudelsack klang etwas verstimmt, aber niemanden schien es zu stören.
Die Männer tranken schweigend, warteten auf die volle Stunde.
Mit einem dreifachen Tonsignal verkündete der Sender, dass es zwölf Uhr schlug.
Doc kontrollierte die Uhrzeit seiner Armbanduhr und stellte sie nach.
Eine sehr tiefe Frauenstimme, die vom Alter her nur schwer einzuschätzen war, räusperte sich, dann sprach sie: »Dies ist Sender Four-o-four mit den Nachrichten um Zwölf. Doch bevor wir zu den Meldungen kommen, möchte ich kurz eine Warnung durchgeben. Ein Sturmtief rast von Grönland her auf uns zu. In ungefähr zwei Stunden sollten die ersten Ausläufer Skye erreichen. Der Fährbetrieb ab Mallaig wird bereits eingestellt. Der Peak des Sturms mit Windgeschwindigkeiten um die 100 Meilen pro Stunde, wird uns etwa gegen zwei Uhr nachmittags treffen. Sichert die Boote und bringt das Vieh in Sicherheit.«
»Heilige Sch...«, entfuhr es Connor. »Wohin sind die beiden Touris auf dem Weg, Adam?«, fragte er Kieran. »Du hast sicher den Weg gesehen. Auf dem Smartphone, meine ich. Die hatten doch eine App, nicht wahr?«
»Klar. Habe ich.«
»Dann hinterher«, ordnete Paul an. »Wir können die jungen Leute nicht einfach in ihr Verderben laufen lassen.«
»Ich fahre«, bestimmte Doc. »Mein Range Rover ist langsam, aber wir sind allemal schneller als zwei Zivilisationsmüde, nicht wahr?«
Paul Laing blieb, bewegte sich zunächst nicht. Er trank sein Bier leer. »Für einen Torabhaig, Fassstärke, sollte es noch reichen, findet ihr nicht?«
Connor stellte für jeden ein Glas auf den Tresen, griff unter die Bar und präsentierte eine Flasche, die bereits geöffnet war und keinerlei Etikett trug.
»Ich liebe es, dass du die Kontakte zu Millies Schwager aufrechterhalten hast«, meinte Paul.
»Ist so«, bestätigte Connor und schenkte großzügig ein. »Was wären wir nur ohne gute Kontakte?«
»Sláinte«, prosteten sich die Männer zu.
Vor dem unscheinbaren grauen Haus standen mehrere hölzerne Bänke, daneben Schirmständer, in denen nicht aufgespannte Sonnenschirme steckten. An der Seite lag ein kleiner Parkplatz für acht Autos, wenn sie eng parkten.
Das alles nur rund fünfzig Meter von der eigentlichen Landstraße der A861 entfernt. Ein nicht geteerter Weg mit einigen Schlaglöchern und Pfützen führt bis dorthin.
An der Straße wies ein handgeschriebenes Schild auf das Café hin.
Café Clotted Cream las man in wunderschön geschwungenen tiefdunkelblauen Buchstaben auf kanarienvogelgelbem Hintergrund. In kräftigem Rot umrahmte eine gewellte Linie die Schrift. Dazu verwies ein dunkelroter Pfeil auf die Abzweigung.
Eine Frau in hypermodernen pastellfarbenen Wanderklamotten stoppte an dem Schild, reckte den rechten Arm in die Höhe. In der Hand hielt sie ein Smartphone. Sie fluchte in einer Sprache, die hier nur wenige Leute verstehen würden.
Ihre Kleidung wirkte so neu, als hätte sie diese gerade erst in einer Boutique erworben, was auch der Wahrheit entsprach. Weiter vor sich hin murmelnd blickte sie zu dem Gebäude, dessen Tür offenstand, und betrat den unebenen Weg.
Ohne Unterlass begaffte sie das Display des Smartphones, richtete es in verschiedene Richtungen, schüttelte den Kopf und übersah daher eine Pfütze, in die sie mit einem lauten Platschen trat.
»Scheiße!«, fluchte sie auf Deutsch, denn das war die Sprache, die sie nutzte. Braune Schmutzflecke verteilten sich bis übers Knie an beiden Beinen. Der wunderschöne Eindruck auf den Fotos für ihren Kanal wäre damit dahin. Sie würde dem Werbepartner sicher keinen Gefallen tun mit dreckverschmierter Kleidung zu posen.
»Kann ich Ihnen helfen?«, riss eine melodisch klingende Altstimme die Influencerin aus ihrem Ärger. Sie sah der älteren, freundlich wirkenden Dame, die am offenen Eingang zum Café stand mit wachsender Hoffnung entgegen, eilte auf sie zu und lächelte. Denn sie wusste, dass ihr Lächeln ihr Kapital war.
»Hallo«, grüßte sie und sprach dann in einem entsetzlichen Akzent auf Englisch weiter: »Ich habe kein Netz. Ich suche ein Netz. Sonst kann ich nicht arbeiten.«
Im Gesicht der vielleicht Mittsechzigerin zeigte sich ein verwirrter Ausdruck.
Im Inneren des Cafés brandete der unverkennbare Lärm eines Handrührers auf, der mit dem Geräuschpegel eines Presslufthammers jegliche Konversation im Keim erstickte.
»Netz, Internet, Sie verstehen?«, brüllte die Influencerin.
Die Dame des Hauses nickte, wandte sich um und übertönte locker den Krach: »Sammy! Mach mal Pause!«
Stille.
Nur der Wind pfiff noch um das Gebäude herum, zerzauste die sorgfältig hergerichtete Frisur der netzlosen Influencerin.
»Kommen Sie doch auf einen Scone herein. Sind im Ofen und gleich fertig, Sie können es schon riechen. Wenn Sammy dann die Clotted Cream geschlagen hat, ist der Tag gerettet.« Sie machte eine einladende Geste und trat zur Seite.
Die jüngere Frau stöhnte theatralisch auf, wandte sich brüsk um und stakte davon, diesmal achtsamer, zumindest was die Pfützen anging.
Kopfschüttelnd sah die Betreiberin des Cafés der Touristin nach. »Ich würde Ihnen auch das WLAN-Passwort geben«, murmelte sie leise. »Aber wenn Sie nicht wollen …«
»Neue Generation, ich weiß nicht«, bekannte Simona Tavish und kehrte in den Gastraum des Cafés zurück. Fünf Tische und zehn Stühle befanden sich darin, alles Einzelstücke. Die blauweißen Tischdecken leuchteten in den schottischen Nationalfarben. An den fliederfarben gestrichenen Wänden hingen rund ein Dutzend Fotos aus den längst vergangenen Tagen der Landflucht. Familien vor ihren kargen Farmhäusern, schmutzige Gesichter und viele Kinder waren darauf zu sehen.
Am Stirnende des Raumes befand sich ein Tresen mit Glaseinsatz. Den hatte sie einst von einem königlichen Butcher gekauft, da die Kühlung wichtig für sie war.
Für die wenigen Kunden, die sich hierher verirrten, präsentierte sie dort die selbst gemachten Kuchen und natürlich die namensgebende Spezialität: Clotted Cream. Fett und lecker. Dazu die hausgemachte Erdbeermarmelade. So war der Name des Cafés entstanden.
Simona registrierte den fragenden Blick Sammys, die hinter dem Tresen stand, eine Plastikschüssel in der einen, den Handmixer in der anderen Hand.
»Mach ruhig weiter, Liebes«, sagte Simona und schenkte ihr ein Lächeln.
Sammy nickte. Sie trug ein violettes Kopftuch, sodass von ihren strohblonden Haaren nichts zu sehen war. Seitdem sie in dem Gästezimmer im oberen Stockwerk wohnte, hatte sie kein Wort gesprochen. Es schmerzte Simona, da sie gerne erfahren hätte, was Sammy auf dem Herzen lastete, aber sie akzeptierte das freiwillige Schweigegelübde der Mittzwanzigerin. Sie erledigte die Arbeit im Café ohne Murren und war Gesellschaft genug für Simona. Nach dem Tod ihres geliebten Arthurs war die Einsamkeit wie ein Wintersturm über sie gekommen. Die Tage fühlten sich lang und dunkel an. Erst mit der Ankunft der jungen Frau fand die Witwe wieder ins Leben zurück.
Der Handmixer brüllte wieder auf. Sammy schlug die fette Sahne zur Clotted Cream auf.
Der Duft der Scones im Ofen füllte inzwischen den ganzen Raum. Simona würde sich den ersten noch heiß genehmigen, so viel stand fest. Mal sehen, ob an diesem Tag Kundschaft die Kasse zum Klingeln brachte, dachte sie, trat hinter den Tresen und lächelte Sammy zu.
Das schmutzig-graue Gebäude wirkte wie aus der Zeit gefallen. Inmitten der nicht allzu umfangreichen Parkanlage ragte es aus dem Boden heraus. Ein Ungetüm aus Stein, aschgrau, die Fenster so gleichmäßig wie lieblos über die gesamte Front verteilt. Eine Treppe mit beidseitigem Zugang führte hinauf zur bräunlich-grauen Eingangstür, die einen neuen Anstrich nötig gehabt hätte. Ein Mann in grüner Gärtneruniform schleppte sich die ungleichmäßigen Stufen aufwärts. Oben angekommen rang er nach Atem, als hätte er einen Berg bestiegen. Er wandte sich um und schaute auf sein Reich hinab. Peter Cunningham ließ den Gesamteindruck auf sich wirken. Er wusste, dass eine solche Parklandschaft mehr Pflege benötigte, als er ihr geben konnte. Doch er war der einzige Gärtner von Old-McManor-House und die silbergrauen Haare in Verbindung mit seinem Alter von 65 verrieten ihm, dass es seine letzte Anstellung sein würde. Angus McManor, von allen liebevoll Lord McManor genannt, lebte in Amerika und hatte den Familienbesitz in den vergangenen zwanzig Jahren nur einmal besucht. Die Familie hatte es für schottische Verhältnisse zu einigem Reichtum gebracht, wobei der Ursprung des Vermögens wohl eher auf zwielichtigen Geschäften während des hundertjährigen Krieges mit beiden Seiten, Engländern und Franzosen, beruhte.
Trotz der offensichtlichen Abwesenheit des alten McManors legte er Wert darauf, dass der Garten in Schuss blieb. Seine Briefe enthielten klare Anweisungen, von denen eine lautete, alle zwei Tage die Grünanlagen vollständig zu fotografieren und die Aufnahmen an eine Mail-Adresse zu versenden.
Auch dies gehörte zu Peters Aufgaben. Er wohnte kostenfrei in dem ehemaligen Gartenhaus und durfte sich so viel Obst, Gemüse und Salat nehmen, was immer der Nutzgarten hergab. Dafür akzeptierte er den geringen Lohn. Außerdem liebte er die Gartenarbeit und was sein Auge sah, gefiel ihm. Der gekieste Weg durchschnitt in optimalem Bogen das kurz geschnittene Grün, auf dem einige sehr betagte Bäume standen, wahre Riesen, wettergegerbt und mächtig, gepflanzt vor seiner Zeit.
Peter seufzte. Konnte dieses perfekte Leben wirklich vor dem Aus stehen? So lange hatten die Bientowitzes und er hier gelebt, das Haus, den Garten gehegt und gepflegt und nun würden sie gehen müssen?
Er wollte sich mit Tymi und Martha besprechen. Hatten die beiden einen Plan?
Peter öffnete die hakende Tür mit jahrelanger Erfahrung. Im Innern empfing ihn die Kühle einer unmöblierten Halle. Eine mächtige steinerne Treppe hoch in den ersten Stock beherrschte den wenig einladend wirkenden Raum. Weiterhin gab es im Parterre vier Türen, die in das Esszimmer, zwei Salons und in den Küchentrakt führten.
An den Wänden reihten sich die Familienporträts der McManors auf. Mit einer Ausnahme starrten von dort lauter weißhaarige greise Männer mit kräftigen Bärten und einem sehr ernsten Gesichtsausdruck auf jeden Besucher herab. Rund die Hälfte waren in irgendwelchen fantasievollen Armeeuniformen abgebildet, die anderen in stattlicher Kleidung. Alle vereinten die blauen Augen, eine Glatze und äußerst schmale Lippen.
Das derzeitige Familienoberhaupt hing noch nicht hier. Erst nach seinem Tod würde ein solches Andenken an ihn angebracht werden.
Nur ein Bild stach hervor. Lady Marion McManor, die unverheiratete Tochter, deren unehelicher Sohn ihren Adelstitel nicht geerbt hatte. Sie war die letzte echte Adlige der Familie gewesen. Doch der Fehltritt, als unverheiratete Frau einen Sohn zu gebären, lastete wie ein Fluch auf dem Geschlecht der McManors.
Dennoch lächelte sie auf ihrem Gemälde, das man zentral über dem Treppengeländer aufgehängt hatte. Selbst nach heutigen Gesichtspunkten stellte sie eine Schönheit dar, vielleicht lag dies aber nur an der Kunst des Porträtisten. Die Lady hatte vor rund 250 Jahren das Zeitliche gesegnet und ihren augenscheinlichen Sinn für Humor, gepaart mit gutem Aussehen, nicht auf die Nachkommenschaft vererbt.
Peter grüßte sie wie stets mit einem Nicken und eilte dann auf die Küchentür zu.
Er stockte, als er die laute Stimme Tymis aus der Küche hörte. Vorsichtig horchte er zunächst an der Tür.
Er verstand nicht alles, was der polnische Immigrant und Housekeeper mit seiner Frau Martha zu besprechen hatte.
Doch einige Fetzen des Gesprächs konnte Peter nicht überhören.
Es ging um den Erben des Lords, der vor einem Monat eingetroffen war. Es fielen Worte wie Schnösel und Schmarotzer. Peter glaubte sogar, der muss weg zu hören.
Tymi verfiel dann und wann in die polnische Sprache. Tonfall und Lautstärke weckten sehr ungute Gefühle in Peter.
Er löste sich von der Tür und schlich leise davon. Es war nicht der richtige Zeitpunkt, um mit den beiden Bientowitzes zu sprechen, fand er.
Zurück in seinem Gartenhaus, das er sich gemütlich eingerichtet hatte, setzte er Teewasser auf. Es gab kein Ungemach, das eine gute Tasse Tee nicht hätte mildern können.
Aber noch während der Wasserkocher seine Arbeit verrichtete, zweifelte Peter Cunningham doch, ob Tee hier wirklich eine Lösung darstellte.
Monas Herz machte einen Sprung, als hinter der nächsten Kurve Charlottes B&B auftauchte. Der Vauxhall klapperte seit der Panzertape-Operation nicht mehr und schüttelte sie ordentlich durch, als sie den Naturpfad nahm, um auf der rückwärtigen Seite des Hauses einzuparken. Von hier hatte man einen wunderschönen Blick auf das Meer. Bei guter Sicht bis hin zu den Inseln Eigg und Port Mòr. Eigg verdeckte Rum beinahe vollständig. Die viel größere Insel lag noch weiter im Atlantik und nur ein erfahrener Beobachter konnte erkennen, welche Linien zu Eigg und welche zu Rum gehörten.
Doch mit der Aussicht war das so eine Sache.
Mona stieg aus und spürte sofort die an ihr zerrenden Böen, Vorboten des Unwetters, dessen Wolkenfront sich bereits wie ein Bettlaken über Eigg geworfen hatte.
Der angekündigte Sturm ließ nicht mehr auf sich warten. Mona schnappte sich ihre Tasche aus dem Kofferraum und rannte auf die hintere Tür des Hauses zu. Oben befanden sich die Fenster der drei Gästezimmer des B&Bs, das Charlotte Polson Quiet Place genannt hatte.
Mona selbst wohnte unter dem Dach, Charlotte im Erdgeschoss.
Seit nunmehr vier Jahren teilten die beiden ungleichen Frauen, Charlotte hatte gerade ihren Achtzigsten gefeiert, das Leben, die Kosten und ihre Sorgen.
Ein vorwitziger Regentropfen traf Mona im Nacken. Sie öffnete die nicht abgeschlossene Tür und fühlte sich sofort heimisch.
Es roch nach schwarzem Tee und frisch gebackenem Brot.
»Charlie?«, rief sie. »Ich bin wieder zu Hause.«
Kapitel Zwei
— Illegale Substanzen müssen gesichert werden — Ein planloser Überfall — Eine fehlgeschlagene Werbekampagne — Touristen in Sicherheit — Austausch von Neuigkeiten —
Der Wind toste überlaut, rüttelte mit Macht an dem silbernen zigarrenförmigen Caravan, der in den USA als Airstream bekannt war. Schutzlos dem Sturm ausgesetzt, erzitterte das Gefährt, schwankte sogar gelegentlich. Unzweifelhaft war das der exponierten Lage, auf einem Grasstreifen dicht neben einem idyllisch gelegenen Strand von vielleicht dreißig Metern, geschuldet. Leicht gebogen, bildete er eine Art Miniaturbucht mit feinstem Sand, wobei die Flut nun weite Teile überschwemmen würde.
Niemand hätte sagen können, wie der Airstream dorthin gekommen war. Der einzige Weg zu dem Standort schien für normale Fahrzeuge unpassierbar. Und dennoch gehörte der Anblick dieses Wohnwagens schon seit Jahren zu dem Strandabschnitt, der von unterschiedlichsten Einsiedlern bewohnt wurde, die sich irgendwie die Klinke in die Hand gedrückt hatten.
Derzeit lebte dort Stuart, der es in jenem Augenblick allerdings bereute.
»O heilige Sch...«, begann er einen Fluch, den er nicht beendete, um nicht die mahnende Stimme seiner Mutter im Kopf zu hören, die ihm solche Reden verboten hatte. Krampfhaft stützte er sich an der Wand ab, als ein erneuter Stoß den Airstreamer zum Wackeln brachte. Aus einem der Hängeschränke kippten Dosen heraus, polterten zu Boden. Die Türen der Schränke klapperten in den schwächlichen Schlössern, hielten dem wachsenden Ansturm von Windböen und dem dadurch entstehenden Gerüttel nicht stand.
Diesen Frühlingssturm hatte niemand erwartet. Zur Herbst- und Winterzeit hatten ihm Connor Askaig und Paul Laing mit Tauen geholfen, das Beach House, wie es bei den Einheimischen hieß, zusätzlich zu sichern.
Doch die Befestigungen waren mittlerweile fort. So einen mächtigen Sturm hatte Stuart nicht für möglich gehalten.
Es hallte wie Donnerschläge an den Seitenwänden, als immer wieder kurze Regengüsse niederprasselten. Dabei würde der Höhepunkt des Unwetters erst noch folgen.
Stuarts ausgemergelter Körper verlor langsam an Kraft. Er wirkte wie die sprichwörtliche Bohnenstange, als wenn bereits ein laues Lüftchen ihn fortwehen könne.
Mühsam riss er sich zusammen, verkniff sich jegliches Selbstmitleid und rief sich im Selbstgespräch zur Ordnung. »Jetzt komm schon, Stu!«, schrie er gegen den Lärm an. »Es gibt Schlimmeres als das bisschen Wind!« Er versuchte sich selbst zu belügen, spürte jedoch die Höllenangst in seinen Gedärmen. Stuart führte viele laute Monologe, denn sein Alltag bestand aus Einsamkeit und zumeist kannte er nur einen Gesprächspartner: sich selbst.
Eine Fensterverriegelung löste sich unter dem Ansturm des Windes, der nun an dem Seitenfenster zerrte. Es klapperte stetig, als würde jemand Applaus klatschen.
Stuart stolperte durch den Mittelgang bis zu der Öffnung, zog die Lasche zu sich und hakte sie erneut ein. Nur kurz hatte er die Kälte des Windes gespürt, die durch die Lücke auf ihn eingeströmt war, aber er fror sofort.
Zurück am Schrank, warf er sich deswegen eine viel zu große wettertaugliche, fellgefütterte Jacke über. Wärmer wurde ihm dennoch nicht.
Doch das war nicht wichtig. Er musste ins Freie. Das Versteck zwischen den Felsen war nicht mehr sicher. Die aufgepeitschte Brandung könnte seine Vorräte mit sich reißen.
»Was bleibt mir also zu tun?«, sagte er zu sich selbst. »Du musst da raus, Stu«, plapperte er vor sich hin. »Du schaffst das, Stu«, sprach er sich Mut zu.
Er zog den Reißverschluss der Jacke hoch, knöpfte die Druckknöpfe zu, zog die Kapuze über die kurz geschorenen Haare und zog sie mit den Bändeln so weit zu, wie er nur konnte. Die Schleife wollte ihm erst beim zweiten Anlauf gelingen, aber endlich war er soweit. »Bin ich das?«, fragte er laut, schüttelte den Kopf. »Ich führe zu viele Selbstgespräche«, gab er zu, ohne das Kernproblem damit zu lösen oder sich der Absurdität dieser Forderung auf Besserung bewusst zu werden.
»Los jetzt!«
Er stellte sich an die Tür, die sich zur Seeseite öffnen würde und wappnete sich gegen Wind und Regen. Dreimal atmete er tief durch, verschluckte sich und hustete sich die Seele aus dem Leib. Dann stieß er die Tür nach außen auf.
Verdutzt registrierte er, dass der Sturm ihn nicht empfing, nur ein paar Tropfen lösten sich von der Außenwand und stürzten sich hinab. Die Sicht war schlecht, nur vier oder fünf Meter weit.
Stuart trat hinaus, schob die Tür zu und verriegelte sie sorgfältig.
Er schrie auf, als eine unsichtbare Faust ihn gegen das Metall des Airstreamers presste. Statt Regen war es plötzlich ein Wasserfall, der sich über ihn ergoss.
»Mist, Mist, Mist«, murmelte der Eremit aus freien Stücken sein Mantra. »War nur ein Loch im Sturm.«
Was durchaus eine korrekte Einschätzung darstellte.
In den nächsten Minuten kämpfte sich Stuart durch eine tiefgraue Wand aus peitschendem Regen. Mit gesenktem Kopf bemühte er sich, beim Einatmen nicht zu ertrinken. Die Windstöße zerrten an ihm, ließen ihn wie einen Betrunkenen schwanken. Er bewegte sich zunächst auf den Strand zu, versank an einigen Stellen im nassen Untergrund und ging einmal sogar in die Knie. Die Brandung toste von der Seite, auf der das Wasser gegen die Felsen schlug.
Stuart konnte seine laut ausgesprochenen Flüche nicht hören. Der Wind trug die Worte mit sich fort.
Eine besonders heftige Böe warf ihn zu Boden. Es tat nicht weh, der Sand war weich genug, aber danach hatte er irgendwie die Orientierung verloren. Er krabbelte auf allen Vieren weiter, bis seine Hände von dem kalten Wasser der aufbrandenden Wellen erfasst wurden.
Was für ein Orkan, kam es ihm in den Sinn. Ob der Sandstrand das überleben würde? Hatte es da nicht so ein Wunder in Irland gegeben? Ein Strand, den das Meer mit sich gerissen hatte und der nach mehr als dreißig Jahren über Nacht wieder aufgetaucht war? Konnte es sein, dass dies hier auch geschah?
Das salzige, eiskalte Wasser brannte auf der Haut. Nun erreichte der Wellenschlag seine Knie, die Hose wurde nass.
Er versuchte vergebens, sich an die Gebete seiner Mutter zu erinnern. Das Unwetter vernichtete jeden geordneten Gedanken.
Stuart stemmte sich gegen die Urgewalten hoch, bog nach rechts ab und streckte die Arme vor. Die Sichtweite betrug vielleicht drei Meter. So sah er die dunkle Masse der Felsen, die den Strand einrahmten, erst, als er sie beinahe berühren konnte.
»Geschafft«, murmelte er, beugte sich vor und lehnte sich mit ausgestreckten Armen gegen den kühlen Fels, als würde er einen alten Freund umarmen wollen. Für eine Weile schloss er die Augen, atmete regungslos durch, schöpfte Kraft, streichelte den Stein unter seinen Händen. Nass und glitschig. Es würde nicht einfach werden, zu seinem Versteck zu gelangen.
Zu seiner Rechten musste es einen Spalt geben, der eine Aufstiegsmöglichkeit bot, ohne auf blank polierten spiegelglatten Granitbrocken auszurutschen.
Stuart bewegte sich vorsichtig und zielstrebig. Er hatte ein Ziel. Gelegentlich schien der Wind nachzulassen, um dann in Böen wieder zuzuschlagen. Doch dies gab Stuart Hoffnung, dass der Sturm bei dem Tempo rasch vorbeiziehen würde.
Endlich erreichte er den Einschnitt, mannsbreit, zerklüftet mit einigen wenigen sehr scharfen Kanten. Hier boten sich Händen und Füßen genug Ansatzpunkte, um nach oben klettern zu können. Seine Finger schmerzten ob der Kälte, aber zu seiner eigenen Genugtuung verhielt er sich stumm, bis er sich auf dem Plateau festkrallen konnte. »Ah«, keuchte er in den stürmenden Wind. »Ich bin zu alt für so was.«
Er wartete, bis sein Herz nicht mehr ganz so schnell pochte, dann krabbelte er weiter. So viel Muskelkraft hatte er schon lange nicht mehr aufwenden müssen. Es kam, wie es kommen musste.
Seine Arme knickten unter einer besonders kräftigen Böe ein. Er krachte auf den Fels und schmeckte Blut in seinem Mund. Mit geschlossenen Augen, völlig außer Atem, blieb er flach liegen.
Nur ein paar Minuten, dachte er bei sich. Ich will nicht sterben, kam es ihm theatralisch in den Sinn.
Stuart atmete, den halb geöffneten Mund auf dem Felsen, leckte sich das salzige Wasser von den Lippen und roch das Meer. Der Wind ließ langsam nach.
Der Sturm! Konnte es sein, dass das Unwetter vorbeigezogen war?
Er bewegte die bleischweren Lider. Durch den grauen Regenvorhang verschwamm alles vor seinem Blickfeld.
Vorsichtig hob er den Kopf, sah sich um. Sein Versteck. Das konnten nur noch zehn Meter sein. Er war beinahe dort. »Gütige Mutter Gottes«, flüsterte er, stemmte sich ein wenig aufrechter.
In dem von der starken Brise gepeitschten Vorhang aus Wasser erkannte er nahe seines geheimen Ortes einen Umriss.
Eine Gestalt, die sich zielstrebig fortbewegte.
»Wer ist das?«, murmelte Stuart. »Was zur … hat er bei diesem Unwetter hier zu suchen?«
Er erstarrte, beobachtete.
Es musste ein Mann sein. Im nachlassenden Regen wurde es deutlicher. Breite Schultern, massiger Körperbau und er schien etwas zu suchen.
»Bitte nicht«, flüsterte Stuart und verharrte. Wenn er mich entdeckt …, dachte er, brachte seine Befürchtung aber nicht zu Ende.
Die Gestalt im Regen blieb stehen, beugte sich tief hinab, dann richtete sie sich auf. Der Typ drehte sich um und stiefelte davon.
Stuart atmete erleichtert auf.
Die Sicht besserte sich enorm, als hätte jemand den Wasserhahn der Dusche zugedreht. Stuart kniff die Augen zusammen und verbiss sich in den Einzelheiten des Rückens des Fremden.
Die grüne Jacke mit Kapuze über dem Kopf, der seltsame Gang, leicht hinkend und irgendwie schwankend.
In rund zwanzig Metern Entfernung kletterte er in die Tiefe und verschwand aus dem Sichtfeld. Stuart wusste, dass dort ein Trampelpfad bis hoch zu einem versteckten Waldparkplatz führte.
Er wartete nicht länger, hetzte auf sein Versteck zu, rutschte auf dem glatten Stein aus und schlug beinahe hin.
»Bitte, bitte, bitte«, flehte er. Dann endlich kniete er neben der kaum sichtbaren Markierung, die nicht für ihn, sondern für seinen Zwischenhändler gedacht war. Wenn man nicht wusste, wonach man suchte, fielen einem die allzu regelmäßigen Linien nicht auf, die ein Rechteck im Fels bildeten.
Stuart langte in eine gezackte Lücke und zerrte die metallene Klappe, auf die er eine markante Jakobsmuschel geklebt hatte, in die Höhe.
Darunter befand sich eine Art natürliche Vertiefung. Ein Viertelkubikmeter großes verstecktes Lager. Stuart griff hinein. Eine Tüte, zwei Tüten, drei Tüten …
Das war es.
Er sank auf die Knie und schniefte. Jemand hatte sein Versteck entdeckt und sich bedient. Ein Beutel mit bestem Gras war verschwunden.
Stuart konnte so etwas nicht dulden. Er richtete sich auf und rannte dem Dieb hinterher.
Sophie Hall schnappte sich gerade eines der fertig abgepackten Sandwiches aus dem Convenience Food Regal, als die Automatiktür sich öffnete und der Sturm einige Blätter hereinwehte.
Bei dem Unwetter dort draußen gab es nichts zu tun, denn niemand würde einkaufen oder tanken, soviel war klar.