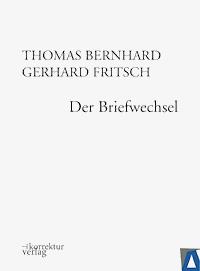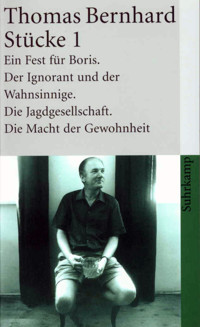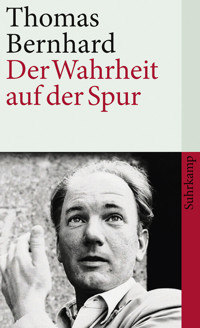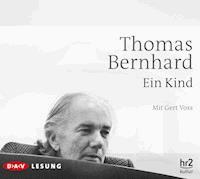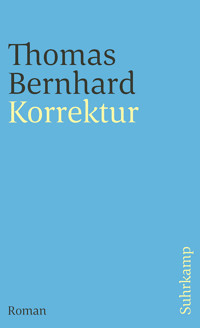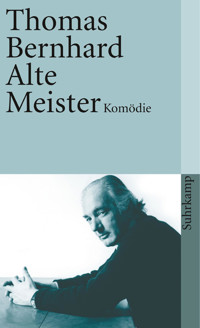15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Auslöschung« ist der Titel einer Niederschrift, die Franz-Josef Murau in seinem letzten Lebensjahr in Rom verfaßt hat und die Thomas Bernhard zugänglich macht. Diese Aufzeichnungen waren für Murau unumgänglich geworden, da in ihnen ein Thema im Zentrum steht, das seine ganze Existenz zerstört hat, nämlich seine Herkunft. Dieser »Herkunftskomplex« läßt sich mit dem Namen eines Ortes bezeichnen: Wolfsegg. Hier ist Murau aufgewachsen, hat er den Entschluß gefaßt, daß er, will er sich, seine geistige Existenz retten, Wolfsegg verlassen muß. Obwohl er deshalb beabsichtigt, Wolfsegg zu meiden, muß er dennoch dorthin reisen: seine Eltern und sein Bruder sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Dieser erneute Wolfsegg-Aufenthalt macht Murau deutlich, daß er sich von Wolfsegg endgültig lösen muß. Er faßt den Entschluß, über Wolfsegg zu schreiben, und zwar mit dem Ziel, das in diesem Bericht »Beschriebene auszulöschen, alles auszulöschen, das ich unter Wolfsegg verstehe, und alles, das Wolfsegg ist«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 793
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Thomas Bernhard
Auslöschung
Ein Zerfall
Suhrkamp Verlag
Ich fühle, wie der Tod mich beständig in seinen Klauen hat. Wie ich mich auch verhalte, er ist überall da.
Montaigne
DAS TELEGRAMM
Nach der Unterredung mit meinem Schüler Gambetti, mit welchem ich mich am Neunundzwanzigsten auf dem Pincio getroffen habe, schreibt Murau, Franz-Josef, um die Mai-Termine für den Unterricht zu vereinbaren und von dessen hoher Intelligenz ich auch jetzt nach meiner Rückkehr aus Wolfsegg überrascht, ja in einer derart erfrischenden Weise begeistert gewesen bin, daß ich ganz gegen meine Gewohnheit, gleich durch die Via Condotti auf die Piazza Minerva zu gehen, auch in dem Gedanken, tatsächlich schon lange in Rom und nicht mehr in Österreich zuhause zu sein, in eine zunehmend heitere Stimmung versetzt, über die Flaminia und die Piazza del Popolo, den ganzen Corso entlang in meine Wohnung gegangen bin, erhielt ich gegen zwei Uhr mittag das Telegramm, in welchem mir der Tod meiner Eltern und meines Bruders Johannes mitgeteilt wurde. Eltern und Johannes tödlich verunglückt. Caecilia, Amalia. Das Telegramm in Händen, trat ich ruhig und mit klarem Kopf an das Fenster meines Arbeitszimmers und schaute auf die vollkommen menschenleere Piazza Minerva hinunter. Ich hatte Gambetti fünf Bücher gegeben, von welchen ich überzeugt gewesen bin, daß sie ihm für die nächsten Wochen nützlich und notwendig sein werden, und ihm aufgetragen, diese fünf Bücher auf das aufmerksamste und mit der in seinem Falle gebotenen Langsamkeit zu studieren: Siebenkäs von Jean Paul, Der Prozeß von Franz Kafka, Amras von Thomas Bernhard, Die Portugiesin von Musil, Esch oder Die Anarchie von Broch und dachte jetzt, nachdem ich das Fenster geöffnet hatte, um besser atmen zu können, daß meine Entscheidung richtig gewesen war, Gambetti gerade diese fünf Bücher zu geben und keine andern, weil sie im Laufe unseres Unterrichts ihm immer wichtiger sein werden, daß ich ganz unauffällig die Andeutung gemacht habe, mich das nächste Mal mit ihm über die Wahlverwandtschaften und nicht über Die Welt als Wille und Vorstellung auseinanderzusetzen. Mit Gambetti zu sprechen, war mir auch an diesem Tag wieder ein großes Vergnügen gewesen nach den mühevollen, schwerfälligen, nur auf die alltäglichen ganz und gar privaten und primitiven Bedürfnisse beschränkten Unterhaltungen mit der Familie in Wolfsegg. Die deutschen Wörter hängen wie Bleigewichte an der deutschen Sprache, sagte ich zu Gambetti, und drücken in jedem Fall den Geist auf eine diesem Geist schädliche Ebene. Das deutsche Denken wie das deutsche Sprechen erlahmen sehr schnell unter der menschenunwürdigen Last seiner Sprache, die alles Gedachte, noch bevor es überhaupt ausgesprochen wird, unterdrückt; unter der deutschen Sprache habe sich das deutsche Denken nur schwer entwickeln und niemals zur Gänze entfalten können im Gegensatz zum romanischen Denken unter den romanischen Sprachen, wie die Geschichte der jahrhundertelangen Bemühungen der Deutschen beweise. Obwohl ich das Spanische, wahrscheinlich, weil es mir vertrauter ist, höher schätze, gab mir doch Gambetti an diesem Vormittag wieder eine wertvolle Lektion der Mühelosigkeit und Leichtigkeit und Unendlichkeit des Italienischen, das zum Deutschen in demselben Verhältnis stehe, wie ein völlig frei aufgewachsenes Kind aus wohlhabendem und glücklichem Hause zu einem unterdrückten, geschlagenen und dadurch verschlagenen aus dem armen und ärmsten. Um wie vieles höher also, sagte ich zu Gambetti, seien die Leistungen unserer Philosophen und Schriftsteller einzuschätzen. Jedes Wort, sagte ich, zieht unweigerlich ihr Denken herunter, jeder Satz drückt, gleich was sie sich zu denken getraut haben, zu Boden und drückt dadurch immer alles zu Boden. Deshalb sei auch ihre Philosophie und sei auch, was sie dichten, wie aus Blei. Plötzlich habe ich Gambetti einen Schopenhauerschen Satz aus der Welt als Wille und Vorstellung zuerst auf Deutsch, dann auf Italienisch vorgesprochen und ihm, Gambetti, zu beweisen versucht, wie schwer sich die Waagschale auf der mit meiner linken Hand vorgetäuschten deutschen Waagschale senkte, während sie sozusagen auf der italienischen mit meiner rechten Hand in die Höhe schnellte. Zu meinem und zu Gambettis Vergnügen sagte ich mehrere Schopenhauersche Sätze zuerst in Deutsch, dann in meiner eigenen italienischen Übersetzung und legte sie sozusagen für alle Welt, aber vor allem für Gambetti, deutlich sichtbar auf die Waagschale meiner Hände und entwickelte daraus mit der Zeit ein von mir auf die Spitze getriebenes Spiel, das schließlich mit Hegelsätzen und mit einem Kantaphorismus endete. Leider, sagte ich zu Gambetti, sind die schweren Wörter nicht immer die gewichtigsten, wie die schweren Sätze nicht immer die gewichtigsten sind. Mein Spiel hatte mich bald erschöpft. Vor dem Hotel Hassler stehengeblieben, gab ich Gambetti einen kurzen Bericht von meiner Wolfseggreise, der mir selbst am Ende zu ausführlich, ja tatsächlich zu geschwätzig gewesen ist. Ich hatte versucht, ihm gegenüber einen Vergleich anzustellen zwischen unseren beiden Familien, das deutsche Element der meinigen dem italienischen der seinigen entgegenzusetzen, aber ich spielte letzten Endes doch nur die meinige gegen die seinige aus, was meinen Bericht verzerren und Gambetti, anstatt aufklärend belehren, auf unangenehme Weise stören mußte. Gambetti ist ein guter Zuhörer und er hat ein sehr feines, durch mich geschultes Ohr für den Wahrheitsgehalt und für die Folgerichtigkeit eines Vortrags. Gambetti ist mein Schüler, umgekehrt bin ich selbst der Schüler Gambettis. Ich lerne von Gambetti wenigstens ebenso viel, wie Gambetti von mir. Unser Verhältnis ist das ideale, denn einmal bin ich der Lehrer Gambettis und er ist mein Schüler, dann wieder ist Gambetti mein Lehrer und ich bin sein Schüler, und sehr oft ist es der Fall, daß wir beide nicht wissen, ist jetzt Gambetti der Schüler und bin ich der Lehrer oder umgekehrt. Dann ist unser Idealzustand eingetreten. Offiziell bin ich aber immer der Lehrer Gambettis, und ich werde für meine Lehrtätigkeit von Gambetti, genau gesagt, von Gambettis wohlhabendem Vater, bezahlt. Zwei Tage nach der Rückkehr von der Hochzeit meiner Schwester Caecilia mit dem Weinflaschenstöpselfabrikanten aus Freiburg, ihrem Mann, meinem jetzigen Schwager, muß ich die erst am Vortag ausgepackte Reisetasche, die ich noch gar nicht weggeräumt und auf dem Sessel neben meinem Schreibtisch liegen gelassen habe, wieder einpacken und in das mir in den letzten Jahren tatsächlich alles in allem mehr oder weniger widerwärtig gewordene Wolfsegg zurück, dachte ich, noch immer vom offenen Fenster aus auf die menschenleere Piazza Minerva hinunterschauend, und der Anlaß ist jetzt kein lächerlicher und grotesker, sondern der furchtbare. Anstatt mich mit Gambetti über den Siebenkäs und über die Portugiesin zu unterhalten, werde ich mich meinen in Wolfsegg auf mich wartenden Schwestern ausliefern müssen, sagte ich mir, anstatt mit Gambetti über die Wahlverwandtschaften, werde ich mit meinen Schwestern über das Begräbnis der Eltern und des Bruders und deren Hinterlassenschaft reden müssen. Anstatt mit Gambetti auf dem Pincio hin und her, werde ich auf das Bürgermeisteramt und auf den Friedhof und in den Pfarrhof zu gehen haben und mich mit meinen Schwestern über die Begräbnisformalitäten streiten. Während ich die Wäschestücke, die ich erst am Vorabend ausgepackt hatte, wieder einpackte, versuchte ich mir die Konsequenzen klar zu machen, die der Tod der Eltern und der Tod des Bruders nach sich ziehen werden, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Aber ich war mir naturgemäß doch der Tatsache bewußt, was der Tod dieser drei mir wenigstens auf dem Papier am nächsten stehenden Menschen jetzt von mir forderte: meine ganze Kraft, meine ganze Willensstärke. Die Ruhe, mit welcher ich nach und nach die Tasche mit meinen Reisenotwendigkeiten vollgestopft, gleichzeitig meine durch dieses zweifellos fürchterliche Unglück erschütterte unmittelbare Zukunft schon in Rechnung gestellt hatte, war mir erst lange, nachdem ich die Tasche wieder zugemacht hatte, unheimlich gewesen. Die Frage, ob ich meine Eltern und meinen Bruder geliebt und sogleich mit dem Wort natürlich abgewehrt hatte, blieb nicht nur im Grunde, sondern tatsächlich unbeantwortet. Ich hatte schon lange weder zu meinen Eltern, noch zu meinem Bruder ein sogenanntes gutes, nurmehr noch ein gespanntes, in den letzten Jahren nurmehr noch ein gleichgültiges Verhältnis. Ich wollte von Wolfsegg und also auch von ihnen schon lange nichts wissen, umgekehrt sie nichts von mir, das ist die Wahrheit. Von diesem Bewußtsein war unser gegenseitiges Verhältnis nurmehr noch auf eine mehr oder weniger existenznotwendige Grundlage gestellt gewesen. Ich dachte, die Eltern haben dich vor zwanzig Jahren nicht nur aus Wolfsegg, an das sie dich lebenslänglich ketten wollten, sondern auch gleich aus ihren Gefühlen entlassen. Der Bruder neidete mir in diesen zwanzig Jahren unausgesetzt mein Fortgehen, meine größenwahnsinnige Selbständigkeit, wie er sich mir gegenüber einmal ausdrückte, die rücksichtslose Freiheit, und haßte mich.
Die Schwestern waren in ihrem Argwohn mir gegenüber immer weiter gegangen, als es zwischen Geschwistern erlaubt ist, sie verfolgten mich von dem Zeitpunkt an, in welchem ich Wolfsegg und damit auch ihnen den Rücken gekehrt habe, auch mit Haß. Das ist die Wahrheit. Ich hob die Tasche auf, sie war, wie immer, zu schwer, ich dachte, daß sie im Grunde völlig überflüssig ist, denn ich habe in Wolfsegg alles. Wozu schleppe ich die Tasche mit? Ich beschloß, ohne Tasche nach Wolfsegg zu reisen, und packte das Eingepackte wieder aus und verstaute es nacheinander im Kasten. Wir lieben naturgemäß unsere Eltern und genauso naturgemäß unsere Geschwister, dachte ich, wieder am Fenster stehend und auf die Piazza Minerva hinunterschauend, die noch immer menschenleer war, und bemerken nicht, daß wir sie von einem bestimmten Augenblick an hassen, gegen unseren Willen, aber auf dieselbe natürliche Weise, wie wir sie vorher geliebt haben aus allen diesen Gründen, die uns erst Jahre, oft auch erst Jahrzehnte später, bewußt geworden sind. Den genauen Zeitpunkt, in welchem wir die Eltern und die Geschwister nicht mehr lieben, sondern hassen, können wir nicht mehr bezeichnen und wir bemühen uns auch nicht mehr, den genauen Zeitpunkt ausfindig zu machen, weil wir im Grunde Angst haben davor. Wer die Seinigen gegen deren Willen verläßt und noch dazu auf die unerbittlichste Weise, wie ich es getan habe, muß mit ihrem Haß rechnen und je größer zuerst ihre Liebe zu uns gewesen ist, desto größer ist, wenn wir wahrgemacht haben, was wir geschworen haben, ihr Haß. Ich habe Jahrzehnte unter ihrem Haß gelitten, sagte ich mir jetzt, aber ich leide schon jahrelang nicht mehr darunter, ich habe mich an ihren Haß gewöhnt und er verletzt mich nicht mehr. Und unweigerlich hat ihr Haß gegen mich meinen Haß gegen sie hervorgerufen. Auch sie litten in den letzten Jahren nicht mehr unter meinem Haß. Sie verachteten ihren Römer, wie ich sie als die Wolfsegger verachtete, und sie dachten im Grunde überhaupt nicht mehr an mich, wie ich die meiste Zeit überhaupt nicht mehr an sie dachte. Sie hatten mich immer nur einen Scharlatan und Schwätzer genannt, einen sie und die ganze Welt ausnützenden Parasiten. Ich hatte für sie nur das Wort Dummköpfe zur Verfügung. Ihr Tod, es kann nur ein Autounfall sein, sagte ich mir, ändert an dieser Tatsache nichts. Ich hatte keinerlei Sentimentalität zu fürchten. Mir zitterten nicht einmal die Hände beim Lesen des Telegramms und mein Körper bebte nicht einen Augenblick. Ich werde Gambetti Mitteilung davon machen, daß meine Eltern und mein Bruder tot sind und daß ich ein paar Tage mit dem Unterricht aussetzen muß, dachte ich, nur ein paar Tage, denn länger als nur ein paar Tage werde ich mich nicht in Wolfsegg aufhalten; eine Woche wird genug sein, selbst bei sich unvorhergesehen komplizierenden Formalitäten. Einen Augenblick habe ich daran gedacht, Gambetti mitzunehmen, weil ich Angst hatte vor der Übermacht der Wolfsegger und ich wenigstens einen Menschen an meiner Seite haben wollte, mit welchem ich mich gegen den Wolfsegger Ansturm zu wehren in der Lage sei, einen mir entsprechenden Menschen und Partner in verzweifelter, möglicherweise aussichtsloser Lage, aber ich gab diesen Gedanken gleich wieder auf, weil ich Gambetti die Konfrontation mit Wolfsegg ersparen wollte. Dann würde er sehen, daß alles das, das ich ihm in den letzten Jahren über Wolfsegg gesagt habe, harmlos sei gegenüber der Wahrheit und der Wirklichkeit, die er zu sehen bekommt, dachte ich. Einmal dachte ich, ich nehme Gambetti mit, einmal, ich nehme ihn nicht mit. Ich entschied mich am Ende, ihn nicht mitzunehmen. Mit Gambetti mache ich in Wolfsegg auch zu viel und ein, mir doch alles in allem wahrscheinlich widerwärtiges sensationelles Aufsehen, dachte ich. Einen Menschen wie Gambetti verstehen sie in Wolfsegg schon gar nicht. Schon ganz und gar harmlosen Fremden sind sie in Wolfsegg immer nur mit Abscheu und Haß begegnet, alles Fremde haben sie immer abgelehnt, sich niemals mit etwas Fremdem oder mit einem Fremden von einem Augenblick auf den andern, wie es meine Gewohnheit ist, eingelassen. Gambetti nach Wolfsegg mitzunehmen, bedeutete, Gambetti ganz bewußt vor den Kopf zu stoßen und ihn letzten Endes zutiefst verletzen. Ich selbst bin kaum in der Lage, mit Wolfsegg fertig zu werden, geschweige denn ein Mensch und ein Charakter wie Gambetti. Die Konfrontation Gambettis mit Wolfsegg könnte tatsächlich in eine Katastrophe führen, dachte ich, deren entscheidendes Opfer dann niemand anderer wäre als Gambetti selbst. Ich hätte Gambetti ja schon früher einmal nach Wolfsegg mitnehmen können, dachte ich, aus gutem Grund unterließ ich es aber immer, obwohl ich mir sehr oft sagte, daß es ja nicht nur für mich nützlich sein könnte, mit Gambetti nach Wolfsegg zu reisen, sondern auch für Gambetti selbst. Meine Berichte über Wolfsegg hätten so, durch den persönlichen Augenschein Gambettis, eine ihm gegenüber durch nichts sonst erreichte Authentizität. Ich kenne Gambetti jetzt fünfzehn Jahre und ich habe ihn nicht ein einziges Mal nach Wolfsegg mitgenommen, dachte ich. Möglicherweise denkt Gambetti über diese Tatsache anders als ich, sagte ich mir jetzt, auf Grund der Ungewöhnlichkeit, die es naturgemäß ist, einen Menschen, mit welchem ich fünfzehn Jahre einen mehr oder weniger vertrauten Umgang pflege, nicht ein einziges Mal in diesen fünfzehn Jahren in jenen Ort einzuladen und mitzunehmen, der mein Ursprungsort ist. Warum tatsächlich habe ich diese ganzen langen fünfzehn Jahre Gambetti nicht in die heimatlichen Karten schauen lassen? dachte ich. Weil ich immer Angst davor gehabt habe und noch immer Angst davor habe. Weil ich mich schützen will gegen sein Wissen über Wolfsegg und also gegen sein Wissen über meine Herkunft einerseits, weil ich selbst ihn schützen will gegen ein solches Wissen, das möglicherweise doch nur eine verheerende Wirkung auf ihn ausüben kann. Ich wollte Gambetti in diesen fünfzehn Jahren unseres Verhältnisses niemals Wolfsegg aussetzen. Obwohl es mir immer wieder das angenehmste gewesen wäre, nicht allein, sondern in Begleitung Gambettis nach Wolfsegg zu reisen und mit Gambetti meine Wolfsegger Tage zu verbringen, habe ich mich immer geweigert, Gambetti mitzunehmen. Natürlich wäre Gambetti jederzeit mit nach Wolfsegg gekommen. Er wartete ja immer auf meine Einladung. Aber ich lud ihn nicht ein. Ein Begräbnis ist nicht nur ein trauriger, sondern auch ein ganz und gar widerwärtiger Anlaß, sagte ich mir jetzt, gerade zu diesem Anlaß werde ich Gambetti nicht auffordern, mit mir nach Wolfsegg zu kommen. Ich werde ihm Mitteilung davon machen, daß meine Eltern tot sind, ohne daß ich die Bestätigung habe, werde ich
sagen, daß sie bei einem Autounfall umgekommen sind mit meinem Bruder, aber ich werde nicht mit einem Wort sagen, daß er mitkommen soll. Noch vor zwei Wochen, bevor ich nach Wolfsegg zur Hochzeit meiner Schwester gefahren bin, habe ich Gambetti gegenüber mit der größten Roheit über meine Eltern gesprochen und meinen Bruder einen mehr oder weniger schlechten Charakter und einen unbelehrbaren Dummkopf genannt. Wolfsegg beschrieben als einen Hort des Stumpfsinns. Das grauenhafte Klima, das in der Gegend von Wolfsegg immer geherrscht und immer alles beherrscht hat, auf die Menschen übertragen, die in Wolfsegg zu leben oder besser noch, zu existieren gezwungen seien und wie dieses Klima von einer geradezu menschenvernichtenden Rücksichtslosigkeit sind. Aber ich habe dabei auch die absoluten Vorzüge von Wolfsegg erwähnt, die schönen Herbsttage, die von mir wie keine zweite geliebte Winterkälte und Winterstille in den umliegenden Wäldern und Tälern. Daß dort zwar eine rücksichtslose, aber auch durch und durch klare und großartige Natur sei. Daß diese durch und durch klare und großartige Natur aber von den Menschen, die sie bewohnen, gar nicht mehr zur Kenntnis genommen werde, weil sie in ihrem Stumpfsinn dazu nicht mehr imstande sind. Gäbe es die Meinigen nicht und nur die Mauern, in welchen sie leben, hatte ich damals zu Gambetti gesagt, ich müßte Wolfsegg als den Glücksfall eines Ortes für mich empfinden, denn er sei wie kein zweiter meinem Geiste entsprechend. Aber ich kann die Meinigen ja nicht, weil ich es will, abschaffen, hatte ich gesagt. Deutlich höre ich mich diesen Satz sprechen und die Furchtbarkeit, die er jetzt durch den tatsächlichen Tod meiner Eltern und meines Bruders in sich hatte, ließ mich diesen Satz, noch immer am Fenster stehend und auf die Piazza Minerva hinunterschauend, noch einmal laut aussprechen. Da ich den damals Gambetti gegenüber mit der größten Abneigung gegen die Betroffenen ausgesprochenen Satz Aber ich kann die Meinigen ja nicht, weil ich es will, abschaffen, jetzt ziemlich laut und geradezu mit einem theatralischen Effekt wiederholte, so, als sei ich ein Schauspieler, der den Satz zu proben hat, weil er ihn vor einem größeren öffentlichen Auditorium vorzutragen hat, entschärfte ich ihn augenblicklich. Er war auf einmal nicht mehr vernichtend. Dieser Satz Aber ich kann die Meinigen ja nicht, weil ich es will, abschaffen, hatte sich jedoch bald wieder in den Vordergrund gedrängt und beherrschte mich. Ich bemühte mich, ihn zum Verstummen zu bringen, aber er ließ sich nicht abwürgen. Ich sagte ihn nicht nur, ich plapperte ihn mehrere Male vor mich hin, um ihn lächerlich zu machen, aber er war nach meinen Versuchen, ihn abzuwürgen und lächerlich zu machen, nur noch bedrohlicher. Er hatte auf einmal das Gewicht, das noch kein Satz von mir gehabt hat. Mit diesem Satz kannst du es nicht aufnehmen, sagte ich mir, mit diesem Satz wirst du leben müssen. Diese Feststellung führte urplötzlich zu einer Beruhigung meiner Situation. Ich sprach den Satz Aber ich kann die Meinigen ja nicht, weil ich es will, abschaffen, jetzt noch einmal so aus, wie ich ihn Gambetti gegenüber ausgesprochen hatte. Jetzt hatte er dieselbe Bedeutung wie damals Gambetti gegenüber. Auf der Piazza Minerva war, außer Tauben, kein Leben. Plötzlich war mir kalt und ich schloß das Fenster. Ich setzte mich an den Schreibtisch. Auf meinem Schreibtisch lag noch die Post, darunter ein Brief Eisenbergs, ein Brief Spadolinis, des Erzbischofs und Liebhabers meiner Mutter, und ein Zettel Marias. Die Einladungen der verschiedenen römischen Kulturinstitute und auch alle anderen privaten Einladungen habe ich sofort in den Papierkorb geworfen, auch ein paar Briefe, die sich mir schon nach der oberflächlichsten Betrachtung als Droh- oder Bettelbriefe herausgestellt hatten, von Leuten, die entweder von mir Geld oder Aufklärung darüber haben wollten, was wirklich ich mit meiner Denk- und Lebensweise zu bezwecken beabsichtigte, die sich auf ein paar Zeitungsartikel beziehen, die ich in letzter Zeit veröffentlicht habe und die diesen Leuten nicht passen, weil sie naturgemäß gegen alle diese Leute gedacht und geschrieben sind, natürlich Briefe aus Österreich, von Leuten geschrieben, die mich bis nach Rom mit ihrem Haß verfolgen. Seit Jahren bekomme ich diese Briefe, die durchaus nicht, wie ich zuerst geglaubt hatte, von Verrückten geschrieben sind, sondern von tatsächlich mündigen, juristisch einwandfreien Personen sozusagen, die mir für meine Veröffentlichungen in den verschiedensten Zeitungen und Zeitschriften nicht nur in Frankfurt und Hamburg, auch in Mailand und Rom, unter anderem meine Verfolgung und Tötung androhen. Ich ziehe Österreich andauernd in den Schmutz, sagen diese Leute, die Heimat mache ich auf die unverschämteste Weise herunter, ich unterstellte den Österreichern eine gemeine und niederträchtige katholisch-nationalsozialistische Gesinnung wann und wo ich nur könne, wo es in Wahrheit diese gemeine und niederträchtige katholisch-nationalsozialistische Gesinnung in Österreich gar nicht gäbe, wie diese Leute schreiben. Österreich sei nicht gemein und es sei nicht niederträchtig, es sei immer nur schön gewesen, schreiben diese Leute, und das österreichische Volk sei ein ehrbares. Diese Briefe habe ich immer sofort weggeworfen, auch heute früh. Behalten habe ich nur Eisenbergs Brief, die Einladung meines Studienfreundes, des jetzigen Wiener Rabbiners, zu einem Treffen in Venedig, wo er Ende Mai zu tun habe, wie er schreibt, und mit mir in das Teatro Fenice zu gehen beabsichtige, nicht wie vor einem Jahr, wie er schreibt, in so etwas wie Strawinskis Geschichte vom Soldaten, sondern in Monteverdis Tancredo. Eisenbergs Einladung nehme ich selbstverständlich an, ich werde ihm sofort antworten, dachte ich, aber sofort bedeutet, nach meiner Rückkehr aus Wolfsegg. Mit Eisenberg durch Venedig zu gehen ist mir immer ein großes Vergnügen gewesen, dachte ich, überhaupt mit Eisenberg zusammen zu sein. Kommt er nach Italien, und sei es auch nur nach Venedig auf ein paar Tage, kündigt er es an, dachte ich, lädt er mich ein und immer auf ein, wie er selbst sagt, hochkünstlerisches Vergnügen, zweifellos ist der Tancredo im Fenice ein solches, dachte ich. Ein Belegexemplar des Corriere della Sera hatten sie mir zugeschickt, in welchem mein kurzer Aufsatz über Leoš Janáček abgedruckt ist. Ich machte die Zeitung voller Erwartung auf, aber mein Aufsatz war erstens nicht an hervorragender Stelle plaziert, was mich gleich verstimmt hat, zweitens entdeckte ich in ihm schon beim ersten kurzen Durchlesen eine Reihe von unverzeihlichen Druckfehlern, also das Fürchterlichste, das mir passieren kann. Ich warf den Corriere weg und las noch einmal, was mir Maria auf den Zettel geschrieben hat, den sie in meinen Briefkasten geworfen hat. Meine große Dichterin schreibt, daß sie Samstag abend mit mir essen gehen will, mit dir allein, sie habe im übrigen neue Gedichte geschrieben, für dich, wie sie schreibt. Meine große Dichterin ist in letzter Zeit recht produktiv, dachte ich und ich zog die Lade heraus, in der ich ein paar Fotografien meiner Familie verwahrt hatte. Ich betrachtete eindringlich die Fotografie, auf welcher meine Eltern gerade auf dem Victoriabahnhof in London den Zug nach Dover besteigen. Ich hatte die Fotografie von ihnen gemacht, ohne ihr Wissen. Sie hatten mich, der ich neunzehnhundertsechzig in London studiert habe, besucht und waren nach einem vierzehntägigen Englandaufenthalt, der sie bis nach Glasgow und Bristol geführt hatte, nach Paris gereist, wo sie von meinen Schwestern erwartet worden waren, die ihrerseits von Cannes aus, wo sie unseren Onkel Georg besuchten, nach Paris gekommen waren, um meine Eltern zu treffen. Neunzehnhundertsechzig hatte ich durchaus noch ein wenigstens erträgliches Verhältnis zu meinen Eltern gehabt, dachte ich. Ich hatte gewünscht, in England zu studieren, und sie hatten sich nicht im geringsten dagegen gestellt, weil sie annehmen mußten, ich werde nach meinem Studium in England nach Wien zurücckehren und schließlich nach Wolfsegg, um ihren Wunsch, zusammen mit meinem Bruder Wolfsegg zu lenken und zu betreiben, zu erfüllen. Aber ich hatte schon damals nicht die Absicht gehabt, nach Wolfsegg zurückzukehren, ich war tatsächlich nur mit dem einzigen Gedanken aus Wolfsegg nach England und nach London gegangen, niemehr nach Wolfsegg zurückzukommen. Ich haßte die Landwirtschaft, die Leidenschaft meines Vaters und meines Bruders. Ich haßte alles, das mit Wolfsegg zusammenhing, denn es war in ihm immer nur auf den wirtschaftlichen Vorteil für die Familie angekommen, auf nichts sonst.
In Wolfsegg hatten sie, solange es besteht und in den Händen meiner Familie gewesen ist, für nichts anderes etwas übrig gehabt, als für seine Wirtschaftlichkeit und wie mit der Zeit ein immer noch größerer Gewinn aus seinen Produktionsstätten, also aus seiner Landwirtschaft, die immerhin auch heute noch zwölftausend Hektar umfaßt, und aus den Bergwerken herauszuschlagen ist. Sie hatten nichts anderes im Kopf als die Ausbeutung ihres Besitzes. Sie heuchelten zwar immer, auch etwas anderes zu betreiben als nur ihre wirtschaftliche Gewinnsucht, daß sie für Kultur, ja sogar für die Künste etwas übrig hätten, aber die Wirklichkeit war schon immer eine deprimierende und beschämende gewesen. Sie hatten zwar Tausende von Büchern in den Bibliotheken in Wolfsegg, das fünf Bibliotheken beherbergt, und diese Bücher in absurder Regelmäßigkeit drei- oder viermal jährlich abgestaubt, aber sie hatten diese Bücher aus diesen ihren Bibliotheken niemals gelesen. Sie hielten die Bibliotheken immer auf Hochglanz, damit sie sie, ohne sich schämen zu müssen, ihren Besuchern vorzeigen und vor diesen Besuchern prahlen und ihre gedruckten Kostbarkeiten herzeigen konnten, aber sie machten von allen diesen Tausenden, ja Zehntausenden von Kostbarkeiten persönlich niemals den Gebrauch, der selbstverständlich gewesen wäre. Die fünf Bibliotheken in Wolfsegg, vier im Haupthaus, eine in den Nebengebäuden, waren schon von meinen Urururgroßeltern angelegt worden, meine Eltern hatten nicht einen einzigen Band dazu angeschafft. Es heißt, unsere Bibliotheken seien zusammen ebenso kostbar wie die Stiftsbibliothek von Lambach, die weltberühmt ist. Mein Vater las kein Buch, meine Mutter blätterte nur ab und zu in alten naturwissenschaftlichen Büchern, um sich an den farbenprächtigen Stichen, die diese Bücher schmücken, zu ergötzen. Meine Schwestern betraten die Bibliotheken überhaupt nicht, es sei denn, sie zeigten sie Besuchern, die den Wunsch geäußert hatten, unsere Bibliotheken sehen zu wollen. Die Fotografie, die ich von meinen Eltern auf dem Victoriabahnhof gemacht hatte, zeigt meine Eltern in einem Alter, in welchem sie noch Reisen gemacht haben und von keiner Krankheit gequält waren. Sie trugen gerade erst bei Burberry gekaufte Regenmäntel und hatten an ihren Armen neue, ebenso bei Burberry gekaufte Schirme hängen. Als typische Kontinentler gaben sie sich noch englischer als die Engländer und machten dadurch einen eher grotesken, denn feinen und vornehmen Eindruck und ich hatte ja jedesmal beim Anblick dieser Fotografie lachen müssen, jetzt aber war mir das Lachen darüber vergangen. Meine Mutter hatte einen etwas zu langen Hals, welcher nicht mehr als schön empfunden werden konnte und in dem Augenblick, als ich das Foto von ihr gemacht habe, streckte sie ihn, da sie gerade den Zug bestieg, noch um ein paar Zentimeter weiter als sonst vor und machte dadurch die einfache Lächerlichkeit des Bildes zu einer doppelten. Die Körperhaltung meines Vaters war immer die eines Menschen, der sein schlechtes Gewissen der ganzen Welt gegenüber nicht verbergen kann und darüber unglücklich ist. Er trug damals, als ich das Foto machte, seinen Hut etwas tiefer als sonst in der Stirn, was ihn auf meinem Foto viel unbeholfener erscheinen läßt, als er in Wirklichkeit war. Warum ich gerade dieses Foto meiner Eltern aufgehoben habe, weiß ich nicht. Eines Tages werde ich auf den Grund kommen, dachte ich. Ich legte das Foto auf den Schreibtisch und suchte nach jenem am Ufer des Wolfgangsees erst vor zwei Jahren gemachten, das meinen Bruder auf seinem Segelschiff, das er das ganze Jahr über in Sankt Wolfgang in einer Pachthütte der Fürstenberg stehen hat, zeigt. Der Mann auf dem Foto ist ein verbitterter Mensch, den das Alleinsein mit seinen Eltern ruiniert hat. Die sportliche Kleidung verdeckt nur mühselig die Krankheiten, die ihn bereits vollkommen in Besitz genommen haben. Sein Lächeln ist, wie gesagt wird, verquält und das Foto kann nur sein Bruder gemacht haben, nämlich ich. Als ich ihm eine Kopie des Fotos gegeben habe, zerriß er sie kommentarlos. Ich legte das Foto, das meinen Bruder zeigt, neben das Foto, auf welchem meine Eltern in London den Zug nach Dover besteigen und betrachtete beide längere Zeit. Du hast diese Menschen solange geliebt, wie sie dich geliebt haben und dann von dem Augenblick an gehaßt, von welchem an sie dich gehaßt haben. Daß ich sie überleben werde, habe ich naturgemäß niemals gedacht, im Gegenteil war ich immer der Meinung gewesen, ich werde eines Tages der Erstverstorbene sein. Die jetzt eingetretene Situation ist die, an die ich niemals gedacht habe, an alle anderen möglichen habe ich immer wieder gedacht, niemals an diese. Ich hatte mir sehr oft vorgestellt und auch sehr oft davon geträumt, zu sterben, sie hinter mir zu lassen, allein zu lassen ohne mich, sie durch meinen Tod von mir befreit zu haben, niemals davon, von ihnen zurückgelassen zu sein. Die Tatsache, daß sie jetzt tot waren und nicht ich, war im Augenblick für mich nicht nur die denkbar unvorhergesehene, sie war für mich das Sensationelle. Dieses sensationelle Element, dieses sensationelle Elementare war es, das mich schockierte, nicht eigentlich die Tatsache an sich, daß sie jetzt tot und zwar unwiderruflich tot waren. Meine Eltern als ein wenn auch tatsächlich immer in allem hilfloses, so doch für mich lebenslänglich dämonisches Paar, waren auf einmal über Nacht auf dieses groteske und lächerliche Foto zusammengeschrumpft, das ich jetzt auf dem Schreibtisch liegen hatte und mit der größten Eindringlichkeit und Schamlosigkeit betrachtete. Genauso das Foto meines Bruders. Vor diesen Menschen hast du dich zeitlebens so gefürchtet wie vor nichts anderem, dachte ich, und du hast diese Furcht zu der größten Ungeheuerlichkeit deines Lebens gemacht, sagte ich mir. Diesen Menschen hast du dich zeitlebens, obwohl du immer wieder den Versuch gemacht hast, nicht entziehen können, alle deine Versuche in dieser Richtung sind letzten Endes gescheitert, du bist nach Wien, um ihnen zu entkommen, nach London, um ihnen zu entkommen, nach Paris, nach Ankara, nach Konstantinopel, schließlich Rom, zwecklos. Sie mußten tödlich verunglücken und zu diesem lächerlichen Papierfetzen, der sich Fotografie nennt, zusammenschrumpfen, um dir nicht mehr schaden zu können. Der Verfolgungswahn ist zuende, dachte ich. Sie sind tot. Du bist frei. Zum ersten Mal empfand ich beim Anblick der Fotografie, die ihn in Sankt Wolfgang auf seinem Segelboot zeigt, Mitleid mit meinem Bruder. Er sah jetzt auf dem Foto noch viel komischer aus als bei früherer Betrachtung. Meine Unbestechlichkeit, diese Betrachtung betreffend, erschreckte mich. Auch die Eltern waren auf dem Foto, das sie auf dem Victoriabahnhof zeigt, komisch. Alle drei waren sie jetzt, vor mir auf dem Schreibtisch, keine zehn Zentimeter groß und in modischer Kleidung und grotesker Körperhaltung, die auf eine ebenso groteske Geisteshaltung schließen läßt, noch komischer als bei früherer Betrachtung. Die Fotografie zeigt nur den grotesken und den komischen
Augenblick, dachte ich, sie zeigt nicht den Menschen, wie er alles in allem zeitlebens gewesen ist, die Fotografie ist eine heimtückische perverse Fälschung, jede Fotografie, gleich von wem sie fotografiert ist, gleich, wen sie darstellt, sie ist eine absolute Verletzung der Menschenwürde, eine ungeheuerliche Naturverfälschung, eine gemeine Unmenschlichkeit. Andererseits empfand ich die beiden Fotos als geradezu ungeheuer charakteristisch für die darauf Festgehaltenen, für meine Eltern genauso wie für meinen Bruder. Das sind sie, sagte ich mir, wie sie wirklich sind, das waren sie, wie sie wirklich waren. Ich hätte auch andere Fotografien meiner Eltern und meines Bruders aus Wolfsegg mitnehmen und mir behalten können, ich habe diese mitgenommen und behalten, weil sie die Eltern wie meinen Bruder genauso wiedergeben in dem Augenblick, in welchem diese Fotografien von mir gemacht worden sind, wie meine Eltern wirklich sind, wie mein Bruder wirklich ist. Ich hatte nicht die geringste Scham bei dieser Feststellung. Nicht zufällig hatte ich gerade diese Fotografien nicht vernichtet und sogar nach Rom mitgenommen und in meinem Schreibtisch aufbewahrt. Hier habe ich keine idealisierten Eltern, sagte ich mir, hier habe ich meine Eltern, wie sie sind, wie sie waren, verbesserte ich mich. Hier habe ich meinen Bruder, wie er gewesen ist. Sie waren alle drei so scheu, so gemein, so komisch. Ich hätte ja, dachte ich, keine Verfälschung meiner Eltern und meines Bruders in meinem Schreibtisch geduldet. Nur die tatsächlichen, die wahren Abbilder. Nur das absolut Authentische, und ist es noch so grotesk, möglicherweise sogar widerwärtig. Und genau diese Fotos mit meinen Eltern darauf und meinem Bruder habe ich Gambetti einmal gezeigt, vor einem Jahr, ich weiß noch wo, im Café auf der Piazza del Popolo. Er hatte sich die Fotos angeschaut und keinerlei Kommentar abgegeben. Ich erinnere mich nur, daß er, nachdem er die Fotos angeschaut hatte, fragte: sind deine Eltern sehr reich? Ich hatte darauf geantwortet: ja. Ich weiß auch noch, daß es mir nachher peinlich gewesen ist, ihm die Fotos überhaupt gezeigt zu haben. Du hättest ihm gerade diese Fotos niemals zeigen dürfen, sagte ich mir damals. Es war eine Dummheit gewesen. Es gab und gibt zahllose Fotografien, auf welchen meine Eltern tatsächlich, wie gesagt wird, seriös dargestellt sind, aber sie entsprechen nicht dem Bild, das ich mir von meinen Eltern zeitlebens gemacht habe. Auch von meinem Bruder gibt es solche seriösen Fotografien, auch sie sind Verfälschungen. Gambetti hätte ich keine dieser Verfälschungen jemals gezeigt. Im übrigen hasse ich beinahe nichts auf der Welt mehr, als das Herzeigen von Fotografien. Ich zeige keine und ich lasse mir keine zeigen. Daß ich Gambetti das Foto mit den Eltern auf dem Victoriabahnhof gezeigt habe, war eine Ausnahme. Was bezweckte ich damit? Gambetti seinerseits hatte mir niemals Fotografien gezeigt. Natürlich, seine Eltern und seine Geschwister kenne ich und es hätte gar keinen Sinn, mir Fotos, auf welchen sie dargestellt sind, zu zeigen, er wäre auch nie auf die Idee gekommen. Im Grunde hasse ich Fotografien und ich selbst bin nie auf die Idee gekommen, Fotografien zu machen, von dieser Londoner Ausnahme abgesehen, von Sankt Wolfgang, von Cannes, zeitlebens habe ich keinen Fotoapparat besessen. Ich verachte die Leute, die fortwährend am Fotografieren sind und die ganze Zeit mit ihrem Fotoapparat um den Hals umherlaufen. Fortwährend sind sie auf der Suche nach einem Motiv und sie fotografieren alles und jedes, selbst das Unsinnigste. Fortwährend haben sie nichts im Kopf, als sich selbst darzustellen und immer auf die abstoßendste Weise, was ihnen selbst aber nicht bewußt ist. Sie halten auf ihren Fotos eine pervers verzerrte Welt fest, die mit der wirklichen nichts als diese perverse Verzerrung gemein hat, an welcher sie sich schuldig gemacht haben. Das Fotografieren ist eine gemeine Sucht, von welcher nach und nach die ganze Menschheit erfaßt ist, weil sie in die Verzerrung und die Perversität nicht nur verliebt, sondern vernarrt ist und tatsächlich vor lauter Fotografieren mit der Zeit die verzerrte und die perverse Welt für die einzig wahre nimmt. Die fotografieren begehen eines der gemeinsten Verbrechen, die begangen werden können, indem sie die Natur auf ihren Fotografien zu einer perversen Groteske machen. Die Menschen sind auf ihren Fotografien lächerliche, bis zur Unkenntlichkeit verschobene, ja verstümmelte Puppen, die erschrocken in ihre gemeine Linse starren, stumpfsinnig, widerwärtig. Das Fotografieren ist eine niederträchtige Leidenschaft, von welcher alle Erdteile und alle Bevölkerungsschichten erfaßt sind, eine Krankheit, von welcher die ganze Menschheit befallen und von welcher sie nie mehr geheilt werden kann. Der Erfinder der fotografischen Kunst ist der Erfinder der menschenfeindlichsten aller Künste. Ihm verdanken wir die endgültige Verzerrung der Natur und des in ihr existierenden Menschen zu ihrer und seiner perversen Fratze. Ich habe noch auf keiner Fotografie einen natürlichen und das heißt, einen wahren und wirklichen Menschen gesehen, wie ich noch auf keiner Fotografie eine wahre und wirkliche Natur gesehen habe. Die Fotografie ist das größte Unglück des zwanzigsten Jahrhunderts. Bei der Betrachtung von Fotografien hat es mich immer wie bei nichts sonst geekelt. Aber, sagte ich mir jetzt, so verzerrt die Eltern und mein Bruder auf diesen einzigen von mir gemachten Fotografien mit dem meinem Bruder gehörenden Fotoapparat sind, sie zeigen, je länger ich sie betrachte, hinter der Perversität und der Verzerrung doch die Wahrheit und die Wirklichkeit dieser sozusagen Abfotografierten, weil ich mich nicht um die Fotos kümmere und die darauf Dargestellten nicht, wie sie das Foto in seiner gemeinen Verzerrung und Perversität zeigt, sehe, sondern wie ich sie sehe. Meine Eltern auf dem Victoriabahnhof in London habe ich auf die Rückseite des Fotos geschrieben. Auf das zweite, das meinen Bruder in Sankt Wolfgang zeigt, Mein Bruder beim Segeln in Sankt Wolfgang. Ich griff in die Lade und holte ein Foto heraus, auf welchem meine Schwestern Amalia und Caecilia vor jener Villa in Cannes in Pose stehen, die sich mein Onkel Georg, der Bruder meines Vaters, von dem Geld gekauft hat, mit welchem ihn sein Bruder nach dem Tod meiner Großeltern ein für allemal, wie gesagt wird, ausgezahlt hat und der mehrere Aktienpakete so geschickt in vielen Teilen Frankreichs angelegt hat, daß er davon immer nicht nur recht gut, sondern sogar in einem gewissen ihm entsprechenden Luxus leben konnte. Er hat, dachte ich jetzt bei Betrachtung der Fotografie, auf welcher meine Schwestern ihre mehr oder weniger spöttischen Gesichter zeigen, das bessere Los gezogen im Gegensatz zu seinem Bruder, meinem Vater. Der Onkel Georg ist vor vier Jahren ebenso plötzlich gestorben wie sein Bruder, mein Vater, allerdings in der Folge eines Herzanfalls, der ihn im Park seiner Villa überrascht hat, während er gerade im Begriff gewesen war, seine Rosen zu inspizieren, die im Laufe seines späteren Lebens seine einzige Leidenschaft geworden waren. Mit fünfunddreißig hatte er sich schon aus Wolfsegg absetzen und an die Riviera zurückziehen können mit einer Menge Geld und mit einem Haufen von Büchern. Er liebte die französische Literatur und das Meer und war ganz in diesen beiden Vorlieben aufgegangen. Oft denke ich, daß ich viel von meinem Onkel Georg habe, mehr jedenfalls als von meinem Vater. Auch ich habe zeitlebens die Literatur und die Bücher und das Meer geliebt. Auch ich bin aus Wolfsegg weggegangen, sogar schon in jüngeren Jahren als er. Meine Schwestern Amalia und Caecilia vor Onkel Georgs Villa habe ich auf die Fotografie geschrieben. Das letzte Mal war ich neunzehnhundertachtundsiebzig in Cannes gewesen. Mindestens einmal im Jahr suchte ich den Onkel Georg auf. Ein paar Tage mit ihm in seiner Villa zusammen hatten mir immer gut getan. Zu seinem Universalerben hat er, zum Entsetzen unserer Familie, seinen Hausmeister gemacht, der ihm immer treu gedient und den er immer liebevoll mein guter Jean genannt hat. Mehrere Male ist mein Onkel Georg in Rom gewesen, in der Stadt, die er genauso wie ich, von allen Städten der Welt, am meisten liebte, am höchsten schätzte. Gambetti und mein Onkel Georg haben sich gut verstanden, viele Abende im Freien auf der Piazza del Popolo oder, wenn es regnete, im Café Greco, Gespräche geführt über alles Mögliche, vor allem über Kunst, Malerei. Mein Onkel Georg war ein passionierter Kunstsammler und wie ich weiß, hat er die Zinsen seines Vermögens zum Großteil für die Anschaffung von Bildern und Plastiken zeitgenössischer Künstler ausgegeben. Da er einen guten Geschmack und einen ganz und gar außergewöhnlichen Instinkt, den Wert der von ihm bevorzugten Kunstwerke betreffend, hatte, war er in seiner Sammelleidenschaft bald neben seinem eigentlichen, zu einem zweiten bedeutenden Vermögen gekommen, das ruhig als ein Millionenvermögen bezeichnet werden kann. Die unbekannten Künstler, die er förderte, waren bald, nachdem er sie mehr oder weniger entdeckt und indem er ihre Arbeiten angekauft und gleichzeitig bekannt gemacht hat, berühmt geworden.
Mein Onkel Georg hatte für den primitiven Geschäftsgeist meiner Familie nichts übrig, er haßte im Grunde die alljährlich ausgebeutete Natur auf dem Land und er verachtete die jahrhundertealten Traditionen von Wolfsegg insgesamt, ob es sich nun um die Produktion von Fleisch und Fett, Haut und Holz und Kohle oder um die Jagd handelte, die er am tiefsten haßte, die aber von seinem Bruder, meinem Vater, und seinem Neffen, meinem Bruder, als die erste aller möglichen Leidenschaften betrieben wurde. Die Jagd haßte er von allen hassenswerten Leidenschaften am allertiefsten. Während seine Eltern, meine Großeltern, der Jagd verfallen waren, wie auch mein Vater, sein Bruder, der Jagd verfallen war, hatte sich mein Onkel Georg immer geweigert, auf die Jagd zu gehen. Er aß auch wie ich kein Wild und hatte sich, während die übrige Familie auf der Jagd gewesen war, in eine der Bibliotheken eingesperrt, um sich durch intensive Lektüre von den Jagdexzessen der Familie abzulenken, während sie die Hirsche abschossen, saß ich in der Bibliothek hinter festverschlossenen Fensterbalken, um ihre Schüsse nicht hören zu müssen, sagte er, und las Dostojewski. Mein Onkel Georg liebte die russische Literatur wie ich, vor allem Dostojewski und Lermontow, und er hat oft sehr Kluges über diese russischen Dichter gesagt und sich immer wieder mit den beiden Revolutionären Kropotkin und Bakunin auseinandergesetzt, die er, was die sogenannte Memoirenliteratur betrifft, als die höchsten einschätzte, und er war es, der mich in die russische Literatur eingeführt hat als ein ganz und gar in der russischen Literatur beschlagener Fachmann, dem das Russische so geläufig war wie das Französische und dem ich selbst meine Liebe zur russischen, später auch zur französischen Literatur, verdanke. Wie ich ja überhaupt einen Großteil meines Geistesvermögens meinem Onkel Georg verdanke. Er, mein Onkel Georg, hatte mir schon sehr früh sozusagen die Augen für die übrige Welt geöffnet, mich darauf aufmerksam gemacht, daß es außer Wolfsegg und daß es außerhalb Österreichs auch noch etwas anderes gibt, etwas noch viel Großartigeres, etwas noch viel Ungeheuerlicheres und daß die Welt nicht nur, wie allgemein üblich angenommen wird, aus einer einzigen Familie, sondern aus Millionen Familien besteht, aus nicht nur einem einzigen Ort, sondern aus Millionen solcher Orte und nicht nur aus einem einzigen Volk, sondern aus vielen Hunderten und Tausenden von Völkern und nicht nur aus einem einzigen Land, sondern aus vielen Hunderten und Tausenden von Ländern, die alle jeweils die schönsten und wichtigsten sind. Die ganze Menschheit ist eine unendliche mit allen Schönheiten und Möglichkeiten, sagte mein Onkel Georg. Nur der Stumpfsinnige glaubt, die Welt höre da auf, wo er selbst aufhört. Mein Onkel Georg hat mich aber nicht nur in die Literatur eingeführt und mir die Literatur als das Paradies ohne Ende geöffnet, er hat mich auch in die Welt der Musik eingeführt und mir für alle Künste die Augen geöffnet. Erst wenn wir einen ordentlichen Kunstbegriff haben, haben wir auch einen ordentlichen Naturbegriff, sagte er. Erst wenn wir den Kunstbegriff richtig anwenden und also genießen können, können wir auch die Natur richtig anwenden und genießen. Die meisten Menschen kommen niemals zu einem Kunstbegriff, nicht einmal zu dem einfachsten und begreifen dadurch auch niemals die Natur. Die ideale Anschauung der Natur setzt einen idealen Kunstbegriff voraus, sagte er. Die Menschen, die vorgeben, die Natur zu sehen, aber keinen Kunstbegriff haben, sehen die Natur nur oberflächlich und niemals ideal und das heißt, in ihrer ganzen unendlichen Großartigkeit. Der Geistesmensch hat die Chance, zuerst, über die Natur, zu einem idealen Kunstbegriff zu kommen, um auf die ideale Naturanschauung zu kommen über den idealen Kunstbegriff. Mein Onkel Georg lief mit mir nicht, wie mein Vater, auf unseren Italienreisen von einer Säule zur andern, von einem Denkmal zum andern, von einer Kirche zur andern, von einem Michelangelo zum andern, er hat mich überhaupt nie zu irgendeinem Kunstwerk geführt. Gerade deshalb verdanke ich aber meinem Onkel Georg mein Kunstverständnis, weil er mich nicht von einer Kunstberühmtheit zur andern drängte, wie meine Eltern, sondern mit allen diesen Kunstwerken immer in Ruhe ließ, mich immer nur aufmerksam machte darauf, daß es sie gibt und wo sie zu finden seien, aber nicht, wie meine Eltern es mit mir getan haben, meinen Kopf alle Augenblicke an eine Säule oder an eine römische oder griechische Mauer stieß. Dadurch, daß die Meinigen, außer meinem Onkel Georg, meinen Kopf schon in früher Kindheit an die sogenannten berühmten Altertümer der Welt gestoßen haben, mit der ihnen eigenen plumpen Rücksichtslosigkeit, haben sie meinen Kopf sehr bald völlig unempfindlich gemacht für jede Art von Kunst, sie hatten sie mir dadurch nicht nahe gebracht, sondern verekelt. Ich hatte viele Jahre darauf zu verwenden gehabt, meinen von ihnen an diesen Hunderten und Tausenden von Kunstwerken stumpfsinnig gestoßenen Kopf wieder in Ordnung zu bringen. Wäre ich nur schon als Kind, in welches bis zum äußersten Überdruß alles völlig wahllos hineinzustopfen meine Eltern sich niemals zurückgehalten hatten, unter dem Einfluß meines Onkels Georg gestanden, dachte ich, ich hätte einen großen Vorteil gehabt. Zuerst aber mußte ich, kurz gesagt, von meinen Eltern fast zur Gänze vernichtet werden, um dann, als ich schon über zwanzig gewesen war und, wie es schien, rettungslos verloren, von meinem Onkel Georg doch noch geheilt zu werden. Mit Bedacht und mit Behutsamkeit. Als ich begriff, was mein Onkel Georg für mich und mein Weiterkommen und für meine ganze Entwicklung bedeutete, war es für eine Behandlung schon fast zu spät gewesen. Meiner Willensstärke, aus dem Unheil von Wolfsegg, also aus dem von meinen Eltern in mir angerichteten Unheil herauszukommen, sowie der Hellsichtigkeit meines Onkels Georg verdanke ich aber letzten Endes meine Rettung. Daß ich keine Existenz zu führen hatte als Erwachsener, wie die Meinigen alle, außer meinem Onkel Georg, sondern die ihnen entgegengesetzte, wie mein Onkel Georg. Zeitlebens haben sie meinen Onkel Georg gehaßt, gar nicht mehr versteckt in den letzten Jahrzehnten, sie haben ihn mit der Zeit genauso behandelt wie mich, so gedacht über ihn, wie über mich, ihn so hintergangen, wie mich. Aber er war auf ihre Bedachtnahme nicht angewiesen. Eines Tages hatte er sich in den Zug gesetzt, nachdem er seine Finanzen geordnet hatte und war nach Nizza. Dort hatte er sich erst einmal ein
paar Wochen ausgeschlafen, um sich dann in aller Frische, wie er immer wieder gesagt hat, nach einem für ihn günstigen Platz umzusehen. Am Meer mußte dieser Platz sein, in einem großen Garten, in der besten Luft, in der andererseits verkehrsgünstigsten Lage. Mit Verbitterung hatten sie in Wolfsegg seine ersten Ansichtskarten in Empfang genommen. Sie sahen den Onkel Georg sich in der Sonne räkeln, in allen möglichen selbstverständlich maßgeschneiderten Pariser Leinenanzügen am Meeresufer promenieren, und in ihren Träumen, die naturgemäß immer nur Alpträume gewesen waren, betrat er, den sie zeitlebens nur einen nichtsnutzen Schurken genannt haben, immer wieder die Bankportale in den Rivieranobelorten, um sich die Zinsen seines sich von Tag zu Tag ganz von selber vergrößernden Vermögens abzuheben. Sie waren zu dumm, um an eine Geistesexistenz auch nur zu glauben. Mein Onkel Georg führte eine Geistesexistenz, wie ein paar Hundert vollgeschriebene Notizbücher beweisen. Die Beschränktheit des Mitteleuropäers, der, wie ja gesagt wird, lebt, um zu arbeiten, anstatt zu arbeiten, um zu leben, wobei es ganz und gar gleichgültig ist, was unter Arbeit zu verstehen ist, war meinem Onkel Georg schon sehr früh auf die Nerven gegangen und er hatte die Konsequenz aus seinen Überlegungen gezogen. Das Aufderstelletreten war seine Sache nicht. In seinen Kopf muß der Mensch frische Luft hereinlassen, sagte er immer wieder, das heißt, er muß immer wieder, und zwar tagtäglich, die Welt in seinen Kopf hereinlassen. In Wolfsegg haben sie niemals frische Luft in ihren Kopf und also auch nicht die Welt in ihn hineingelassen. Starr und steif saßen sie, so wie sie darauf gemacht worden sind, auf ihrem Erbe zu keinem anderen Zweck, als immer nur darauf zu achten, daß sich dieses Erbe als gigantischer Besitzklumpen nur noch mehr und mehr verfestigte, ja nicht auflöste. Mit der Zeit hatten sie alle nach und nach die Starre und die Festigkeit und die absolute Härte dieses Besitzklumpens angenommen, ohne es selbst zu merken. Sie waren immer mit diesem Besitzklumpen zu einer furcht- und ekelerregenden Einheit verschmolzen und merkten es nicht. Mein Onkel Georg merkte es aber. Er wollte mit diesem Besitzklumpen nichts zu tun haben. Er wartete nur den geeigneten, wahrscheinlich sogar idealen Augenblick ab, um sich von diesem Wolfsegger Besitzklumpen loszureißen. Sie hatten ihm ja, wie ich weiß, den Vorschlag gemacht, sein Erbe nicht aus Wolfsegg abzuziehen, sondern sich mit einer quasi sicheren Rente zufriedenzugeben. Seine Hellsicht bewahrte meinen Onkel vor einer solchen Dummheit. Leute wie die Meinigen sind am skrupellosesten vor allem gegen ihre Familienmitglieder, wenn es darauf ankommt. Sie scheuen letzten Endes vor keiner Infamität zurück. Unter dem Mantel ihrer Christlichkeit und Großartigkeit und Gesellschaftlichkeit sind sie nichts als habgierig und gehen, wie gesagt wird, über Leichen. Mein Onkel Georg hatte von Anfang an nicht in ihre Pläne gepaßt. Tatsächlich fürchteten sie ihn, weil er sie früh durchschaut hatte. Er hatte sie schon als Kind bei ihren Scheußlichkeiten ertappt und sie immer, furchtlos, auf diese ihre Scheußlichkeiten aufmerksam gemacht, ihnen diese Scheußlichkeiten tapfer vorgehalten, er soll, wie gesagt wird, auf Wolfsegg das gefürchtetste Kind gewesen sein. Hellsichtig von Anfang an, soll er es sich schon zur frühen Leidenschaft gemacht haben, die Seinigen bloßzustellen. Er lauerte ihnen schon als kleines Kind auf und konfrontierte sie mit ihren Widerwärtigkeiten. Kein Kind soll auf Wolfsegg so viele Fragen gestellt, so viele Antworten gefordert haben. Mir selbst haben die Meinigen immer vorgeworfen, ich würde werden wie mein Onkel Georg. Als ob es sich um den abschreckendsten aller Menschen handelte, sagten sie alle Augenblicke zu mir: du wirst wie dein Onkel Georg. Aber es fruchtete nichts, wenn sie mich vor meinem Onkel Georg warnten, denn ich hatte von Anfang an niemand andern mehr geliebt in Wolfsegg als den Onkel Georg. Dein Onkel Georg ist ein Unmensch! haben sie oft gesagt. Dein Onkel Georg ist ein Parasit! Dein Onkel Georg ist eine Schande für uns! Dein Onkel Georg ist ein Verbrecher! Die Liste der Schauertitel, die sie für meinen Onkel Georg ständig parat hatten, hatte auf mich niemals die von ihnen gewünschte Wirkung gehabt. Alle paar Jahre besuchte er uns von Cannes aus auf ein paar Tage, selten auf ein paar Wochen, dann war ich der glücklichste Mensch gewesen. Es war meine große Zeit, wenn der Onkel Georg in Wolfsegg war. Plötzlich war Wolfsegg etwas anderes als das alltägliche. Großstädtisch ging es dann in Wolfsegg zu. Die Bibliotheken waren auf einmal gelüftet, Bücher wanderten hin und her, Musik erfüllte die Räume, die sonst nur kalte, finstere, völlig lautlose Höhlen waren. Plötzlich waren die Zimmer, die allgemein als abstoßend empfunden wurden, gemütlich, anheimelnd. Die Stimmen, die sonst in Wolfsegg immer nur in einem barschen Ton zu hören waren, barsch oder unterdrückt, klangen auf einmal völlig natürlich. Es durfte gelacht werden, auch in Unterhaltungen in normaler Lautstärke gesprochen werden, nicht nur dann, wenn es galt, dem Personal Befehle zu erteilen. Warum redet ihr denn immer, wenn das Personal da ist, französisch? herrschte mein Onkel Georg meine Eltern an, das ist doch lächerlich. Ich war unter solchen Bemerkungen seinerseits der glücklichste Mensch. Warum macht ihr denn bei diesem herrlichen Wetter die Fenster nicht auf? sagte er. Während sonst und besonders deprimierend in den letzten Jahren bei Tisch immer nur über Schweine und Rinder, über Holzfuhren und die günstigeren oder ungünstigeren Lagerhauspreise gesprochen wurde, fielen auf einmal Wörter wie Tolstoi oder Paris oder New York oder Napoleon oder Alfons der Dreizehnte oder Meneghini, Callas, Voltaire, Rousseau, Pascal, Diderot.
Ich sehe ja mein Essen gar nicht, hatte mein Onkel ganz ungeniert gesagt, worauf meine Mutter vom Tisch aufgesprungen ist und die Fensterläden geöffnet hat. Du mußt die Fensterläden noch weiter öffnen, hat mein Onkel Georg zu ihr gesagt, damit ich meine Suppe sehen kann. Wie könnt ihr denn die ganze Zeit in diesem Halbdunkel existieren? fragte er. Ihr lebt ja in einem Museum! sagte er. Alles schaut aus, als wäre es jahrelang unbenützt. Wozu habt ihr denn das herrliche Geschirr in den Kästen, wenn darauf nicht gegessen wird? Euer kostbares Silber? Ich bewunderte den Onkel Georg. Mit ihm konnte in keinem Fall eine wie immer geartete Langeweile aufkommen. Er saß nicht, wie die andern, starr und steif bei Tisch, er wandte sich alle Augenblicke an einen von uns, um ihn etwas zu fragen oder um ihm irgendeine Wahrheit zu sagen oder irgendein Kompliment zu machen. Du mußt mehr Blau tragen, sagte er zu meiner Mutter, das Grau steht dir nicht. Es sieht aus, als wenn du in Trauer wärst. Dabei ist es schon fünfzehn Jahre her, daß unser Vater gestorben ist. Du, sagte er zu meinem Vater, wirkst, als wärst du bei dir selbst angestellt. Darauf hatte ich hell auflachen müssen. Wurde das Essen aufgetragen, was bei uns immer beinahe in völligem Stillschweigen vor sich gegangen war, scherzte er mit den Mädchen, die das Essen auftrugen, was meine Mutter nur schwer ertragen konnte. Es wird nicht mehr lange dauern, sagte er, unbekümmert um die Anwesenheit der das Essen auftragenden Mädchen, daß niemand mehr da ist, der euch bedient. Dann werdet ihr auf einmal lebendig werden. Es liegt so etwas Revolutionäres in der Luft, sagte er. Ich habe so ein Gespür, es wird etwas kommen, das alles wieder ein wenig zum Leben erweckt. Mein Vater schüttelte auf solche Bemerkungen den Kopf, meine Mutter blickte nur starr ins Gesicht meines Onkels, als hätte sie keinerlei Skrupel, ihm ihre Abneigung zu zeigen. In den mediterranen Ländern, so mein Onkel Georg, ist alles ganz anders, sagte er. Näher erklärte er sich nicht. Als ich, damals vielleicht siebzehn oder achtzehn Jahre alt, wissen wollte, was in den sogenannten mediterranen Ländern anders als bei uns in Mitteleuropa sei, sagte er, daß er es mir eines Tages klarmachen werde, wenn ich selbst diese mediterranen Länder aufsuchte. In den mediterranen Ländern ist das Leben hundertmal mehr wert als hier, sagte er. Ich war naturgemäß begierig, zu erfahren, warum. Die Mitteleuropäer treten wie Puppen auf, nicht wie Menschen, alles ist verkrampft, sagte mein Onkel Georg. Sie bewegen sich niemals natürlich, alles ist steif an ihnen und letzten Endes lächerlich. Und unerträglich. Wie ihre Sprache, die die unerträglichste ist. Das Deutsche ist das Unerträglichste, sagte er. Ich war begeistert, wenn er Die mediterranen Länder sagte. Es ist ein Schock, sagte er, hierher zurückzukommen. Es störte ihn nicht im geringsten, daß er mit seinen Bemerkungen den Zuhörern den Appetit verdorben hatte. Und was für eine abscheuliche Küche! rief er aus. In Deutschland und Österreich und auch in der sogenannten deutschen Schweiz ist es kein Essen, es ist ein Fraß! Die vielgerühmte österreichische Küche ist nichts anderes als eine Zumutung. Eine Vergewaltigung des Magens wie des ganzen Körpers. Ich brauche Wochen, um mich in Cannes von der österreichischen Küche zu erholen. Und was ist ein Land ohne Meer! rief er aus, ohne den Gedanken weiterzuführen. Wenn er einen Schluck Wein trank, rümpfte er die Nase. Wie ich deutlich sehen konnte, hatte er auch an den österreichischen Mineralwassern etwas auszusetzen, die sonst allgemein als sehr gut bezeichnet werden, aber er gab keinen Kommentar dazu ab. Es mußte ihn, so dachte ich schon damals, in Wolfsegg unendlich langweilen, denn zu dem, wozu er immer die größte Lust gehabt hat, nämlich ein anregendes Gespräch zu führen, war er in Wolfsegg niemals gekommen. Manchmal machte er, wenigstens in den ersten Tagen seines Aufenthalts, einen Versuch, warf er beispielsweise das Wort Goethe mehr oder weniger unvermittelt auf den Tisch; aber sie konnten damit nichts anfangen. Geschweige denn mit Wörtern wie Voltaire, Pascal, Sartre. Da sie mit ihm nicht mithalten konnten, wie sie unausgesetzt fühlten, begnügten sie sich mit ihrer Abneigung gegen ihn, die sich von Tag zu Tag steigerte, die schließlich gegen Ende seines Aufenthalts immer in offenen Haß umschlug. Fortwährend gaben sie ihm zu verstehen, daß sie schwer arbeiteten, während er das absolute Nichtstun und die Spekulation mit diesem Nichtstun zu seinem Tagesinhalt und, wie es schien, lebenslänglichen Ideal gemacht habe. Weißt du, hat er einmal zu mir gesagt, ich komme ja nicht wegen der Familie nach Wolfsegg, nur wegen der Mauern und der Landschaft, die mir meine Kindheit vergegenwärtigen. Und wegen dir, sagte er nach einer Pause. In seinem Testament hatte er bestimmt, daß er nicht, wie die Seinigen und die Meinigen geglaubt haben, in Wolfsegg, sondern in Cannes begraben wird. Er wollte am Meer begraben sein. Mehr oder weniger pompös und also ganz und gar provinziell aufgeputzt, waren sie zu seinem Begräbnis nach Cannes geeilt in Erwartung eines ungeheuerlichen Vermögens und mußten, wie ich schon angedeutet habe, die größte Enttäuschung ihres Lebens, so meine Mutter immer wieder, zur Kenntnis und mit nachhause nehmen. Der gute Jean, Sohn eines armen Fischerehepaars aus Marseille, hatte nicht weniger als vierundzwanzig Millionen Schilling in Aktien und ein mindestens doppelt so hohes Vermögen an realem Besitz geerbt. Die Kunstsammlung hatte mein Onkel Georg den Museen in Cannes und Nizza vermacht. Auf seinem Grabstein, den ihm der gute Jean hatte setzen lassen, sollten nur sein Name und folgende Wörter stehen: der zu dem richtigen Zeitpunkt die Barbaren hinter sich gelassen hat. Jean hat sich streng an die Anweisung meines Onkels Georg gehalten. Als meine Eltern vor einem Jahr auf dem Weg nach Spanien einen Besuch an seinem Grab machten, sollen sie sich so aufgeregt haben, daß meine Mutter danach geschworen habe, Onkel Georgs Grab niemehr aufzusuchen, sie empfand seinen Grabspruch als eine ungeheuerliche Schande und soll nach ihrer Rückkehr nach Wolfsegg immer nur von einem Verbrechen ihres Schwagers, meines Onkels Georg, gesprochen haben. Mit dem Onkel Georg habe ich die weitesten und interessantesten Spaziergänge in der Umgebung Wolfseggs gemacht, mit ihm bin ich zu Fuß bis nach Ried im Innkreis in der einen und bis nach Gmunden in der anderen Richtung gegangen. Er hatte sich immer Zeit genommen für mich. Daß es auf der Welt auch noch etwas anderes als Kühe, Dienstboten und streng einzuhaltende gesetzliche Feiertage gibt, diese Erkenntnis habe ich ihm zu verdanken. Ihm verdanke ich die Tatsache, daß ich nicht nur lesen und schreiben, sondern auch tatsächlich denken und phantasieren gelernt habe. Es ist sein Verdienst, daß ich Geld zwar sehr hoch, aber nicht am allerhöchsten einschätze und daß ich die Menschheit außerhalb Wolfseggs nicht nur als ein notwendiges Übel betrachte, wie zeitlebens die Meinigen, sondern als einen lebenslänglichen Ansporn, mich mit ihr auseinanderzusetzen als der größten und spannendsten Ungeheuerlichkeit. Mein Onkel Georg hat mir die Musik und die Literatur aufgeschlüsselt und mir die Komponisten und die Dichter als lebendige Menschen nahegebracht, nicht nur als jährlich drei- oder viermal abzustaubende Gipsfiguren. Ihm verdanke ich, daß ich unsere, wie es schien, für immer und ewig verschlossenen Bücher in unseren Bibliotheken aufmachte und in ihnen zu lesen angefangen habe und mit diesem Lesen bis heute nicht aufgehört habe, daß ich schließlich zu philosophieren gelernt habe. Meinem Onkel Georg verdanke ich, daß ich schließlich nicht nur ein mechanisch sich in die Wolfsegger Geld- und Wirtschaftsmühle fügender, sondern ein durchaus als frei zu bezeichnender Mensch geworden bin. Daß ich nicht nur stumpfsinnige sogenannte Bildungsreisen gemacht habe, wie sie meine Eltern gewohnt waren und wie ich sie auch die ersten Jahre mit meinen Eltern gemacht habe, nach Italien und nach Deutschland beispielsweise, nach Holland und nach Spanien, sondern daß ich die Wissenschaft des Reisens als eines der größten Vergnügen, die die Welt anzubieten hat, erlernt und bis heute genossen habe. Ich habe durch meinen Onkel Georg keine toten, sondern sehr lebendige Städte kennengelernt, keine toten Völker aufgesucht, sondern lebendige, keine toten Schriftsteller und Dichter gelesen, sondern lebendige, keine tote Musik gehört, sondern eine lebendige, keine toten Bilder gesehen, sondern lebendige. Er, niemand anderer, hat mir die großen Namen der Geschichte nicht als fade Abziehbilder einer ebenso faden Geschichte auf die Innenwände meines Gehirns geklebt, sondern sie mir immer als lebendige Menschen auf einer lebendigen Bühne vorgeführt. Während mir meine Eltern die Welt tagtäglich als eine durch und durch langweilige, meinen Kopf nach und nach lähmende vorgezeigt haben, als eine, auf welcher es sich im Grunde gar nicht auszahlt zu existieren, hatte mir mein Onkel Georg im Gegenteil dieselbe Welt als eine immerfort und allezeit hochinteressante vorgeführt. So hatte ich schon als ganz kleines Kind immer die Wahl zwischen zwei Welten gehabt, zwischen der der Eltern, die ich immer als uninteressant und als nichts anderes als lästig empfunden habe, und der meines Onkels Georg, die überhaupt nur aus ungeheuerlichen Abenteuern zu bestehen schien, in welcher es einem niemals langweilig werden konnte und in welcher man tatsächlich immer Lust hatte, ewig zu leben, in welcher es eine Selbstverständlichkeit war, zu denken, sie möge niemals aufhören, was wiederum automatisch zur Folge hatte, daß ich in ihr ewig und das heißt, unendlich leben wollte. Meine Eltern hatten, vereinfacht gesagt, immer alles hingenommen, mein Onkel Georg hatte niemals etwas hingenommen. Meine Eltern hatten von Geburt an immer nur nach den ihnen von ihren Vorgängern vorgeschriebenen Gesetzen gelebt und waren niemals auf die Idee gekommen, sich einmal
eigene, neue Gesetze zu machen, um nach diesen von ihnen gemachten neuen Gesetzen zu leben, mein Onkel Georg hatte nur nach