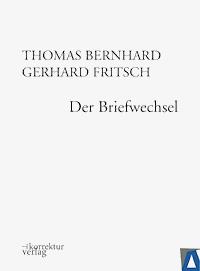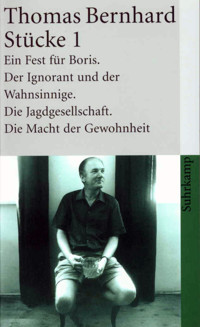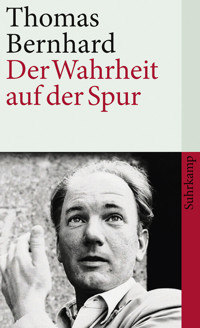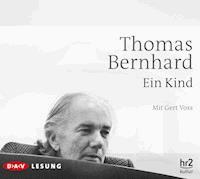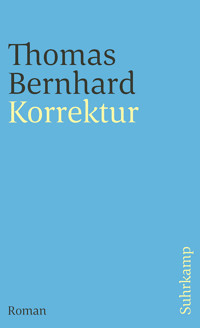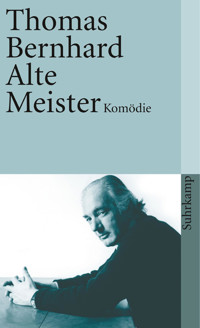9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rudolf, der Erzähler dieses 1982 erschienenen Buches, bereitet seit einem Jahrzehnt mit leidenschaftlichem Ernst eine größere wissenschaftliche Arbeit über seinen Lieblingskomponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy vor. Nachdem er zuerst durch den Besuch seiner Schwester und dann, nach ihrem Weggang, durch die quälende Furcht, sie könnte wieder zurückkommen, am Schreiben des ersten Satzes seiner Studie gehindert wird, quält ihn die »Hölle des Alleinseins«. Deshalb packt er die Koffer, nimmt nur die wichtigsten seiner Schriftstücke mit, um in Palma seine Arbeit zu realisieren. In einem dortigen Cafe erinnert er sich an eine junge Frau, die ihn bei seinem letzten Palma-Aufenthalt vor eineinhalb Jahren angesprochen hatte. Sie war verzweifelt, ihr Mann hatte sich nachts vom Balkon des Hotels Paris gestürzt. Auf dem Friedhof von Palma, in einem der sieben Stock hohen Betonbestattungskästen, ist er beerdigt worden. Noch jetzt, eineinhalb Jahre danach, sieht er das verzweifelte Gesicht der Frau. Nun hat er eine Reihe von ersten Sätzen für seine Arbeit im Ohr, aber auch das Unglück der jungen Frau. Er nimmt ein Taxi, fährt zum Friedhof und findet an der Tafel neben dem Namen des Mannes nun auch den Namen der Frau: suicido – erfährt er.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Thomas Bernhard
Beton
Suhrkamp Verlag
Von März bis Dezember, schreibt Rudolf, während ich, was in diesem Zusammenhang gesagt sein muß, große Mengen Prednisolon einzunehmen hatte, um meinem zum dritten Mal akut gewordenen morbus boeck entgegenzuwirken, trug ich alle nur möglichen Bücher und Schriften von und über Mendelssohn Bartholdy zusammen, suchte alle möglichen und unmöglichen Bibliotheken auf, um meinen Lieblingskomponisten und sein Werk von Grund auf kennenzulernen und, so mein Anspruch, mit dem leidenschaftlichsten Ernst für ein solches Unternehmen wie das Niederschreiben einer größeren wissenschaftlich einwandfreien Arbeit, vor welcher ich tatsächlich schon den ganzen vorausgegangenen Winter die größte Angst gehabt habe, alle diese Bücher und Schriften auf das sorgfältigste zu studieren, war mein Vorsatz gewesen und erst darauf, endlich, nach diesem gründlichen, dem Gegenstand angemessenen Studium, genau am siebenundzwanzigsten Jänner um vier Uhr früh diese meine, wie ich glaubte, alles bisher von mir die sogenannte Musikwissenschaft betreffende von mir aufgeschriebene Veröffentlichte sowie Nichtveröffentlichte weit zurück- und unter sich lassende, schon seit zehn Jahren geplante, aber immer wieder nicht zustande gekommene Arbeit angehen zu können nach der für den Sechsundzwanzigsten bestimmten Abreise meiner Schwester, deren wochenlange Anwesenheit in Peiskam selbst den geringsten Gedanken an eine Inangriffnahme meiner Arbeit über Mendelssohn Bartholdy in seinen Ansätzen sogleich zunichte gemacht hatte. Am Abend des Sechsundzwanzigsten, als meine Schwester tatsächlich und endlich abgereist war, mit allen aus ihrer krankhaften Herrschsucht und aus ihrem sie selbst am meisten verzehrenden, andererseits sie tagtäglich neu belebenden Mißtrauen gegen alles und in erster Linie gegen mich, und den daraus resultierenden Fürchterlichkeiten, war ich mehrere Male aufatmend durch das Haus gegangen, um es einmal gut durchzulüften und schließlich in Anbetracht der Tatsache, daß schon der nächste Morgen der Siebenundzwanzigste sein wird, daran gegangen, alles für mein Vorhaben herzurichten, die Bücher, die Schriften, die Berge von Notizen und die Papiere, alles auf meinem Schreibtisch genau jenen Gesetzen unterzuordnen, die schon immer die Voraussetzung waren für einen Arbeitsbeginn. Wir müssen allein und von allen verlassen sein, wenn wir eine Geistesarbeit angehen wollen! Wie nicht anders zu erwarten, hatte ich nach den Vorbereitungen, die mich über fünf Stunden, von halbneun Uhr am Abend, bis halbzwei Uhr in der Frühe in Anspruch genommen hatten, den Rest der Nacht nicht geschlafen, vor allem quälte mich fortwährend der Gedanke, meine Schwester könne aus irgendeinem Grund zurückkommen und meinen Plan zunichte machen, sie war in ihrem Zustand zu allem fähig, der kleinste Zwischenfall, die geringste Störung, sagte ich mir und sie bricht ihre Heimreise ab und kehrt um und ist wieder da, es ist nicht das erste Mal, daß ich sie an den Wiener Zug gebracht und für Monate verabschiedet habe und zwei oder drei Stunden später war sie wieder in meinem Haus um zu bleiben, solange es ihr beliebte. Ich horchte die ganze Zeit wachliegend, ob sie nicht an der Tür sei, abwechselnd horchte ich, ob meine Schwester an der Tür sei und dachte dann wieder an meine Arbeit, vor allem, wie ich diese Arbeit beginnen werde, was der erste Satz dieser Arbeit sein wird, denn ich wußte noch immer nicht, wie dieser erste Satz lauten solle und bevor ich nicht weiß, wie der erste Satz lautet, kann ich keine Arbeit anfangen und so quälte es mich die ganze Zeit, zu horchen, ob meine Schwester nicht wieder zurückgekommen sei und was für einen ersten Satz ich über Mendelssohn Bartholdy zu schreiben habe, immer wieder horchte ich und war verzweifelt und immer wieder dachte ich über den ersten Satz meiner Arbeit über Mendelssohn nach, genauso verzweifelt. An die zwei Stunden dachte ich gleichzeitig über den ersten Satz meiner Mendelssohn-Arbeit nach und horchte, ob meine Schwester nicht wieder zurückgekommen sei, um meine Arbeit über Mendelssohn, noch bevor ich sie überhaupt angefangen habe, zunichte zu machen. Schließlich aber mußte ich doch aus Erschöpfung, weil ich immer noch intensiver horchte, ob meine Schwester vielleicht wieder zurückgekommen ist, gleichzeitig in dem Gedanken, daß sie, wenn sie tatsächlich wieder zurückkommt, meine Arbeit über Mendelssohn Bartholdy unweigerlich zunichte macht und dazu, wie der erste Satz meiner Arbeit über Mendelssohn lautet, eingenickt sein; als ich erschrocken aufwachte, war es fünf Uhr. Ich hatte um vier Uhr mit meiner Arbeit anfangen wollen, jetzt war es fünf, über diese unvorhergesehene Nachlässigkeit, besser noch Disziplinlosigkeit, meinerseits, war ich erschrocken. Ich stand auf und wickelte mich in die Decke, in die von meinem Großvater mütterlicherseits ererbte Pferdedecke, ich schnürte die Decke mit dem Ledergurt, den ich genauso wie die Decke von meinem Großvater geerbt habe, so fest als möglich zu, so fest, daß ich gerade noch atmen konnte und setzte mich an den Schreibtisch. Naturgemäß war die Finsternis noch die größte. Ich vergewisserte mich, ob ich auch tatsächlich allein im Hause bin, außer meinem eigenen Pulsschlag hörte ich nichts. Mit einem Glas Wasser schluckte ich die mir von meinem Internisten vorgeschriebenen vier Prednisolontabletten und glättete das Papierblatt, das ich vor mich hingelegt hatte. Ich werde mich beruhigen und anfangen, sagte ich mir. Immer wieder sagte ich mir, ich werde mich beruhigen und anfangen, aber als ich es an die hundertmal gesagt hatte und ganz einfach nicht mehr hatte aufhören können, das zu sagen, gab ich auf. Mein Versuch war mißlungen. In der Morgendämmerung war es mir nicht mehr möglich, mit meiner Arbeit anzufangen. Das Tageslicht zerstörte endgültig meine Hoffnung. Ich stand auf und verließ fluchtartig meinen Schreibtisch. Ich ging ins Vorhaus hinunter, weil ich glaubte, mich da, in der Kälte, zu beruhigen, denn ich war, über eine ganze Stunde am Schreibtisch sitzend, in eine mich beinahe wahnsinnig machende Erregung hineingekommen, in eine solche nicht nur von meiner Geistesangespanntheit, sondern auch von den Prednisolontabletten hervorgerufenen Erregung, die ich gefürchtet hatte. Ich preßte beide Handflächen an die kalte Mauer, eine schon oft bewährte Methode, dieser Erregung Herr zu werden und beruhigte mich tatsächlich. Ich war mir bewußt, daß ich mich einem Thema ausgeliefert habe, das mich möglicherweise vernichten wird, aber ich hatte doch geglaubt, wenigstens den Anfang meiner Arbeit machen zu können an diesem Morgen. Ich hatte mich getäuscht, obwohl sie gar nicht mehr da war, fühlte ich doch an allen Ecken und Enden des Hauses noch meine Schwester, welche das geistfeindlichste Wesen ist, das sich denken läßt. Allein der Gedanke an sie, macht alles Denken in mir zunichte, hat immer alles Denken in mir zunichte gemacht, hat alle meine Geistespläne im Keim erstickt. Sie ist längst fort und beherrscht mich noch immer, dachte ich, meine Hände fest an die kalte Vorhausmauer drückend. Schließlich hatte ich die Kraft, meine Hände von der kalten Vorhausmauer zurückzuziehen und ein paar Schritte zu gehen. Auch in dem Vorhaben, über Jenufa etwas zu schreiben, war ich gescheitert, das war Ende Oktober, kurz bevor meine Schwester ins Haus gekommen ist, sagte ich mir, jetzt scheitere ich auch an Mendelssohn Bartholdy und ich scheitere sogar jetzt, wo meine Schwester gar nicht mehr da ist. Selbst die Skizze Über Schönberg habe ich nicht zuende gebracht, sie hat sie mir vernichtet, sie hat sie mir zuerst zerstört und dann endgültig vernichtet, indem sie genau in dem Augenblick in mein Zimmer eingetreten ist, in welchem ich glaubte, die Skizze zuende schreiben zu können. Aber gegen einen solchen Menschen wie meine Schwester, der so stark und gleichzeitig so geistfeindlich ist, kann man sich nicht wehren, er kommt und vernichtet, was der Kopf sich in monatelanger wahnsinniger Gedächtnisanstrengung, ja Gedächtnisüberanstrengung ausgedacht hat, sei es, was es wolle, sei es die kleinste Skizze über den kleinsten Gegenstand. Und nichts ist so zerbrechlich wie die Musik, welcher ich mich tatsächlich in den letzten Jahren ausgeliefert habe, zuerst hatte ich mich der praktischen Musik ausgeliefert, dann der theoretischen, zuerst die praktische bis zum Äußersten praktiziert, dann die theoretische, aber meine Schwester und alle ihr ähnlichen Menschen, deren Unverständnis mich Tag und Nacht verfolgt, hat alle meine Pläne zunichte gemacht, Jenufa hat sie mir zerstört, Moses und Aron, meine Schrift Über Rubinstein, meine Arbeit über Die Six, überhaupt alles und jedes, das mir heilig gewesen ist. Es ist furchtbar, kaum bin ich zu einer musikalischen Geistesarbeit fähig, taucht meine Schwester auf und zerstört sie mir. Als ob sie alles darauf richtete, meine Geistesarbeit zu zerstören. Als ob sie in Wien fühlte, daß ich hier, in Peiskam, ein Thema anzugehen im Begriff bin, wenn ich das Thema angehen will, taucht sie auf und zerstört es mir. Die Menschen sind dazu da, den Geist aufzuspüren und ihn zu vernichten, sie fühlen, ein Kopf ist bereit zu einer Geistesanstrengung und reisen herbei, um diese Geistesanstrengung im Keim zu ersticken. Und ist es nicht meine Schwester, die unglückliche, die bösartige, die hinterhältige, so ist es ein anderer ihrer Wesensart. Wieviele Schriften habe ich angefangen und dann, weil meine Schwester aufgetaucht ist, verbrannt. In den Ofen geworfen bei ihrem Auftreten. Kein Mensch sagt so oft wie sie: ich störe doch nicht?, ein Hohn, wenn das ein Mensch fortwährend auf der Zunge führt, der immer gestört hat und immer stören wird und dessen Lebensaufgabe es zu sein scheint, zu stören, alles und jedes zu stören und damit zu zerstören und letztenendes zu vernichten und immer wieder das zu vernichten, was mir als das allerwichtigste erscheint auf der Welt: ein Geistesprodukt. Schon als wir Kinder waren, hatte sie bei jeder Gelegenheit versucht, mich zu stören, mich aus meinem, wie ich es damals genannt habe, Geistesparadies zu vertreiben. Wenn ich ein Buch in der Hand hatte, verfolgte sie mich so lange, bis ich das Buch weglegte, sie hatte ihren Triumph, wenn ich es ihr voller Wut ins Gesicht schleuderte. Ich erinnere mich genau: hatte ich meine Landkarten ausgebreitet auf dem Boden, meine lebenslängliche Leidenschaft, so trat sie, mich im Augenblick erschreckend, aus ihrem Versteck hinter meinem Rücken und gerade auf die Stelle, auf die ich meine ganze Aufmerksamkeit gerichtet hatte, überall, wo ich meine geliebten Länder und Erdteile ausgebreitet habe, um sie mit meinen kindlichen Phantasien anzufüllen, sehe ich ihren plötzlich und bösartig daraufgesetzten Fuß. Schon mit fünf, sechs Jahren hatte ich mich in unseren Garten zurückgezogen mit einem Buch, einmal war es, ich erinnere mich deutlich, ein blaueingebundener Band mit Gedichten von Novalis gewesen aus der großväterlichen Bibliothek, in welchem ich, ohne ganz eigentlich zu verstehen, was in ihm gedruckt gewesen war, mein ganzes Sonntagnachmittagsglück herausgelesen hatte, Stunde um Stunde, bis mich meine Schwester ausfindig machte und mit Geschrei aus dem Gebüsch stürzte und mir das Novalis-Buch entriß. Unsere jüngere Schwester war ganz anders, aber sie ist seit dreißig Jahren tot und es ist unsinnig, sie heute mit meiner älteren zu vergleichen, die kränkelnde und kranke und schließlich tote, mit der immer gleich gesunden, alles um sie herum beherrschenden. Auch ihr Mann hatte sie nur zweieinhalb Jahre ausgehalten, dann flüchtete er aus ihrer Umklammerung nach Südamerika, nach Peru, um sich nie wieder bei ihr zu melden. Was sie anrührte, zerstörte sie und sie hat zeitlebens versucht, mich zu zerstören. Zuerst unbewußt, später bewußt, hatte sie alles darauf angelegt, mich zu vernichten. Bis zum heutigen Tag mußte ich mich gegen diesen unbändigen Vernichtungswillen meiner älteren Schwester wehren und ich weiß gar nicht, wie es mir bis heute gelungen ist, ihr zu entkommen. Sie tritt auf, wann sie will, sie geht, wann sie will, sie tut, was sie will. Sie heiratete den Realitätenvermittler, ihren Mann, um ihn nach Peru zu vertreiben und das Realitätenvermittlungsgeschäft zur Gänze an sich zu reißen. Sie ist ein Geschäftsmensch, darauf war sie schon als ganz kleines Kind angelegt, auf die Geistesverfolgung und die mit dieser eng einhergehende Geldvermehrung. Daß wir dieselbe Mutter haben, habe ich nie begreifen können. Jetzt war sie schon beinahe vierundzwanzig Stunden aus dem Haus und beherrschte mich immer noch. Ich konnte mich ihr nicht entziehen, ich versuchte es verzweifelt, aber es gelang mir nicht. Bei dem Gedanken, daß sie bis heute im Schlafwagen grundsätzlich nur mit den eigenen Leintüchern reist, graust es mich. Ich riß zum drittenmal die Fenster auf, durchlüftete das ganze Haus bis es die hereingebrochene Kälte zu einem einzigen Eiskasten gemacht hatte, in welchem ich zu erfrieren drohte; hatte ich zuerst die Angst gehabt, ersticken zu müssen, so ängstigte mich jetzt der Gedanke, erfrieren zu müssen. Und alles wegen dieser Schwester, unter deren Einfluß ich zeitlebens zu ersticken und zu erfrieren drohte. Tatsächlich liegt sie in ihrer Wiener Wohnung bis halbelf Uhr vormittags im Bett und geht erst gegen halbzwei Uhr ins Imperial oder Sacher essen, wo sie, ihren Tafelspitz zerlegend und schluckweise ihren Rosé trinkend, mit den verkommenen Fürsten und überhaupt allen möglichen und unmöglichen kaiserlichen Hoheiten ihre Geschäfte macht. Mich ekelt vor ihrer heutigen Existenz. Auch an diesem Abreisetag hatte sie ihr Zimmer vollkommen unaufgeräumt hinterlassen, so daß ich mich schon gleich bei seinem Anblick vor der erst am darauffolgenden Wochenende kommenden Frau Kienesberger, die seit über zehn Jahren das Haus in Ordnung hält, genierte; alles lag wild durcheinander auf drei großen Haufen und die Bettdecke auf dem Boden. Und obwohl ich schon, wie gesagt, dreimal gelüftet hatte, war noch immer der Geruch meiner Schwester im Zimmer, tatsächlich war ihr Geruch noch immer im ganzen Haus, mich ekelte vor diesem Geruch. Sie hat auch meine jüngere Schwester auf dem Gewissen, denke ich oft, denn auch sie hatte vor ihrer älteren Schwester fortwährend Angst gehabt, in ihrer letzten Zeit wahrscheinlich tatsächlich Todesangst. Die Eltern machen ein kleines Kind und setzen damit ein Ungeheuer in die Welt, denke ich, das alles, das mit ihm in Berührung kommt, umbringt. Einmal hatte ich eine Schrift über Haydn verfaßt, nicht über Josef, über Michael Haydn, als sie plötzlich auftrat und mir die Feder aus der Hand schlug. Da ich die Schrift nicht fertig hatte, war sie ruiniert. Jetzt habe ich dir deine Schrift ruiniert!, rief sie aus voller Entzücken und lief zum Fenster und rief diesen teuflischen Satz mehrere Male ins Freie, jetzt habe ich dir deine Schrift ruiniert! Jetzt habe ich dir deine Schrift ruiniert! Dieser grauenhaften Überrumpelung war ich nicht gewachsen. Bei Tisch zerstörte sie jedes Gespräch schon in den Ansätzen, sie unterbrach es ganz einfach mit einem plötzlichen Gelächter oder mit einer grenzenlos dummen Bemerkung, die nichts mit dem gerade angefangenen Gespräch zu tun hatten. Mein Vater hatte sie noch am ehesten bändigen können, aber meine Mutter war ihr erbarmungslos ausgeliefert. Als unsere Mutter gestorben war, hatte meine Schwester, wir waren noch am Grab gestanden, mit gröbster Roheit vor sich hingesagt: sie hat sich selbst umgebracht, sie war einfach zu schwach zum Leben. Die einen sind stark und die andern sind schwach, waren ihre Wörter, wie wir aus dem Friedhof herausgegangen sind. Aber ich muß mich von meiner Schwester befreien, sagte ich mir jetzt und ging in den Hof hinaus. Ich atmete tief ein, was augenblicklich einen
Hustenanfall bewirkte, sofort trat ich wieder ins Haus und ich mußte mich auf den Sessel unter dem Spiegel setzen, um einer Ohnmacht zuvorzukommen. Nur langsam erholte ich mich von dem Kälteeinbruch in meine Lungen. Ich nahm zwei Glyzerintabletten und in einem vier von den Prednisolonpillen. Ruhe, Ruhe, sagte ich vor mich hin, dabei beobachtete ich die Maserung des Fußbodens, die Lebenslinien der Lärchenbretter. Diese Beobachtung brachte mich wieder ins Gleichgewicht. Vorsichtig stand ich auf und ging wieder in den ersten Stock. Vielleicht gelingt es mir jetzt, mit meiner Arbeit anzufangen, dachte ich. Aber gerade als ich mich hinsetzte, fiel mir ein, daß ich noch nicht gefrühstückt habe und ich stand wieder auf und ging in die Küche hinunter. Ich nahm Milch und Butter aus dem Eiskasten, die englische Marmelade stellte ich dazu auf den Tisch und schnitt mir zwei Brotscheiben vom Wecken herunter. Ich stellte mir das Teewasser auf und setzte mich, dann, als ich alles für mein Frühstück hergerichtet hatte, an den Tisch. Aber diese Tatsache, die aus dem Eiskasten herausgenommene Butter und das aus der Schublade herausgenommene Brot essen zu müssen, deprimierte mich. Ich machte nur einen einzigen Schluck und verließ die Küche. Hatte ich es schon nicht mehr ausgehalten, jeden Tag mit meiner Schwester zu frühstücken, so hielt ich es jetzt nicht aus, allein zu frühstücken. Es ekelte mich vor dem Frühstück mit meiner Schwester genauso, wie es mich jetzt ekelte, allein zu frühstücken. Du bist wieder allein, du bist wieder allein, sei glücklich!, sagte ich mir, aber das Unglück ließ sich auf diese plumpe Weise nicht übertölpeln. So einfach und mit einer solchen geradezu schamlosen Taktik, läßt sich das Unglück nicht zum Glück machen. Mit vollem Magen hätte ich ja überhaupt nicht mit meiner Schrift über Mendelssohn Bartholdy anfangen können, dachte ich, wenn, so nur mit dem leeren Magen. Der Magen muß leer sein, will ich eine Geistesarbeit wie diese über Mendelssohn Bartholdy anfangen. Und tatsächlich hatte ich immer nur mit leerem Magen eine Arbeit wie die über Mendelssohn Bartholdy anfangen können, niemals mit vollem. Wie habe ich auf die Idee kommen können, anzufangen nach dem Frühstück!, sagte ich mir. Der leere Magen ermöglicht das Denken, der volle Magen knebelt es, würgt es von vornherein ab. Ich ging in den ersten Stock hinauf, aber ich setzte mich nicht gleich an den Schreibtisch, aus einer Entfernung von etwa acht oder neun Metern, durch die offene Tür von dem Neunmeterersterstockzimmer aus, betrachtete ich den Schreibtisch, vor allem, ob auch alles auf meinem Schreibtisch in Ordnung ist. Ja, es ist alles auf dem Schreibtisch in Ordnung, sagte ich mir. Alles. Ich nahm alles auf dem Schreibtisch in Augenschein, unbeweglich, unbestechlich. Ich beobachtete den Schreibtisch so lange, bis ich mich selbst an meinem Schreibtisch sozusagen von hinten sitzen sah, ich sah, wie ich mich, meiner Krankheit entsprechend, vorbeugte, um zu schreiben. Ich sah, daß ich eine krankhafte Körperhaltung habe, aber ich bin ja auch nicht gesund, ich bin ja auch durch und durch krank, sagte ich mir. So wie du da sitzt, sagte ich mir, hast du schon ein paar Seiten über Mendelssohn Bartholdy geschrieben, vielleicht schon zehn oder elf Seiten, so sitze ich am Schreibtisch, wenn ich zehn oder elf Seiten geschrieben habe, sagte ich mir. Ich rührte mich nicht und beobachtete meine Rückenhaltung. Dieser Rücken ist der Rücken meines Großvaters mütterlicherseits, dachte ich, etwa ein Jahr vor seinem Tod. Ich habe dieselbe Rückenhaltung, sagte ich mir. Unbeweglich verglich ich meinen Rücken mit dem Rücken meines Großvaters und ich dachte dabei an eine ganz bestimmte Fotografie, die nur ein Jahr vor dem Tod meines Großvaters gemacht worden ist. Der Geistesmensch ist aufeinmal zu einer solchen krankhaften Rückenhaltung gezwungen und stirbt bald darauf. Ein Jahr darauf, dachte ich. Dann war das Bild weg, ich saß nicht mehr an meinem Schreibtisch, der Schreibtisch war leer, das Blatt Papier darauf war genauso leer. Wenn ich jetzt hingehe und anfange, könnte es mir gelingen, sagte ich mir, aber ich hatte nicht den Mut, hinzugehn, ich hatte die Absicht, aber nicht die Kraft dazu, weder die Körperkraft, noch die Geisteskraft. Ich stand da und schaute durch die Tür auf den Schreibtisch und fragte mich, wann der Moment da sei, an den Schreibtisch zu treten und mich hinzusetzen und mit der Arbeit anzufangen. Ich horchte, aber ich hörte nichts. Obwohl die Nachbarn unmittelbar um das meinige ihre Häuser haben, war nichts zu hören. Als ob in diesem Augenblick alles tot gewesen wäre. Plötzlich war mir dieser Zustand angenehm und ich versuchte, ihn solange als möglich in die Länge zu ziehen. Mehrere Minuten hatte ich diesen Zustand in die Länge ziehen und genießen können, die Vorstellung und die Gewißheit, daß alles tot ist um mich herum. Dann aufeinmal: du gehst an den Schreibtisch und setzt dich hin und schreibst den ersten Satz deiner Studie auf. Nicht mit Behutsamkeit, mit Entschiedenheit!, sagte ich mir. Aber ich hatte nicht die Kraft dazu. Ich stand da und getraute mich kaum zu atmen. Setz’ ich mich hin, gibt es sofort eine Störung, einen unvorhergesehenen Zwischenfall, jemand klopft an die Tür, ein Nachbar schreit, der Briefträger verlangt meine Unterschrift. Du mußt dich ganz einfach hinsetzen und anfangen, ohne nachzudenken, wie im Schlaf mußt du den ersten Satz zu Papier bringen undsofort. Am Abend, während ich noch mit meiner Schwester zusammen war, hatte ich die Sicherheit, in der Frühe, wenn sie endgültig abgereist ist, mit meiner Arbeit anfangen zu können, von den vielen in Betracht gezogenen ersten Sätzen meiner Mendelssohn-Bartholdy-Arbeit dann ganz einfach den einzigen möglichen und dadurch richtigen auf das Papier zu setzen und die Arbeit voranzutreiben, rücksichtslos, weiter und weiter. Ist erst einmal meine Schwester aus dem Haus, kann ich anfangen, habe ich mir immer wieder gesagt und wieder einmal den Sieg davongetragen. Ist der Unmensch aus dem Haus, entsteht meine Arbeit von selbst, mache ich alle auf diese Arbeit bezogenen Ideen zu einer einzigen, zu meinem Werk. Aber jetzt war meine Schwester schon weit über vierundzwanzig Stunden aus dem Haus und ich war weiter denn je davon entfernt, mit meiner Arbeit anfangen zu können. Sie, meine Vernichterin, hatte mich noch immer in ihrer Gewalt. Sie lenkte meine Schritte und verfinsterte gleichzeitig meinen Kopf. Nach dem Tod unseres Vaters, drei Jahre nach dem Tod unserer Mutter, verschärfte sich ihre Rücksichtslosigkeit mir gegenüber. Sie war sich immer ihrer Stärke, gleichzeitig meiner Schwäche bewußt. Diese Schwäche meinerseits hat sie zeitlebens ausgenützt. Was unsere gegenseitige Verachtung betrifft, so hält sie sich seit Jahrzehnten die Waage. Mich ekelt vor ihren Geschäften, sie ekelt vor meiner Phantasie, ich verachte ihre Erfolge, sie verachtet meine Erfolglosigkeit. Das Unglück ist, daß sie das Recht hat, jederzeit, wann sie will, in meinem Haus ihr Quartier aufzuschlagen, dieser fürchterliche Passus im Testament meines Vaters ist für mich entsetzlich. Sie meldet sich ja meistens überhaupt nicht an, ist aufeinmal da und geht, als ob es zur Gänze ihr gehörte, durch mein Haus, in welchem sie ja nur ein Wohnrecht hat, aber dieses Wohnrecht ist ein lebenslängliches und es ist nicht räumlich beschränkt. Und wenn es ihr einfällt, irgendwelche zwielichtigen Freunde mitzubringen, kann ich dagegen nichts tun. Sie breitet sich in meinem Haus, als ob es ihr allein gehörte, aus und verdrängt mich und ich habe nicht die Kraft, mich dagegen zu wehren, ich müßte ein ganz anderer Charakter, ein ganz anderer Mensch sein. Dann weiß ich nicht, bleibt sie zwei Tage oder zwei Stunden oder vier oder sechs Wochen oder überhaupt mehrere Monate, weil es ihr in der Stadt aufeinmal nicht mehr gefällt und sie sich die Landluft verschrieben hat. Wie sie mein lieber kleiner Bruder sagt, davor ekelt es mich. Mein lieber kleiner Bruder, sagt sie, jetzt bin ich in der Bibliothek, nicht du und sie fordert tatsächlich, daß ich, selbst wenn ich schon eingetreten bin oder überhaupt schon längere Zeit vor ihr in der Bibliothek gewesen bin, die Bibliothek augenblicklich verlasse. Mein lieber kleiner Bruder, was hast du davon, daß du diesen ganzen Unsinn studiert hast, krank bist du davon, schon fast verrückt, eine traurige, komische Figur, hat sie am letzten Abend gesagt, um mich zu verletzen. Seit einem Jahr faselst du von Mendelssohn Bartholdy, wo ist dein Werk?, sagte sie. Du gehst nur mit Toten um, ich mit den Lebenden, das ist der Unterschied. In meiner Gesellschaft sind lebendige Menschen, in deiner nur Tote. Weil du vor den Lebendigen Angst hast, sagt sie, weil du nicht den geringsten Einsatz zu leisten gewillt bist, den Einsatz, der zu leisten ist, wenn der Mensch mit lebendigen Menschen umgehen will. Du sitzt hier in deinem Haus, das nichts anderes als eine Gruft ist und pflegst den Umgang mit den Toten, mit Mutter und Vater und unserer unglücklichen Schwester und mit allen deinen sogenannten Geistesgrößen! Es ist erschreckend! Tatsächlich hat sie recht, denke ich jetzt, sie sagt die Wahrheit. Mit der Zeit habe ich mich vollkommen in dieser Gruft, die mein Haus ist, verrannt. Ich stehe in der Frühe in der Gruft auf und renne den ganzen Tag in der Gruft hin und her und lege mich spät in der Nacht schlafen in dieser Gruft. Dein Haus!, rief sie mir ins Gesicht, deine Gruft!