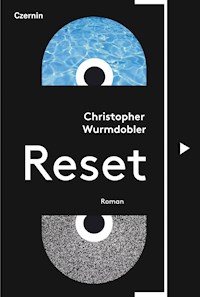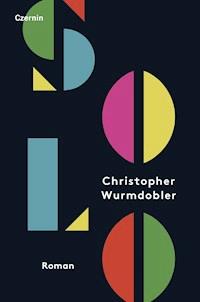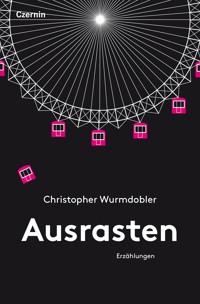
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Operettendiva, eine misanthrope Tierärztin, erfolglose Kunstschaffende, glücklos backende Mütter, schwule Tagediebe und allein reisende Neunjährige: Christopher Wurmdoblers Erzählungen versammeln außergewöhnliche Persönlichkeiten aus Wien, deren größte Gemeinsamkeit die Stadt ist, in der sie leben. Tamara fängt etwas mit Toni an. Toni hasst Weihnachten, mag jedoch mit Arnold zur Mitternachtsmette im Stephansdom gehen, weil "die Männer auf der Bühne lustige Kostüme tragen". Poldi verbindet Sex mit Immobilienbesichtigung, Susanne hasst Kunst, führt aber trotzdem eine Galerie. Kunsthistorikerin Ute berät Susanne fachlich und lässt sich von Tim modisch beraten. Tim verführt Darko und Darko wiederum den schwäbischen Lukas. Eva erwacht im Bett einer Sängerin und Beatrice sorgt dafür, dass überall der Strom ausgeht. In kurzen und weniger kurzen, aber immer unterhaltsamen Erzählungen nimmt Christopher Wurmdobler seine Leserinnen und Leser mit in das turbulente Leben seiner Figuren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHRISTOPHER WURMDOBLER
AUSRASTEN
Erzählungen
Christopher Wurmdobler
AUSRASTEN
Erzählungen
Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur
Wurmdobler, Christopher: Ausrasten / Christopher Wurmdobler
Wien: Czernin Verlag 2021
ISBN: 978-3-7076-0736-9
© 2021 Czernin Verlags GmbH, Wien
Lektorat: Alice Huth
Satz, Umschlaggestaltung: Mirjam Riepl
Autorenfoto: Julia Fuchs
Druck: GGP Media GmbH
ISBN Print: 978-3-7076-0736-9
ISBN E-Book: 978-3-7076-0737-6
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
And, oh my God, look you have just discovered
the way that one thing can lead to another
Yeah, oh yeah, oh yeah
It can lead to another
(PET SHOP BOYS)
Inhalt
Auf der Überholspur: Ein Showgirl
Leben für das Gute, Schöne: Zwei Kunstliebhaberinnen
Weiße Vögel, rostige Häuser: Eine Tierfreundin
Der Abfall der anderen: Ein Geschäftsmann
Muttis Barbershop: Eine Familie
Vierzigplus: Ein Mann mittleren Alters
Endstation Neuwaldegg: Zwei Liebende
Home, smart home: Eine Saunarunde
Hätte, hätte Lichterkette: Ein Festtagsmuffel
Daddy Issues: Ein jugendlicher Liebhaber
Wolle Monika: Eine Femme fatale
Angelo di Vienna: Eine Alleinreisende
Abends Fledermaus, tagsüber Sonnendeck: Eine Salondame
Der letzte Vorhang: Eine Charaktercharge
Containerliebe: Ein Riese
Gib dem Arschaffen Zucker: Ein Schriftsteller, sein Kritiker
Penisburger Hängung: Ein Bonvivant
Mama calling: Ein Naturbursche
Alles auf Anfang: Ein Fluggast
Auf der Überholspur
Ein Showgirl
»Ausnahmsweise …«, leicht genervt verschwand der Flugbegleiter in seinem Flugbegleiterkämmerchen und kam mit zwei in Plastikfolie eingeschweißten Mini-Sandwiches zurück. Wahrscheinlich waren es die Pausenbrote, die den Beschäftigten von der Airline zur Verfügung gestellt wurden. Jedenfalls war für die Fluggäste ganz bestimmt kein Sandwich vorgesehen. Nicht auf der Kurzstrecke und nicht bei dieser Fluggesellschaft. Auf Kurzstrecken bestand die Auswahl lediglich aus »süß« oder »salzig«. »Beides«, war Evis Antwort gewesen, als der niedliche Steward vorhin gefragt hatte, und sie hatte dazu noch zwei Sandwiches bestellt. Nun verschwanden eine Schokowaffel, ein Tütchen mit Knabbergebäck und eben die zwei Ausnahmsweise-Sandwiches, die traurigen Pausenbrote des Stewards, in ihrer Handtasche mit dem Animal-Print-Muster; man nimmt, was man bekommt. Ihr war nie etwas geschenkt worden, Evi hatte sich alles hart erarbeitet.
Reihe 28. Warum saß sie eigentlich so weit hinten? Vorne in der Business waren sicher noch Plätze frei. Sie hätte beim Einsteigen doch fragen sollen. Aber einen auf alt und gebrechlich zu machen, kam ihr auch mit Mitte Siebzig nicht in den Sinn. Gut, sie hätte die Promi-Karte spielen können. Evi ärgerte sich, dass sie es nicht getan hatte. Sie hätte sich auch einfach in die Business setzen können. Definitiv gehörte sie auf die andere Seite des grauen Vorhangs da vorne, den die Kabinenchefin kurz nach dem Start feierlich zugezogen hatte, damit in der Economy-Class niemand sah, dass bei Reich und Schön ausgelassen gefeiert wurde, morgens halb zehn über Deutschland. In den ersten zwei Reihen gab es sicherlich Häppchen vom Feinsten und Sprudel, wie es sich gehörte.
Der Flug von Frankfurt nach Wien würde zum Glück eh nur eine Stunde dauern. Der Flug würde nur eine Stunde dauern und die beiden Stewardessen, die für die Getränke zuständig waren, ließen sich unendlich viel Zeit. Evi war kurz davor, die Nerven zu verlieren. Hoffentlich würde sie hier hinten überhaupt noch rechtzeitig etwas zu trinken bekommen. Sie wollte nicht verdursten. Ein Getränk stand ihr zu, das hatte sie bezahlt. Oder diejenigen, die ihren Flug bezahlt hatten.
»Damen und Herren, wir haben bereits mit unserem Sinkflug begonnen.« Evi hörte die genuschelte Durchsage des Piloten und wurde ungeduldig. War ja klar. Sinkflug, Stinkflug. Die Stewardess, die sie gnädigerweise trotz der unmittelbar bevorstehenden Landung fragte, ob sie etwas trinken wollte, war allerdings weniger entgegenkommend als ihr Süß-oder-salzig-Kollege zuvor. Obwohl es noch vor Mittag war, wollte Evi jetzt eine Bloody Mary. Daytime-Drinking, das war Las Vegas in den Sechzigern, das war große weite Welt, das war über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, inklusive Tomatensaft mit Wodka. Dream on, kleine Evi.
»Wir haben gar keine Spirituosen an Bord«, log die Stewardess achselzuckend. Evi, die früher immer vorne gesessen war, wusste, dass es dort sehr wohl auch harte Getränke gab. Na gut, dann eben Tomatensaft pur. Evi machte einen Schmollmund und nahm den Plastikbecher mit dem roten Gesöff entgegen. »Das ist für Sie«, sagte sie betont gönnerhaft und drückte der überraschten Stewardess ein Autogramm in die Hand, als wäre es ein 100-Euro-Schein. Die ließ unauffällig das bunt bedruckte Stück Papier, das eine etwas jüngere Evi mit einem Cocker Spaniel zeigte, unten in ihrem Rollcontainer verschwinden.
Die kleine, etwas untersetzte Frau mit den Animal-Print-Klamotten und dem Animal-Print-Hütchen auf den schreiblond gefärbten Locken, die Frau mit viel zu viel Schminke im Gesicht, diese Frau, die offenbar nicht wusste, dass es in der Holzklasse ganz sicher keine Drinks, wer war die überhaupt, und für wen hielt die sich?
Evi ließ die Beine baumeln. Sie musste zu einem lächerlichen Fanclub-Treffen, vielleicht war es auch ein Interview, keine Ahnung, sie hatte vergessen, was ihr »Manager« da wieder ausgemacht hatte.
Gleich beim Start hatte sich Evi hinter der Bild-Zeitung versteckt, die sie vom Zeitungsständer in der Business-Class mitgenommen hatte – zusammen mit der Bunten, der Gala und einem Wirtschaftsmagazin, das ihr versehentlich in die Hände gefallen war. Aufgeschlagen war die Bild fast genauso groß wie sie im Sitzen. Evi las die Zeitung nicht, weil schon lange nichts mehr über sie drinstand. Die Bild war bloß eine Art Schutzschild, damit man sie nicht sah. Eine papierne Wand zwischen ihr und dem amerikanischen Touristenpaar, das auf den Plätzen neben ihr hockte. Aber die Amerikaner ignorierten sie ohnehin. Evi brauchte weder Wand noch Schutzschild, sie war schon vor einiger Zeit unsichtbar geworden. Jedenfalls wurde sie nicht mehr so häufig erkannt wie damals, als sie noch mit den drei Sisters und den vier Kötern auftrat.
Sie machten Schlager, Unterhaltungsmusik, Humptata und Tätärä, und glücklicherweise mochten es die Leute. Die vier Schwestern mit ihren vier aprikosenfarbenen Cocker Spaniels waren Publikumslieblinge. Vielleicht, weil sie genauso waren, wie das Publikum selbst. So dauergewellt normal. Wenn es darauf ankam, war Evi noch immer eine Stimmungskanone – darum hatte man sie ja vor ein paar Jahren auch ins Dschungelcamp geholt, zum perfekten Promi-Dinner sowieso und in unzählige Fernsehshows. Aber jetzt sah man sie einfach nicht mehr.
Unsichtbar zu sein hatte allerdings auch Vorteile. Schon bei der Sicherheitskontrolle heute Früh in Frankfurt hatte sie sich nicht an den irrsinnig komplizierten Warteschlangenweg gehalten, der mit Absperrbändern vorgegeben war. Hunderte Reisende warteten artig. Sie war einfach quer zum trägen Menschenstrom unter den Bändern durchgeschlüpft und zum Kontrollpunkt gelangt. Dazu musste sie nur ein bisschen in die Knie gehen. Die Wartenden waren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um Evis freches Vordrängeln überhaupt zu bemerken. Und wenn sie es bemerkten, waren sie zu müde, um sich aufzuregen.
Still und leise machte Evi sich ihre eigene Priority Lane. Okay, die drei Fläschchen Underberg wurden beim Sicherheitscheck entdeckt. Erst wollte sie die Magenbitter gleich vor den Augen des jungen Securitychecktypen exen, der sie erwischt hatte. Nachdem ein Flirtversuch aussichtslos schien – you are not in Vegas anymore – hatte sie die Fläschchen schließlich doch ungeöffnet in einen Abfalleimer geworfen. Lächelnd hatte sie dem Mann ihre Autogrammkarte überreicht. Der sah sie irritiert an. Auch später beim Boarding, als die Fluggäste mit Senator-Status, Kindern oder besonderen Bedürfnissen aufgerufen wurden, war sie einfach vor zum Schalter gegangen, hatte der Bodenpersonaltante ihren Boardingpass und eine Autogrammkarte hingehalten und sogar als Erste das Flugzeug betreten, um möglichst schnell Sitz Nummer 28A zu erreichen. Sie war eine bildzeitungsgroße Frau und hatte auch besondere Bedürfnisse.
Evi nippte an ihrem Tomatensaft, etwas, das sie sonst nie trank und das ihr überhaupt nicht schmeckte. Aber im Flugzeug Tomatensaft zu bestellen – noch besser natürlich mit einem Schuss Wodka – empfand sie wie die meisten Reisenden ihrer Generation als das Nonplusultra mondänen Jetsets. Warum musste sie heute nochmal nach Wien? Ach ja, jetzt fiel es ihr wieder ein: Sie war eingeladen, in einer Show aufzutreten, die ein Mit-Prominenter aus dem Dschungelcamp im Extrazimmer eines Wiener Hotels veranstaltete. Keine Fernsehshow, keine Kameras, nur wenig Publikum. Das Fernsehen wollte sie schon länger nicht mehr sehen. Was auf Gegenseitigkeit beruhte. Aber sie war und blieb ein altes Showpferd. Hatte sie genug Autogrammkarten dabei?
Wien wartete auf sie.
Die Chefstewardess gab über die Lautsprecher Kommandos: wieder anschnallen, Tischchen hochklappen, Fensterrollos öffnen, offenbar begann wirklich bereits der Sinkflug. Rasch stürzte Evi den restlichen Tomatensaft runter, erwog kurz, den leeren Becher ebenfalls in ihrer Animalprinttasche zu verstauen (vielleicht konnte sie den ja noch brauchen), gab ihn dann aber doch einer der Flugbegleiterinnen, die noch hektisch den Müll einsammelten.
Nach der Landung, man hatte längst offiziell »Servus und Auf Wiedersehen« gewünscht und einen schönen Tag in Wien oder eine sichere Weiterreise, dauerte es noch eine halbe Ewigkeit, bis Evi die Maschine endlich verlassen konnte. Wer zuerst einsteigt, steigt als Letzte aus, hatten ihre Schwestern immer gesagt. Wie recht sie hatten: Ursi, Grit und Hildegard waren vor Jahren gestorben. Als letztes Viertel vom Quartett war sie übrig geblieben, sie sang die alten Lieder, tanzte die alten Tanzschritte, warf ihre Beine – alleine.
Als sie das Flughafengebäude betrat, war Evi froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Beziehungsweise unter den Keilabsätzen ihrer goldenen Schuhe. Sie kannte sich nicht aus, wo musste sie jetzt hin, wo ging es nach Wien? Schließlich entdeckte sie ein paar Leute, die mit ihr im Flieger nach Wien gewesen waren. Obwohl sie Mühe mit dem Tempo hatte, rannte sie ihnen hinterher. Evi versuchte sogar, die Leute zu überholen, um als Erste ans Ziel zu gelangen. Sie überholte Warteschlangen, schlüpfte durch Absperrungen, zeigte ihre alte Autogrammkarte her wie einen Diplomatenpass und zwanzig Minuten später saß Evi an Bord der Mittagsmaschine nach Moskau; diesmal sogar auf der richtigen Seite des grauen Vorhangs in der Business Class.
In ihrem Eifer war sie in den Transferbereich gelangt, ohne es zu merken.
»Möchten Sie einen Drink?«, fragte ein niedlicher Steward und lächelte falsch.
»Ausnahmsweise«, sagte Evi und schloss die Augen.
(…)
Leben für das Gute, Schöne
Zwei Kunstliebhaberinnen
»Ich wüsste zum Beispiel nicht, wo ich einen Aschenbecher kaufen könnte.« Typisch Susanne, immer musste sie sich so inszenieren. Ute beobachtete ihre Freundin, wie sie gierig einen letzten Zug von ihrer Zigarette nahm, die große Glastüre aufstieß und ohne zu schauen, ob da vielleicht jemand war, die Kippe auf den Gehsteig vor der Galerie schnippte. Dort warteten ja eh schon eine Menge Tschickstummel darauf, weggekehrt zu werden. Die Perle würde das später machen; man müsste es ihr nur rechtzeitig sagen. Wie das roch! Ute schnappte sich eine Kunst-Illustrierte, die auf einem Plexiglastisch lag, sprang zur Tür und versuchte, mit dem Heft Frischluft in den Raum zu fächerln. Wobei sie vor Susannes Kopf herumwedelte, sodass deren zu einem Turm frisiertes feuerrotes Haar bebte.
Susanne schien ihr Gefuchtel kaum zu stören. »Weißt du, Liebes, ich bin schon sehr, sehr weltfremd. Wo würdest du einen Aschenbecher kaufen?«
Ute stand in der Türe, wedelte und blockierte dabei offenbar einen Bewegungsmelder, was im hinteren Teil der Galerie ein penetrantes Klingeln verursachte. »Keine Ahnung, wir rauchen ja nicht. Ich glaube, wir haben daheim überhaupt keinen Aschenbecher.«
»Siehst du! Und jetzt komm wieder rein, es wird ja kalt.« Regelmäßig besuchte Ute ihre Freundin in der Galerie; auch wenn es wie heute gerade keine Ausstellung zu besichtigen gab. Susanne hatte sie beim Studium kennengelernt. Kunstgeschichte. Obwohl sie unterschiedliche Laufbahnen eingeschlagen hatten, war es Ute gelungen, sie nie aus den Augen zu verlieren. Sie selbst war an der Uni geblieben, beschäftigte sich mit Gegenwartskunst, interessierte sich mit großer Leidenschaft für aktuelle Strömungen. Susanne interessierte vor allem der Kunstmarkt und vor allem jene, die in Kunst investierten. Ute gefiel das mondäne Leben ihrer Freundin als mächtigste Galeristin von Wien, und sie wusste, dass Susanne von ihrem wissenschaftlichen Know-how profitierte. Sie blieben Freundinnen; vielleicht, weil sie sich gegenseitig nichts vormachen mussten.
In Utes Gegenwart konnte Susanne so sein wie damals an der Uni, brauchte keine Rolle spielen. Allerdings hatte Ute feststellen müssen, dass sich mit den Jahren ein klitzekleines Ungleichgewicht eingeschlichen hatte zwischen ihnen beiden. Susanne war schon immer die Stärkere gewesen, aber inzwischen ließ sie es Ute auch spüren. Je erfolgreicher sie mit ihrer Galerie wurde, je mehr Einfluss sie im internationalen Kunstgeschäft gewann, umso ärger benahm sie sich Menschen gegenüber, die in ihren Augen eine Stufe tiefer standen. Für Susanne musste es einen Abstieg bedeutet haben, als Ute geheiratet und Kinder bekommen hatte. Sie selbst war ja mir ihrer Galerie verheiratet – und mit einem jungen Künstler, aber das hatte vor allem steuerliche Gründe. Denn der Herr war ausgesprochen hübsch und auch ausgesprochen schwul. Und selbstverständlich profitierte er von Susannes Netzwerk, ihre Beziehung war ein einziges Gegengeschäft. Und manchmal hatte Ute den Eindruck, dass Susanne mittlerweile auch sie eher als Geschäftspartnerin sah denn als Freundin.
»Die Kunst ist ein knallharter Markt«, pflegte die Galeristin zu sagen, und Ute half ihr mit ihrer Expertise auch noch bei der Wertsteigerung. Dafür wurde sie manchmal zu glanzvollen Abendessen eingeladen, zu Vernissagen mit schillernden Gästen. Wenn jemand kurzfristig abgesagt hatte, sprang sie spontan ein. Regelmäßig bekam sie von Susanne eine kleine Radierung oder eine Bleistiftzeichnung zugesteckt. »Für deine Rente«, sagte die Freundin in solchen Fällen zu ihr, vielleicht eine Spur gönnerhaft. Für Ute war das Lohn genug.
Sie war Adorantin, konnte ehrfürchtig vor noch so spröden Kunstinstallationen verweilen und staunen. Susanne hingegen redete schlecht über alle: Kunstschaffende, andere Galeristinnen und Galeristen sowieso. Waren sie beide gemeinsam bei der Konkurrenz oder in Ausstellungen unterwegs, konnte sie sich über bestimmte Arbeiten minutenlang aufs Derbste auskotzen, sodass Ute schon besorgt umherblickte, ob eh niemand zuhörte. Auch ihre eigenen Künstlerinnen und Künstler blieben von Susannes Urteil nicht verschont, und Ute hatte seit einiger Zeit das Gefühl, dass auch sie möglicherweise Ziel von Susannes galligem Spott war – in ihrer Abwesenheit.
»Perle«, rief Susanne nun in den hinteren Teil der Galerie, »mach uns doch zwei Gläschen.« Und Perle war schon unterwegs zum Kühlschrank. Wenig später brachte ihnen Perle – eine junge Frau, die bei Ute an der Fakultät studierte, sie hatte sie Susanne vermittelt, um in der Galerie ein paar Tage in der Woche auszuhelfen – zwei Gläser Champagner, den sie lässig Veuve Clic nannten.
Gerade hatten sie einander zugeprostet, da ertönte wieder das penetrante Klingeln, das Besuch ankündigte. In der Türe stand ein etwa vierzigjähriger Mann, Jeans, Lederjacke, eine rote Wollmütze tief ins bärtige Gesicht gezogen. Sogar Ute erkannte, dass das kein potenzieller Kunde war. »Sie wünschen?«, fragte Susanne und ihre Stimme klang schnippisch.
»Ich, äh, ich interessiere mich für die aktuelle Ausstellung.«
»Es ist leider gerade keine«, hob Ute eilfertig an, um sofort von Susanne unterbrochen zu werden.
»Gerne, sehen Sie sich nur um, junger Mann«, sagte die Galeristin und lächelte ihr aufgesetztes Galeristinnenlächeln. »Melden Sie sich einfach, wenn Sie Fragen haben.«
Utes Blick verfolgte den Mann, der leicht verunsichert durch die Ausstellungsräumlichkeiten schlich. Noch verunsicherter war allerdings Ute selbst. Denn schließlich gab es in der Galerie gerade wirklich nichts zu sehen. Es war der Zeitpunkt zwischen Finissage und Vernissage, die Wände waren weiß – und kunstlos, es wurde geputzt. Ute mochte dieses Zwischenstadium, die leere White Box, die bald wieder mit aufregenden Positionen befüllt wurde. Den Besucher mit der roten Mütze schien es nicht zu stören, dass hier offensichtlich gerade keine Kunstausstellung stattfand. Aufmerksam betrachtete er den Staubsauger, den die Perle hatte stehen lassen. Er verweilte vor einem Kübel mit Spachtelmasse, den der Maler später abholen wollte, und machte sich vor dem schwarz lackierten Heizkörper sogar Notizen in ein Büchlein. Ute sah ihre Freundin fragend an, lautlos formte sie mit den Lippen ein »Hä?«.
Schließlich hatte der Mann seinen kleinen Rundgang beendet. Er kehrte zu ihnen zurück und musterte Ute mit einem Gesichtsausdruck, als handle es sich bei ihr um eine Performancekünstlerin, die etwas fürchterlich Unalltägliches tat. »Sehr spannend, das hat Potenzial«, bemerkte er schließlich kennerhaft, nachdem er sich umständlich geräuspert hatte. »Gibt es denn auch einen Katalog?«
»Freilich«, erwiderte Susanne und wieder sah Ute sie mit ihrem Hä?-Gesicht an. Was war denn bloß in die Freundin gefahren? Extra langsam schlurfte die Galeristin nach hinten ins Büro, wo die Perle gerade damit beschäftigt war, Einladungen in Kuverts zu packen, und kehrte mit einem Stapel Druckerpapier zurück. Sie hielt dem Mann die leeren Blätter hin. »Haben Sie Kaufinteresse an einer der Arbeiten?«
Ute verstand die seltsame Scharade einfach nicht.
Der Typ deutete auf den Staubsauger. »Diese Installation da, was würde die denn kosten?«
Susanne tat so, als würde sie überlegen. Ute hätte wetten können, dass die Freundin jetzt für viel Geld den blöden Staubsauger verkaufen würde, da brachen Susanne und der Mann in schallendes Gelächter aus.
»Liebes, darf ich dir vorstellen, das ist mein alter Kumpel Morten, Theaterregisseur und demnächst auch bei mir unter Vertrag. Er macht irgendwas total Konzeptuelles.«
Ute lächelte verlegen. Dass man sie so hatte täuschen können. »Interessante Position«, sagte sie, um nicht komplett bescheuert dazustehen. Sie trat mit dem Fuß gegen den Staubsauger und lachte gekünstelt. »Für einen Moment habe ich dir echt zugetraut …«
»Fünfundzwanzigtausend Euro«, rief Susanne, und Morten zückte seine Brieftasche und tat so, als würde er nach der Kreditkarte suchen. Ute fühlte sich ganz schön verarscht. Wie stand sie jetzt vor diesem Morten da? Susanne hatte ihn noch nie erwähnt, wer war der überhaupt? Im Kopf ging sie sämtliche Künstler durch, die aktuell konzeptuelle Kunst machten.
»Ooooch, sei doch nicht so.« Gönnerhaft zwickte Susanne Ute in die Wange. Die Perle musste noch ein drittes Glas bringen und den Veuve Clic nachschenken. Später wurde sogar noch eine zweite Flasche »geköpft«, wie Morten es nannte. Ute fand, dass er sich hierbei unangenehm wichtigtat; vor allem, weil der Champagner Flecken und der Korken ein unschönes Loch in der Wand aus Gipskarton hinterließen. Von wegen White Box, dachte Ute, da würde der Maler nochmal drübergehen müssen vor der nächsten Hängung. »Ach, lassen wir das Loch doch gleich für meine Ausstellung«, schlug Morten vor und kippte noch ein bisschen Veuve Clic an die weiße Wand.
»Es ist spät, ich muss dann.« Ute fühlte sich ein bisschen ausgeschlossen. »Mein Großer feiert morgen Geburtstag und ich hab noch so viel vorzubereiten.« Susanne und ihr Gast waren so miteinander beschäftigt, sie bemerkten ihren Aufbruch erst, als Ute bereits im Mantel dastand, den sie bei der Perle hinten deponiert hatte.
»Schöner Mantel, Liebes.« Susanne lächelte. »Sieht fast aus wie Armani.«
»Das ist Armani«, freute sich Ute über das Kompliment zum Abschied.
»Kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich glaub, ich hab den längst in die Altkleidersammlung gegeben.« Als Ute schon fast außer Hörweite war, rief Susanne ihr noch hinterher: »Wird sicher mal wieder modern.«
Auf dem Weg zur U-Bahn fragte sie sich, ob sie mit dieser Frau wirklich befreundet war. Und wenn ja: weshalb?
(…)
Weiße Vögel, rostige Häuser
Eine Tierfreundin
Doktor Cosima Knab liebte Tiere sehr – und hasste Menschen. Wie andere allergisch auf Katzen reagierten, auf Pferde oder Kaninchen, litt sie unter Menschenallergie. Eigentlich litt sie nicht, weder reagierte ihr Körper mit Pusteln noch mit Augenbrennen, wenn sie Menschen begegnete. Aber Cosima Knab konnte Menschen einfach nicht ausstehen. Schon in der Schulzeit im Lycée français hatte sie andere Kinder grässlich gefunden. Grässlich und uninteressant. Das vornehme Wiener Bildungsinstitut war übrigens ihrer nicht weniger vornehmen Herkunft geschuldet, die Eltern wollten der Tochter die beste Erziehung angedeihen lassen. Die musikalisch wie naturwissenschaftlich Hochbegabte revanchierte sich mit sehr guten Noten und größtmöglichem Desinteresse, was ihr Umfeld betraf.
Obwohl sie schon damals wenig kommunikativ war, hatte sich Cosima im Lycée neben Wissen auch einen möglicherweise etwas affigen französischen Akzent antrainiert, den sie bis heute kultivierte. Wäre nicht diese Abneigung gegenüber allem Menschlichen gewesen, wer weiß, vielleicht wäre eine fantastische Chanson-Sängerin aus ihr geworden, eine Grande Dame der Gesellschaft. Aber da hätte sie ja zwangsläufig mit Publikum zu tun gehabt. Also hatte sie sich nach der Matura für die Wissenschaft entschieden und angetrieben von ihrer großen Liebe zu Tieren Veterinärmedizin studiert.
Chansons blieben Cosimas geheime Leidenschaft, wie die Liebe zu Foie gras. Gänse zu stopfen kam ja allein aus Tierschutzgründen eigentlich nicht infrage. Als Ausgleich engagierte sie sich im Expertinnenrat einer Tierschutz-Organisation, spendete regelmäßig größere Summen dem Schönbrunner Zoo und ernährte sich sonst streng vegan. Ehrlich. Tiere waren, im Gegensatz zu Menschen, niemals böse. Niemals würden Tiere sie enttäuschen.
Unangenehm war nur, dass der Kontakt mit einem Tier unweigerlich zum Kontakt mit Menschen führte. Gewissermaßen hing an jedem Tier ein Mensch.
Kurz nachdem sie die eigene Tierklinik in einer weniger schönen Gegend der Stadt – je hässlicher die Nachbarschaft, umso mehr Haustiere besaßen die Leute – kurz nachdem sie also ihre Praxis eröffnet und die ersten Auseinandersetzungen mit Halterinnen und Haltern durchgestanden hatte, kam Frau Doktor der Einfall mit der Praxis ohne Wartezimmer. Sie investierte noch einmal in einen kleinen Umbau: Wer seinen kranken Hund, die sieche Katze oder den lahmenden Kanari brachte, musste das Tier fortan in einer Art Schleuse lassen. Es gab eine Tierklappe aus rostfreiem Edelstahl, die so dimensioniert war, dass auch größere Hunde mühelos darin Platz fanden, Katzen in ihren Transportboxen sowieso. Alles lief wie bei der Kofferaufgabe an manchen sehr modernen Flughäfen – kontakt- und menschenlos.
Es gab Videokameras in der Schleuse, die Kommunikation mit dem medizinischen Personal funktionierte über eine Sprechanlage und in der Folge übers Mobiltelefon. »Gehen Sie einfach ins Gasthaus, ein paar Häuser weiter«, schlug