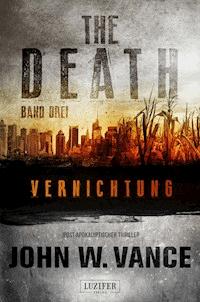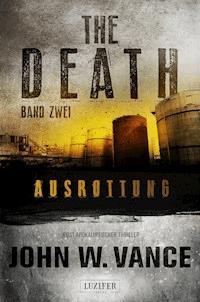
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Death
- Sprache: Deutsch
Es ist sieben Monate her, dass neunzig Prozent der Weltbevölkerung einer Pandemie erlagen, die DER TOD genannt wird. Chaos und Barbarei haben die Rechtsstaatlichkeit ersetzt und nur eine Regel gilt: Töte oder werde getötet. Devin, Tess und Brianna überlebten die Pandemie, doch können sie auch in dieser Welt überleben? Jeder neue Tag birgt Herausforderungen und Gefahren. Ihr Ziel ist es, einen sicheren Ort zu finden, und sie glauben, dass das dort ist, wo sich Tess' Verlobter befindet. Allerdings ist der Weg beschwerlich und es gibt keine Garantie. Nachdem sie nur knapp den Fängen von Kanzler Horton entkommen sind, haben Lori und Travis Zuflucht in einem alten Ranchhaus im Norden von Colorado gefunden. Lori weiß, ohne eine heilende Impfung könnte ihr Baby innerhalb weniger Tage nach der Geburt sterben. Ein Heilmittel existiert, aber nur an dem Ort, von dem sie gerade entkommen sind. ---------------------------------------------------------- "Sehr interessant, spannend, gefühlvoll und gruselig.. Einfach toll und fesselnd geschrieben..." [Lesermeinung] "Zweiter Teil der Trilogie und unfassbar spannend. Menschlich und gut geschrieben … Absolute Kaufempfehlung für alle Fans von Endzeitromanen!" [Lesermeinung] "Wer eine gepflegte Zombie-Unterhaltung sucht, kommt an den Werken von John W. Vance nicht vorbei." [Lesermeinung]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
The Death 2 - Ausrottung
John W. Vance
Copyright © 2014 by John W. Vance
All rights reserved. No part of this book may be used, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the written permission of the publisher, except where permitted by law, or in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews.
By arrangement with John W. Vance
Danksagungen
Nachdem ich viel auf der Welt herumgekommen bin, ist eines haften geblieben, nämlich dass sich ohne Gruppenarbeit nichts bewegt. Natürlich habe ich mir die Geschichte für dieses Buch ausgedacht und sie niedergeschrieben, doch dabei handelt es sich um viel mehr als die ursprünglichen Worte und einen Plot. Bevor es in eure Hände fiel, ging es durch die vieler anderer Personen. Diesen – teils Angehörigen und Freunden, teils bezahlten Fachleuten – möchte ich nun danken.
Zuallererst natürlich meiner Frau und meiner Familie; ihr haltet mir seit dem ersten Tag die Treue, unterstützt und ermutigt mich immer in allen Lebenslagen.
Ein weiteres Mal ziehe ich meinen Hut auch vor G. Michael Hopf. Du hast mir als Mentor zur Seite gestanden und mir in den Hintern getreten, damit ich meinen Traum wahr werden lassen konnte, Schriftsteller zu sein. Semper fidelis, wie die Marines zu sagen pflegen.
Danke dafür, Pauline, dass du mein Buch zu etwas Lesbarem gemacht hast.
Danke Roberto für das Originalcover; ich liebe es, und du bist ein echter Künstler.
John W. Vance
Impressum
Überarbeitete Ausgabe Originaltitel: ERADICATION Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Andreas Schiffmann
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-090-8
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Tag 14
Horton saß nachdenklich da und trommelte nervös mit den Fingern auf die Ledertasche auf seinem Schoß. Ein dünnes Rinnsal Schweiß lief an seiner pulsierenden Schläfe hinunter, als er einen Blick auf seine Uhr warf, wobei er hätte schwören können, dass sie nicht funktionierte, denn sie zeigte an, dass er erst zwanzig Minuten wartete, doch die kamen ihm bereits vor wie zwanzig Stunden. Dass er auf glühenden Kohlen saß, war offensichtlich, und allmählich befürchtete er, den Wachen würde sein merkwürdiges Benehmen auffallen.
Auf einmal vibrierte das Handy in seiner Jackentasche. Als er es herausnahm, sah er, dass die Nummer unterdrückt wurde. In der Annahme, es sei einer seiner Kollegen und weil ihm der Zeitpunkt äußerst ungelegen kam, drückte er den Anruf weg und steckte das Gerät wieder ein. Kurz darauf vibrierte es erneut; abermals nahm er es hervor und sah ›Teilnehmer unterdrückt‹. Verärgert über dieses vollkommen miserable Timing ging er schließlich doch an den Apparat. »Ja?«
»Brechen Sie ab, was auch immer Sie gerade tun. Das hier ist der Wahnsinn«, verlangte eine Stimme.
»Wer spricht da?«
»Bitte, wir können verhindern, dass das Ganze ausartet«, flehte der Unbekannte. »Bitte, um Gottes willen.«
Horton wurde beklommen zumute. Er konnte nicht sagen, mit wem er da gerade sprach, doch die Stimme klang irgendwie vertraut in seinen Ohren. Er schaute sich verstohlen nach den Wächtern um, ob diese hellhörig geworden waren. »Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber es ist zu spät!«
»Ich werde nicht zulassen, dass Sie diesen Völkermord zu Ende führen. Ich schwöre Ihnen, ich werde es verhindern, dass diese Vision von einer neuen Weltordnung Wirklichkeit wird.«
»Moment mal, sind Sie etwa Calvin?«, fragte Horton, der plötzlich erkannte, wer am anderen Ende der Leitung war.
»Bitte tun Sie es nicht. Wir könnten es gemeinsam verhindern«, fuhr Calvin fort. »Sie sind doch ein redlicher Mensch, oder?«
»Zu Ihrer Information: Sie haben sich einen denkbar schlechten Moment zum Anrufen ausgesucht, aber warum sagen Sie mir nicht, wo Sie sind, dann können wir uns später treffen?«
»Nein.«
»Calvin, es ist zu spät, doch falls Sie sich uns wieder anschließen möchten, würde ich mich mit den anderen darüber unterhalten.«
»Sie sind krank. Wirklich das sind Sie. Ich garantiere Ihnen, Ihr Traum von Arcadia wird nicht wahr werden.«
»Sir, keine Mobiltelefone, bitte stecken Sie es weg«, bat ein Wachmann weiter unten auf dem Flur.
Horton räusperte sich. »Äh, wissen Sie zufällig, wann …«
Genau in diesem Augenblick öffnete sich die Tür des Fahrstuhls auf dem Gang.
Hastig wischte er sich den Schweiß von der Stirn, stand auf und schlurfte über den kunstvoll gestalteten Flur zur breiten Aufzugskabine, die hinter dem Wächter aufgegangen war.
Kurz bevor er eintrat, hielt er inne und holte tief Luft.
»Direktor Horton, ist alles in Ordnung?«, wollte der Mann wissen, da ihm das Zögern seltsam vorkam.
Der Gefragte antwortete verlegen lächelnd: »Alles bestens.«
Aus der Ecke der Kabine trat ein zweiter Mann hervor, dessen Haltung und dunkler Anzug Horton zu erkennen gaben, dass er äußerst wichtig war. Er fragte: »Fühlen Sie sich vielleicht unwohl?«
»Mir geht es gut, ich bin nur nervös, das ist alles«, behauptete Horton weiter lächelnd.
Der Mann musterte ihn und erwiderte: »Sie haben den Impfstoff doch mitgebracht, oder nicht?«
»Ja, er ist gleich hier«, antwortete Horton und klopfte auf die dunkle Ledertasche, die an seiner Schulter hing.
»Gut, dann kommen Sie«, wies ihn der Mann an, während er dem Direktor bedeutete, er möge den Fahrstuhl betreten.
Horton kam der Aufforderung rasch nach und wandte sich dann direkt an den Mann: »Tut mir leid – sind einfach die Nerven. Man bekommt ja nicht alle Tage die Gelegenheit, den Präsidenten zu treffen.«
»Ich wünschte, Sie könnten es unter besseren Umständen tun«, entgegnete der Mann.
Die Fahrstuhltür ging zu.
Ein anderer Wächter, der ebenfalls in der Kabine stand, steckte einen Schlüssel in die Bedientafel, drehte ihn nach rechts und drückte auf eine Taste mit dem Buchstaben B.
»Steht B für Bombe?«, witzelte Horton unbeholfen.
»Nein, es bedeutet Bunker«, erklärte der Mann kühl.
Als sich Horton in der geräumigen Kabine umsah, stellte er fest, dass sie anders aussah, als er erwartet hatte. Irgendwie hatte er fest damit gerechnet, sie sei so prunkvoll verkleidet wie die Wände des Flurs oben, doch es handelte sich um einen einfachen und schmucklosen Kasten aus Edelstahl. Er spürte die Geschwindigkeit, mit der sie in die Tiefe fuhren.
»Tut mir leid, ich hätte mich vorstellen sollen. Mein Name ist Dan Bailey, ich bin der Stabschef.«
»Hi.«
»Mich wundert es, dass Sie dem Präsidenten noch nie begegnet sind«, meinte Bailey.
»Da ich unter der vorherigen Administration eingestellt wurde, bekam ich leider nie die Gelegenheit dazu.«
»Das ergibt Sinn. Ist ja nicht so, als handle es sich bei der Leitung der Seuchenschutzbehörde um einen politischen Posten.«
Horton lachte auf und entgegnete: »Sie haben recht, ich bin nicht sonderlich politisch. Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wann ich zuletzt gewählt habe.«
Dan schaute ihn mit zur Seite geneigtem Kopf an. Als Horton bemerkte, dass er taxiert wurde, schaute er hastig weg.
»Es ist erstaunlich, dass es bereits einen Impfstoff für dieses Virus gibt«, meinte Bailey.
»Wie gesagt, es künstlich herzustellen war relativ leicht. Wir nahmen die Indexpatientin sofort in Verwahrung und haben es durch sie geschafft, dieses Mittel zu gewinnen.«
Der Fahrstuhl blieb abrupt stehen, und als sich die Tür öffnete, erstreckte sich dahinter ein weiterer Flur. Dieser machte einen anderen Eindruck als der obere, denn er war nichts weiter als ein gut ausgeleuchteter Betonschacht.
»Gleich hier entlang«, sagte Dan, als er aus dem Fahrstuhl trat. Er ging zügig auf eine breite Metalltür zu, an der zwei bewaffnete Wachen standen.
Horton folgte ihm.
»Gentlemen, Sie kennen mich. Das ist Direktor Horton vom Seuchenschutzministerium auf Geheiß des Präsidenten.«
Einem Piepton folgten ein Klicken und schließlich ein Zischen, als die Tür entsichert wurde und sich zu öffnen begann.
Als sie ganz offen stand, sah Horton eine Wand und zwei weitere Wachen.
Dan ging wieder vor und er folgte einfach.
Die schwere Tür schloss sich hinter ihm, klickte dann und piepte erneut.
»Der Präsident erwartet Sie in seinem Amtszimmer«, fuhr Dan fort, ehe er links in einen Gang abbog, der beschaulicher wirkte und an jene im Weißen Haus über ihnen erinnerte.
Horton nickte den gleichmütigen, wie Statuen dastehenden Wächtern zu und heftete sich wieder an Baileys Fersen.
Nachdem sie ein wahres Geflecht von Korridoren hinter sich gebracht hatten, blieben sie vor einer weiteren breiten Metalltür stehen, die sich durch nichts hervortat, außer dass abermals zwei Männer sie bewachten.
»Geben Sie dem Präsidenten Bescheid, dass der Leiter des Seuchenschutzes eingetroffen ist«, befahl Dan.
Einer der Wächter betätigte einen Knopf und sprach in ein Kehlkopfmikrofon. Nach einem kurzen Moment klickte auch diese Tür und öffnete sich weit.
»Madam Secretary«, grüßte der Stabschef.
»Hi, Dan, er ist sofort für Sie da«, erwiderte Staatssekretärin Donna Crawford.
Während sich der Direktor im Raum umsah, stellte er beeindruckt die Bequemlichkeiten fest, auf die der Präsident selbst in seinem Bunker nicht verzichten musste. Sie hielten sich in einer Art Wohnzimmer auf, das mit lederbezogenen Polstermöbeln und dickem, weichem Teppichboden eingerichtet war. Die Wände hatte man mit dunklem Mahagoni vertäfelt, und im Abstand von jeweils sechs Fuß hingen schwere Messingleuchter. In der hinteren rechten Ecke gab es eine bestens bestückte Minibar, und ihr gegenüber stand ein breiter, quadratischer Tisch, auf dessen polierter Platte Papiere lagen. Davor stand das Staatsoberhaupt und brütete vor sich hin.
Präsident Brown, ein großer, hagerer Mann mit dichten Locken, blickte auf und sagte: »Direktor Horton, genau der Mann, auf den wir gewartet haben. Bitte treten Sie näher.«
Horton lächelte und eilte mit ausgestreckter Hand zu ihm.
Brown schaute auf selbige hinab und fragte: »Soll das ein Test sein?«
Der Direktor zog die Augenbrauen hoch, bevor er verstand, was die Bemerkung bedeutete. »Ja, korrekt.«
»Ich glaube, das gehörte zu Ihrem Regelwerk: Kein Händeschütteln!«, fügte Brown hinzu.
»Richtig, Sir, das stimmt.«
»Haben Sie es bei sich?«
»Gleich hier, Sir«, antwortete Horton und klopfte abermals auf seine Tasche.
Brown krempelte rasch einen Ärmel hoch und nahm Platz.
Bailey trat vor und wandte ein: »Also sind Sie hundertprozentig sicher, dass es ihm nicht schaden wird?«
Horton riss die Augen so weit auf, dass sie doppelt so groß wirkten wie zuvor, während er Brown anstarrte, dessen Stabschef seiner Begeisterung gerade einen Dämpfer verpasst hatte.
»Direktor Horton, haben Sie zugehört?«, hakte Dan nach.
»Ja. Wir haben den Impfstoff getestet. Er wirkt.«
»An Menschen getestet?«, fragte Brown.
»Natürlich, Sir. Laut Ihren Befehlen haben wir es gleich nach der Herstellung Testpersonen verabreicht«, entgegnete Horton. Er hatte die Tasche auf den Tisch gelegt und aufgeklappt. »Ich habe es mir sogar selbst injiziert.« Das war gelogen.
»Ihnen ist doch hoffentlich klar, dass das nie ans Licht der Öffentlichkeit …«
»Selbstverständlich, Sir«, versicherte Horton, während er den Präsidenten abwürgte, denn seine Aufmerksamkeit galt nun einzig und allein einem kleinen, versiegelten Kästchen.
»Ich bin bereit«, entgegnete Brown und streckte ihm den Arm entgegen, um sich impfen zu lassen.
Horton nahm eine Spritze aus ihrer sterilen Verpackung und steckte die Nadel in eine Ampulle. Während er den Kolben hochzog, beobachtete er, wie sich der Zylinder füllte. Dann legte er die Spritze nieder, nahm einen mit Alkohol getränkten Tupfer zur Hand und rieb die Stelle am Arm ab, an der er ansetzen wollte. Als er damit fertig war, griff er wieder zur Spritze und trat auf Brown zu. Er nahm dessen Arm, hielt jedoch kurz inne, als er zustechen wollte. Dies war ein höchst bedeutsamer Moment, er würde weitreichende Folgen nach sich ziehen und Phase zwei seines gemeinsamen Plans mit dem Rat abschließen.
Brown suchte Hortons Blick und fragte: »Direktor, alles in Ordnung?«
»Absolut, Sir, wirklich bestens«, beteuerte er, stach zu und drückte den Kolben nieder.
»Wie lange dauert es Ihrer Einschätzung nach, bis wir zur Massenproduktion übergehen können?«, fragte Bailey auf dem Weg zurück zum Fahrstuhl.
»Wir können innerhalb weniger Wochen beginnen«, heuchelte Horton.
»Gut.«
»Aber behalten Sie den Präsidenten und alle anderen hier unten in Quarantäne«, bat Horton. »Ich empfehle Ihnen, sonst niemandem mehr Einlass zu gewähren, nachdem ich aufgebrochen bin, bis wir die Produktion in die Wege geleitet haben und das Serum verteilen können.«
Die Fahrstuhltür öffnete sich.
Bailey streckte seine Rechte aus. »Vielen Dank für Ihre harte Arbeit und Hingabe.«
Horton schaute auf die Hand, zögerte aber nicht, sie zu schütteln. Er packte sie fest und erwiderte: »War mir ein Vergnügen.« Dann betrat er den Aufzug und schaute zu, wie sich die Tür schloss.
Kurz bevor sie endgültig zuging, schob sich ein Arm in den Spalt und hielt sie auf. Als sie sich wieder öffnete, stand Dan noch immer da. »Fast vergessen. Kurz nachdem Sie das Zimmer verlassen hatten, wies der Präsident an, dass sie seinen Vize ebenfalls impfen sollen. Das können Sie doch, oder?«
»Selbstverständlich kann ich das. Ich habe für den Fall, dass der Präsident seine Meinung ändert, noch mehr mitgebracht«, erwiderte Horton mit breitem Grinsen.
»Guter Mann, noch einmal Dankeschön, Direktor, wir sehen uns bald wieder.«
Tag 209
Rückblickend kam Tess die lange, grauenvolle Fahrt von Reed, Illinois aus wie der leichteste Teil ihrer beschwerlichen Heimreise vor. Sie stand jetzt schon seit zehn Minuten reglos in der Auffahrt ihres alten Hauses und ließ die Augen nicht von der verwitterten Fassade, deren blaue Farbe abblätterte. Dass es schon nach wenig mehr als sieben Monaten so verwahrlost aussah, fand sie seltsam. Vielleicht lag es am hohen Gras und dem Unkraut zusammen mit dem Müll und Schutt überall auf der Straße, dass ihr Heim plötzlich den Eindruck einer Bruchbude vermittelte. Eine Angst, die ungewöhnlich für sie war, nahm sie mittlerweile voll und ganz in Beschlag. Die Antwort auf alles, was sie sich im Laufe der vergangenen Monate gefragt hatte, wartete drinnen auf sie, doch war sie auch bereit, sie zu finden?
Brianna saß im Humvee. Sie starrte auf Tess’ Rücken, ohne den Blick abzuwenden. Sie wäre gern ausgestiegen, um sich zu vergewissern, ob alles okay war, wusste jedoch insgeheim, warum sie sich nicht rühren konnte.
Tess’ Wunsch zum Trotz war Devin losgegangen, um die Straße und Umgebung des Hauses zu überprüfen, falls Gefahr drohte. Bei seiner Rückkehr traf er sie an genau der Stelle an, wo sie auch gestanden hatte, bevor er verschwunden war. Er ging auf sie zu, aber sie hob eine Hand, um ihm zu verstehen zu geben, er solle sich nicht weiter nähern.
Devin gehorchte sofort und schaute besorgt zu Brianna hinüber, die nur mit den Achseln zuckte. Er erwog kurz, Tess’ Anweisung einfach zu ignorieren, wusste aber, dass er ihren Zorn auf sich ziehen würde, falls er es tatsächlich tat. Stattdessen rief er laut: »Hinten ist die Luft rein. Hab niemanden gesehen, allerdings ist jemand eingebrochen. Hübsches Haus übrigens.«
»Tess, das reicht jetzt«, murmelte sie bei sich. »Geh rein und finde heraus, wo dein Mann steckt.«
Plötzlich fiel Brianna eine schnelle Bewegung auf. Im Haus auf der anderen Straßenseite wackelte ein Fensterladen, und wie es aussah, zog ein Schatten vorbei.
Ihr Wagen stand im rechten Winkel zu den Gebäuden mitten auf der Straße.
Sie lehnte sich über die Mittelkonsole, um durch das Türfenster auf das Haus zu schauen; nichts, keine Bewegung mehr, doch das bedeutete nicht, dass dort niemand war. Jetzt war sie ebenfalls beunruhigt und rief: »Devin, ich glaube, ich habe etwas im Haus gegenüber gesehen – Nummer 17!«
Daraufhin stürzte er mit seinem Gewehr im Anschlag zum Humvee und starrte nun ebenfalls gebannt auf die Häuserfront.
Als Tess das bemerkte, bewegte sie sich endlich. Sie drehte sich um und blickte auch zu dem Haus hinüber, das Brianna meinte. Nach kurzer Überlegung fiel ihr wieder ein, wer dort wohnte: Mr. Phil Banner aus New York und seine Frau, die den Winter gemeinsam im Süden des Landes verbracht hatten. Dass er überlebt und sich gegen all das Geschehene behauptet hatte, war nicht auszuschließen.
»Dort lebt Mr. Banner, er ist harmlos«, erklärte Tess.
Devin drehte seinen Kopf betont langsam zu ihr und erwiderte: »Harmlos? Niemand ist mehr harmlos.«
»Ich bin gleich zurück«, sagte sie und machte nun einen ersten Schritt auf ihr altes Zuhause zu.
Der Salzgeruch des Atlantiks stieg ihr in die Nase und weckte sofort schöne Erinnerungen an ihre gemeinsamen Tage mit Travis. Als sei es gestern gewesen, entsann sie sich des ersten Mals, als sie das Haus gesehen hatte. Sie war von Travis mit dem Kauf des Anwesens überrascht worden, weshalb er ihr sogar die Augen verbunden hatte, damit sie nicht erfuhr, wo es sich befand. Sie musste ein wenig schmunzeln, als sie an diesen besonderen Moment zurückdachte, in dem sie in Wirklichkeit sehr wohl gewusst hatte, wohin er sie bringen würde.
Wird ein Sinn plötzlich blockiert, schärfen sich automatisch die anderen. Sie hatte die Trägerbrücke, die auf die Insel führte, anhand des Fahrgeräuschs erkannt, und dass sie in Ozeannähe gewesen waren, hatten ihr die Möwen verraten. Deren Geräusche blieben nunmehr aus, doch die alte Überführung existierte noch. Als er damals in der Einfahrt geparkt hatte und aufgeregt ausgestiegen war, um die Beifahrertür zu öffnen, hatte ihr Gehör, aber auch ihre Nase darauf hingedeutet: Der intensive Salzgeruch war ihr entgegengeweht und das Rauschen der Brandung hatte es endgültig besiegelt. Bevor er mit ihr zur Tür gelangt war, hatte sie aufgeregt gerufen: »Topsail Beach; du hast uns ein Haus am Topsail Beach gekauft!«
Sie erreichte nun die Treppe und schaute die abgewetzten Holzstufen hinauf, die zum Eingang führten. Wie die meisten Wohnhäuser auf Topsail Island stand es hoch über der Erde auf Pfählen. Optisch war das zwar nie ihr Geschmack gewesen, doch sie hatte darüber hinweggesehen, weil sie dieses Fleckchen ihr Eigen nennen durfte.
Nachdem sie die erste Stufe erreicht hatte, ließ sie noch einen Moment verstreichen. Sie blinzelte bemüht, schaute wieder nach oben und sagte leise zu sich selbst: »Tess, genug jetzt. Deine Freunde warten, also geh.« Dies war der letzte Ansporn, den sie benötigte. Sie wusste, sie zögerte dies alles hinaus, und je länger sie dies tat, desto angreifbarer waren sie. Mit neu entdeckter Zuversicht erklomm sie die Stufen und näherte sich dem Eingang. Das Fliegengitter war zerrissen, und die Tür dahinter stand weit auf. Jemand hatte ein großes X mit einer Null darüber darauf gemalt. Während Tess es anschaute, fragte sie sich, was es bedeuten mochte, verdrängte den Gedanken aber sofort wieder. Vielmehr interessierte sie, wie lange die Tür schon offenstand. Am Zustand des Wohnzimmers erkannte sie augenblicklich, dass die Räume schon seit Monaten frei zugänglich und den Elementen ausgesetzt gewesen waren.
Der Anblick ihrer von der Natur und Fremden zerstörten Wohnung machte sie nicht wütend, sondern lediglich traurig, weil der einzige Ort, der für sie stets Glück und Liebe symbolisiert hatte, nun hinfällig und unwiederbringlich verloren war. Ihr blieben zwar noch die Erinnerungen, doch dies bedeutete gleichzeitig, dass ihr altes Leben nun endgültig zu Ende war. Ihr verwüstetes Eigenheim verdeutlichte greifbar und anschaulich, was aus der Welt geworden war.
Nachdem sie die Glock 17 aus ihrem Schulterhalfter gezogen hatte, öffnete sie das Gitter. Durch die breiten Panoramafenster zum Strand und dem dahinterliegenden Meer hin fiel genügend Licht ein, um alles deutlich zu erkennen. Das Knirschen von Glassplittern bei ihren ersten Schritten im Haus drang an ihr Ohr, außerdem nahm sie einen unangenehmen und starken Modergeruch wahr. Sie ging noch ein Stück weiter und blieb dann stehen; zu vorsichtig konnte man heutzutage gar nicht sein. Auch wenn anscheinend monatelang niemand hier gewesen war, wusste sie nach etwas mehr als vier Wochen auf der Straße, dass man niemals ein Risiko eingehen durfte. Also achtete sie darauf, ruhig zu atmen, und schritt langsam voran. Sie ging die Zimmer nacheinander ab, gelangte dabei jedoch nur zu der Erkenntnis, dass jemand alles aus dem Haus gestohlen hatte, was ihm irgendwie wertvoll vorgekommen war. Als sie das Ausmaß des Durcheinanders sah, befürchtete sie, dass sie Travis' Nachricht nicht finden würde. Er hatte nichts weiter gesagt, als dass er sie an einem sicheren Platz hinterlegt hatte, doch wo war dieser genau? Einer, auf den sie spekuliert hatte, war der am Fußboden verschraubte Tresor, doch der stand nicht mehr dort und ein quadratisches Loch klaffte an seiner Stelle. Ihre Gedanken schlugen Purzelbäume, und sie hastete von einem mutmaßlichen Fleck zum anderen, doch jede Idee erwies sich als Trugschluss. Als ihr nichts mehr einfiel, sackte sie erschöpft und verärgert auf den Boden.
Während sie dasaß und die ringsum verstreuten Scherben dessen betrachtete, was einst ihr Leben gewesen war, grübelte sie verbissen darüber nach, wo er den Zettel hinterlassen haben konnte. Sie hatte die Fotoalben durchgeblättert, die Bibel und seine Lieblingsromane; sie hatte jede Schublade in jedem Zimmer durchsucht, doch da war nichts. Wo war er nur? Gab es überhaupt eine Nachricht?
Sie wusste nicht, wie lange sie schon auf dem Boden hockte, als ein Klopfen an der Tür sie aus ihren Überlegungen riss.
»Tess, ich bin’s, Devin. Geht es dir gut?« Als er in der offenen Tür stand, wirkten seine Umrisse größer, als er in Wirklichkeit war.
»Ja, schon«, antwortete sie. »Komm rein.«
Er betrat den Raum und schaute sich um. »Also, an deiner Stelle würde ich ja in Erwägung ziehen, hier mal aufzuräumen.« Er feixte.
»Hier ist nichts!«
»Du kannst die Nachricht nicht finden?«
»Nein, gar nichts. Ich habe ewig lange gesucht, aber nichts von ihm entdeckt, das wie ein Hinweis aussieht und mir irgendetwas sagen könnte.« Sie klang zutiefst frustriert.
»Na ja, dass das Licht kaputt ist, hilft auch nicht unbedingt beim Suchen«, meinte er, während er den Schalter abwechselnd nach oben und unten drückte.
Sie schaute ihm zu, bis er damit aufhörte und in die Wohnung kam. Dabei trat er achtlos Gerümpel aus dem Weg, bei dem es sich einmal um ihre geschätzten Habseligkeiten gehandelt hatte. Als er in die angrenzende Küche schaute, musste er plötzlich lachen.
»Was findest du denn so lustig?«, fragte Tess verwirrt.
»Hattest du mal einen Kühlschrank und eine Spülmaschine, oder ist …«
Sie unterbrach ihn: »Natürlich hat irgendein Arschloch geglaubt, etwas damit anfangen zu können.«
»Ha, was für ein Trottel.«
»Na ja, jeden Tag steht ein Idiot auf«, entgegnete sie, erhob und streckte sich. »Wie geht es Bri?«
»Gut. Dein Nachbar hat sich nicht mehr bemerkbar gemacht. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob da wirklich etwas gewesen ist, aber falls doch, haben Brando und sie das draußen im Griff. Deshalb dachte ich mir: Schau mal rein, vielleicht kannst du dich nützlich machen.«
»Wie spät ist es?«, fragte Tess.
»Es ist bereits Nachmittag, du bist schon eine ganze Weile hier drin«, meinte er. »Wir haben uns langsam Sorgen um dich gemacht.« Er ging hinüber und legte eine Hand auf ihre Schulter. Die Anspannung stand ihr ins Gesicht geschrieben, und die Hoffnungslosigkeit, die sie empfand, strömte geradezu aus ihr heraus.
»Jemand mit einem frischen und unvoreingenommen Blick hilft bestimmt«, sagte sie nachdenklich. »Warum übernimmst du nicht das Arbeitszimmer? Es ist die erste Tür links.«
»Kein Problem.« Er verschwand in dem besagten Raum und wollte dort instinktiv das Licht anknipsen, doch nichts geschah. Als er auf den breiten Schalter schaute, sah er, dass dieser herzförmig war. »Ich muss schon sagen, dieses Büro kannst auch nur du eingerichtet haben.«
Tess stöberte wieder im Schlafzimmer. Sie kroch nun auf allen vieren herum und hob jeden Papierschnipsel auf. »Warum glaubst du das?«
»Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein starker hartgesottener Marine ein Herz als Lichtschalter an die Wand montiert hat.«
Als sie das hörte, stürzte sie aus dem Zimmer zum Büro und blieb im Türrahmen stehen. Sie schaute auf den stilisierten Schalter und rief: »Das ist es! Er hat die Nachricht dahinter versteckt, ganz sicher.«
»Hinter dem Lichtschalter?«
»Ja.« Sie suchte auf dem Schreibtisch nach einem Werkzeug zum Abschrauben. »Hilf mir, wir müssen etwas finden, mit dem wir das Ding von der Wand bekommen.«
»Ernsthaft, du meinst, er hat sie dort versteckt?«
»Gut möglich; es wäre nicht das erste Mal. Niemand schaut an solchen Stellen nach, und diesen Schalter habe ich Travis zu unserem ersten Jahrestag geschenkt.«
Devin brauchte nicht zu suchen, er nahm einfach sein Schweizer Taschenmesser hervor und klappte den Flachkopfschraubendreher auf. Als er ihn Tess gab, fragte er: »Du hast deinem Mann – einem Marine – einen herzförmigen Lichtschalter geschenkt? Das findet selbst meine metrosexuelle Seite tuntig.«
»Halt die Klappe, das war etwas Persönliches. Dahinter steckte eine Vorgeschichte«, blaffte sie ihn an und schnappte sich das Werkzeug aus seiner Hand.
»Davon bin ich überzeugt. Hatte diese Vorgeschichte auch was mit Rollenspielen und Kopfmasken mit Reißverschluss zu tun?«
Sie knurrte ihn an, ohne sich die Mühe zu machen, auf seinen Hohn einzugehen. Schnell löste sie die Verkleidung und nahm sie ab. Als sie hinter den Kippschalter schaute, entdeckte sie ein gefaltetes Stück Papier. »Da ist etwas!«, rief sie aufgeregt.
»Und ich dachte, ich hätte schon alles erlebt, aber das ist ja unglaublich«, meinte Devin.
Ihre Hände zitterten, während sie auch den Mechanismus abschraubte. Ein kräftiger Ruck, dann hatte sie ihn abgerissen und warf ihn achtlos beiseite. Mit der anderen Hand fummelte sie das zusammengefaltete Papier heraus. Einen Moment lang schaute sie es sich an, bevor sie es öffnete. Mit jeder Falz, die sie aufschlug, wurde ersichtlicher, dass die ominöse Botschaft gar keine war, sondern eine Karte.
Devin blickte über Tess’ Schulter. Beide waren extrem gespannt, und in gewisser Weise fühlte er sich an Weihnachten erinnert.
Als sie das Papier komplett aufgefaltet hatte, stellte es sich als Karte von Colorado heraus, und die einzige Markierung darauf war ein Kreis um eine Fläche neben drei handgeschriebenen Buchstaben: DIA.
»Was bedeutet das?«, fragte Devin. »Ist er an einem Flughafen?«
»Ja, wenn mich nicht alles täuscht, steht die Abkürzung DIA für Denver …«
»… International Airport«, fuhr er dazwischen und führte ihren Gedanken zu Ende.
Dann schauten sich die beiden verwirrt an.
Devin trat zurück und fuhr sich mit einer Hand durchs Haar, bevor er sich ihr wieder zuwandte. »Bist du sicher, dass das die ganze Nachricht ist?«
Sie gab ihm mit einem Blick zu verstehen, dass dies so war, antwortete aber: »Travis war sehr vorsichtig, er muss sich Sorgen gemacht haben. Am Telefon wollte er es mir aus welchen Gründen auch immer nicht sagen, und indem er es hier versteckte, gab er mir zu verstehen, dass er wusste, dass etwas Schlimmes passieren würde.«
»Muss ich derjenige sein, der das Offensichtliche ausspricht?«
»Was meinst du?«
»Wüsste ich, dass das Ende der Welt bevorsteht, würde ich dir einfach sagen, wohin ich verschwinde. Ich meine, diese ganze Sache, dieser ganze Trip ist doch totaler Unsinn, wenn du mich fragst.«
»Travis hatte bestimmt einen guten Grund dafür. Er wusste, dass er am Telefon nicht vertraulich mit mir reden konnte. Vielleicht fürchtete er um sein Leben, vielleicht …«
»Dennoch hat er dein Leben gefährdet. Er hätte dir auch einen besseren Hinweis als diesen geben können. Hättest du beim Verlassen von Norddakota gewusst, wo er steckt, wärst du jetzt dort. Das ist – entschuldige, wenn ich das so sage – selten dämlich.«
Tess warf ihm einen strengen Blick zu. »Er hatte einen guten Grund dafür, anders kann es nicht sein!« Sie hasste es, Travis in Schutz nehmen zu müssen, tat es aber automatisch. Seit dem Zusammenbruch war kein Tag vergangen, an dem sie sich nicht die gleiche Frage gestellt hatte, doch dass Devin es nun tat, machte einen Unterschied. Er kannte Travis nicht, deshalb war es für ihn ein Leichtes, ihren Mann zu verurteilen. Seitdem sie Daryls Haus verlassen hatten, waren Tess’ Meinungsverschiedenheiten mit Devin immer häufiger und heftiger geworden, was das Reisen in mancher Hinsicht anstrengend hatte werden lassen.
Jetzt öffnete Devin seinen Mund, schwieg dann aber doch. Ihm war klar, dass egal was er sagen würde, es nichts brachte, sondern lediglich Öl ins Feuer gießen würde. Unabhängig davon, wie dämlich oder unnötig es war, die Botschaft dort zu hinterlassen, hatten sie nun endlich eine Spur, der sie folgen konnten, und eine sehr lange Reise vor sich.
Während Tess die Karte betrachtete, fuhr sie mit ihren Fingern darüber. Dann hielt sie sich das Papier an die Brust und schloss die Augen.
Devin streckte eine Hand nach ihr aus. Er fühlte sich mies und wollte sich entschuldigen, doch ein Schrei von Brianna hielt ihn von seinem Eingeständnis ab.
Tess steckte die Karte hastig in eine ihrer Taschen, zog die Glock und stürmte zur Tür hinaus. Devin war dicht hinter ihr, das AR-15 schussbereit. Als sie das Haus verließen, konnten sie sehen, was gerade geschah: Brianna wurde von einem halben Dutzend kleiner Jungen umzingelt.
Diese wirkten zunächst harmlos – schließlich waren es noch Kinder –, doch nachdem sie die Eingangstreppe hinuntergelaufen waren, eilten die beiden trotzdem auf Brianna zu, die mit einer Pistole in der Hand neben dem Hummer stand, und erkannten nun, dass die Kinder mitnichten ungefährlich waren.
Fleckige, zerschlissene Kleidung klebte an ihren verhärmten Körpern, ihre eingefallenen Gesichter waren dreckig und in ihren knochigen Händen hielten sie Schläger oder Rohrstücke, mehrere von ihnen sogar Feuerwaffen. Sie verhöhnten Brianna, deren Gesichtsausdruck deutliche Furcht erkennen ließ.
»Hilfe! Devin, Tess, Hilfe!«, schrie sie erneut, weil sie nicht sah, dass die beiden bereits unterwegs zu ihr waren.
»Bri, wir sind gleich bei dir!«, rief Tess zurück.
Die Kinder, die nicht damit gerechnet hatten, dass die Frau Verstärkung bekam, schauten nun hoch und erkannten, dass Tess und Devin näherkamen.
Die Hälfte von ihnen drehte sich um und stellte sich ihnen entgegen. Zwei hielten je einen Revolver in der Hand, der dritte hatte einen Colt M1911.
»Wartet, Jungs. Nehmt die Waffen herunter. Das ist doch nicht nötig«, rief Devin mit erhobenem Gewehr.
»Hört zu, egal was ihr euch vorgestellt habt: Es wird nicht passieren. Solltet ihr etwas zu essen suchen, können wir euch gern helfen«, ergänzte Tess. Sie hielt ihre Pistole mit dem Lauf nach unten, um zu zeigen, dass sie nichts Böses im Schilde führte.
Devin schaute kurz zu ihr hinüber und fragte: »Tess, was soll das? Wir wissen nicht, wer sie sind und wozu sie vielleicht imstande wären.«
Ohne seinen Blick zu erwidern, entgegnete sie: »Das sind bloß Kids.«
»Hast du dir da drin etwa den Kopf gestoßen?«, fragte er spöttisch.
»Ihr seht hungrig aus. Wir haben Lebensmittel, von denen wir euch etwas abgeben können, okay?«, sagte sie.
Brando stand nun neben Brianna. Sein Bein war infolge der Schusswunde noch bandagiert, die er sich einige Wochen zuvor bei Daryl in Reed im Bundesstaat Illinois zugezogen hatte, sein Kampfgeist war aber mehr oder weniger ungebrochen. Er sträubte sein Fell und knurrte die Jungen böse an.
Diese begannen, Tess auszulachen, wobei sich derjenige mit dem Revolver derart verausgabte, dass er fast keine Luft mehr bekam.
Devin war die Situation, die sich gerade vor ihm abspielte, nicht geheuer. Seit das Chaos sieben Monate zuvor ausgebrochen war, hatte er viel erlebt, aber ihnen waren noch niemals gewaltbereite Kinder untergekommen. Er packte das Gewehr noch fester und zielte auf den Jungen mit dem Colt. Dieser schien ungefähr zehn Jahre alt zu sein und damit auch der älteste, weshalb die anderen zu ihm aufzuschauen schienen.
»Wie heißt du?«, fragte Tess.
Er nahm die Pistole herunter und antwortete: »Alex.«
Da lächelte sie ihn an. »Alex, hi, ich bin Tess. Bist du hungrig?«
Er nickte.
»Wir können euch helfen«, sagte sie.
»Sie sollen Brianna in Ruhe lassen«, verlangte Devin.
»Also gut, wir geben euch etwas zu essen, aber könnt ihr, du und deine Freunde, zuerst unserer Freundin ein bisschen Platz lassen?«, fuhr Tess fort.
Alex zuckte mit dem Kopf, damit ihm das fettige Haar nicht mehr in den Augen hing. Er lächelte und entgegnete: »Sicher doch.«
Diese schlichte Antwort genügte. Die anderen fünf Jungen senkten ihre Waffen und gingen ein paar Schritte rückwärts.
Devin, der dieser Entwicklung immer noch nicht so recht traute, stemmte sich das Gewehr weiterhin fest gegen die Schulter.
»Hey, Lady, was ist mit ihm?«, fragte Alex Tess, während er auf Devin zeigte.
Sie schaute mit erwartungsvollem Blick zu ihm hinüber. Devin ging seitwärts in ihrer Richtung und blieb dicht neben ihr stehen, ohne mit seiner Waffe auch nur einen Zoll von dem Jungen abzulassen. »Tess, mir gefällt das nicht«, flüsterte er.
Sie erwiderte genauso leise: »Das sind nur hungrige Jungs.«
»Ganz genau.«
Tess wies seine Bedenken von sich, steckte ihre Glock ein und ging an Alex vorbei zum Heck des Humvee. Nachdem sie die Klappe geöffnet hatte, zog sie eine Kiste mit Einmannpackungen heraus und ließ sie auf den Boden fallen.
Alex stieß einen Pfiff aus, woraufhin zwei der anderen Jungen, die ungefähr sieben Jahre alt waren, hinüberliefen und die Rationen aufhoben.
»Sind wir jetzt quitt?«, fragte Tess.
Alex erweckte zwar den Anschein, gerade erst zehn zu sein, legte aber das Benehmen und die Ausstrahlung eines Erwachsenen an den Tag. So wie er sie mit seinen dunkelbraunen Augen anschaute, wirkte er sehr bedrohlich.
Devin hatte dies sofort erkannt, seine Gefährtin aus unerfindlichen Gründen jedoch nicht. Tess war seit ihrer Ankunft am Topsail Beach, als sie vor dem Haus Island Drive 18 geparkt hatten, einfach nicht mehr sie selbst.
»Habt ihr die Karre vom Stützpunkt Lejenue?«, fragte Alex neugierig.
Sie verneinte.
»Woher kommst du?«, bohrte er weiter.
»Von hier.« Sie zeigte auf ihr altes Haus.
Er drehte sich um, lächelte andeutungsweise und entgegnete: »Du stammst aus der Gegend?«
»Kann man so sagen. Wo sind denn deine Eltern?«
»Sie leben nicht mehr«, platzte einer der Siebenjährigen heraus. »Sind alle tot.«
»Wo wohnt ihr?«, fragte Tess.
Alex zeigte auf das Gebäude, in dem Brianna Stunden zuvor Bewegungen ausgemacht hatte. »Ich hab euch doch gesagt, dass dort jemand war!«, rief sie, nun, da sie sich bestätigt sah.
Tess stieß einen langen Atemhauch aus. Sie hatte zwar Mitleid mit den Jungen, erkannte aber, dass ihnen etwas Abgebrühtes und Verzweifeltes innewohnte. Indem sie sich auf ihre Intuition verließ, sagte sie jetzt: »Nun gut, Jungs, wir müssen weiter. Lasst es euch schmecken und trinkt bitte mehr Wasser als üblich, wenn ihr die Sachen esst, denn ansonsten kriegt ihr Verstopfung.«
Brianna öffnete die Fahrertür, woraufhin Brando hineinsprang, dann stieg auch sie ein.
Alex’ Miene zeigte keinerlei emotionale Regung. Als Devin das sah, hob er sein Gewehr langsam wieder an und machte sich auf alles gefasst.
Nachdem Tess um den Wagen herumgegangen war, stieg sie an der Beifahrerseite ein.
Die anderen Jungen behielten Devin im Auge und warteten darauf, dass ihr Anführer Befehle erteilte.
Alex wandte sich dem Mann zu und grinste.
Der Motor des Humvee sprang stotternd an.
Die Spannung setzte Devin heftig zu. Er wusste einfach, dass diese Sache schiefgehen würde, und er wollte nicht Gefahr laufen, zu unterliegen, weil er zu langsam war, weshalb er die Waffe richtig anlegte und rief: »Alex, ich habe nichts gegen dich, aber denk gar nicht erst daran, etwas Dummes zu tun!« Er zielte auf die Brust des Jungen und hakte den Zeigefinger am Abzug ein.
»Wir sind quitt! Nicht schießen!«, rief Alex. Er strahlte eine sonderbare Ruhe aus – sonderbar deshalb, weil er für jemanden seines Alters einfach zu gelassen wirkte.
»Miss Slattery, Miss Slattery, sind Sie das?«, rief auf einmal ein kleines Mädchen. Es war wie aus dem Nichts aufgetaucht.
Brianna wendete den Wagen und fuhr neben Devin vor, womit sie ihm die Sicht auf Alex versperrte.
»Miss Slattery, Miss Slattery!«, wiederholte das Mädchen aufgeregt. Es rannte zur Fahrertür und fing an, gegen die Scheibe zu klopfen.
Brianna schaute hinunter in das schmutzige Gesicht des Kindes, das auch nicht älter als sieben sein konnte, und auch dessen Augen zeugten von Verzweiflung.
Als Tess hinübersah, veränderte sich ihre Miene. »Stell den Motor ab!« Tess stieg wieder aus und lief mit ausgebreiteten Armen um den Wagen herum.
»Meagan, oh mein Gott, Meagan, du bist es!«
Das Mädchen warf sich an Tess’ Brust und klammerte sich an ihr fest. »Fahren Sie nicht wieder weg, bitte«, wimmerte das Kind. »Wir brauchen Sie. Ich habe solche Angst.«
Tess drückte das Kind genauso innig. »Ich kann nicht glauben, dass du es wirklich bist.«
»Sie wollten gerade fahren, bitte tun Sie es nicht!«, flehte Meagan wieder.
Tess machte sich von ihr los und betrachtete sie genauer. Ihr Gesicht war schmuddelig, ihr dichtes, langes, braunes Haar zerzaust und fettig, sodass es an Dreadlocks erinnerte, zumal es sich auch genauso anfühlte.
Sie fing an zu weinen und zu zittern. »Bitte verlassen Sie uns nicht.«
»Wo steckt deine Schwester? Ist Melody bei dir?«
Meagan nickte. »Aber sie ist krank.«
Tess stand auf, nahm sie bei der Hand und sagte: »Bring mich zu ihr.«
Devin beobachtete das alles, allerdings nicht, ohne weiterhin genau auf Alex zu achten.
»Hey, Lady, du darfst da nicht rein«, blaffte der Junge sie an.
Tess ignorierte ihn und ging zügig auf das Haus zu, in dem die Kinder Unterschlupf gefunden hatten.
Devin trat nun ans Beifahrerfenster des Wagens. »Fahr die Straße hinunter und stell ihn dort ab«, wies er sie an. »Klemm dich hinter die dicke Kanone auf der Ladefläche. Ich traue diesen kleinen Scheißern nicht über den Weg.«
Brianna hinterfragte den Befehl nicht, sondern führte ihn genau so aus.
Alex’ Alter und Unreife zeigten sich nun allmählich. Seine Schläfen pulsierten, während er mit zusammengebissenen Zähnen beobachtete, wie sich Tess dem Gebäude näherte. Während seine Freunde begannen, die Einmannpackungen zu verzehren, ging er ebenfalls auf das Haus zu.
Devin blieb ihm dicht auf den Fersen. »Hey, Alex, wo sind denn die Erwachsenen abgeblieben?«, fragte er in dem Versuch, eine Unterhaltung zu starten und mehr Informationen zu erhalten.
»Hast du doch gehört: Sie sind alle tot«, antwortete der Kleine. Er ging schnell und heftete seine Augen auf Tess’ Rücken.
»Hier gibt es überhaupt keine Erwachsenen mehr?«
»Keine netten, nein.«
Devin blickte ihn äußerst verwirrt an wegen dieser seltsamen Antwort.
»Lady, ich hab gesagt, du kannst da nicht rein!«
Tess hatte die Fliegengittertür mittlerweile erreicht. Sie drehte sich zu Alex um und erwiderte: »Meagan ist meine Freundin und ihre Schwester ebenfalls. Sollte es Melody schlecht gehen, werde ich versuchen, ihr zu helfen. Außerdem lasse ich mir nichts von Kindern sagen.« Daraufhin öffnete sie die Tür und betrat ein dunkles und stinkendes Wohnzimmer. Der durchdringende Geruch von Fäkalien traf sie vollkommen unvorbereitet, weshalb sie sich beinahe übergeben musste. Als sich ihre Augen an die dürftigen Lichtverhältnisse gewöhnt hatten, schaute sie sich um. Überall lagen Dreck und Müll, der Raum war die reinste Deponie.
»Wo ist Melody?«
Meagan führte sie durch den Unrat in ein Schlafzimmer hinein. Dort lag ihre Schwester auf schmutzigen Decken. Die zierliche Fünfjährige hatte sich zusammengerollt und zitterte heftig.
Tess eilte an ihre Seite und strich ihr die blonden Locken aus dem Gesicht.
»Melody, Süße, ich bin es – Miss Slattery«, wisperte sie sanft, während sie den Kopf des Mädchens streichelte.
Das Kind öffnete die Augen ein wenig und sah die Frau an, wobei es zu lächeln versuchte, was ihm jedoch nicht gelang. Der winzige Körper strahlte eine intensive Hitze aus. Tess betrachtete Melody genauer, um herauszufinden, was mit ihr nicht stimmte und weshalb sie unter so hohem Fieber litt. Als sie das fleckige Federbett aufschlug, entdeckte sie eine kleine Stichwunde an einer Wade, die bereits rot entzündet war. »Wie ist das passiert?«, frage sie Meagan.
»Alex hat sie mit einem Rechen geschlagen.«
»Netter Kerl, dieser Alex«, knurrte Tess laut.
»Du kannst mich mal, Lady«, wetterte er. Mittlerweile stand er in der Tür.
Tess hatte nicht bemerkt, dass er hereingekommen war, beachtete ihn aber nicht weiter. Sie sah sich im Raum um … der Schmutz und Verfall … der widerliche Gestank – all das war abstoßend. Sie musste sich um Melody kümmern, doch dieser Ort kam dafür nicht infrage. Sie schob die Arme unter das Mädchen – das stöhnte dabei leise auf – und nahm sie vorsichtig auf den Arm. »Komm, Schätzchen, ich werde mich darum kümmern, dass es dir wieder besser geht.«
Melody war so schwach, dass sie sich nicht an Tess festhalten konnte. Ihre Ärmchen baumelten hinunter wie dünne Stöcke. Tess drückte sie fest an sich und ging auf die Schlafzimmertür zu.
Alex blieb trotzig im Weg stehen. »Du bringst sie nirgendwohin, sie gehört zu unserer Bande«, posaunte er hinaus.
»Mach sofort Platz!«, befahl Tess.
»Nein!«