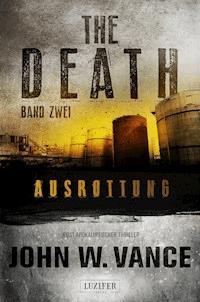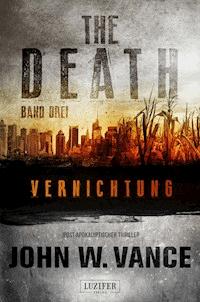
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Death
- Sprache: Deutsch
Thriller-Bestseller aus Amerika! Die Welt befindet sich am Rande eines sechsten großen Massensterbens. Diejenigen, die überlebt haben, betrachten sich nicht als die Glücklichen - eher als die Verfluchten. Devin sucht verzweifelt nach Tess. Er hat sich verändert, ist unbarmherzig und wütend geworden. Wer auch immer sich ihm in den Weg stellt, wird gnadenlos vernichtet. Travis trauert um Lori, doch Cassidy schenkt ihm Hoffnung. Die beiden begeben sich auf einen beschwerlichen Weg durch die Einöde, die einst Amerika hieß, um nach Tess und Devin zu suchen. Kanzler Horton nahm auf seiner Flucht einem neuen Virus mit sich - tödlicher noch als The Death. Er ist weiterhin fest entschlossen, seinen Plan der Weltherrschaft umzusetzen. Während die Erde auf ihre endgültige Vernichtung zusteuert, versuchen Devin, Travis und Cassidy ihre Liebsten zu finden. Können sie ihre abenteuerliche Reise vollenden und endlich ein neues Leben beginnen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
THE DEATH 3 Vernichtung
John W. Vance
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Andreas Schiffmann
Copyright © 2015 by John W. Vance All rights reserved. No part of this book may be used, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the written permission of the publisher, except where permitted by law, or in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews.
Gewidmet
meinen lieben Freunden.
Ihr wisst, wer ihr seid.
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: EXTINCTION Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Andreas Schiffmann Lektorat: Astrid Pfister
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-145-5
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte
unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Prolog - Tag 9
10. Oktober 2020 - Internationaler Flughafen von Denver
Dr. Mueller betrat den Raum und erschrak angesichts des lauten Beifalls, mit dem er empfangen wurde. Nie zuvor in seinem Leben hatte er sich so stolz gefühlt. Endlich zahlten sich all die Lern- und Forschungsjahre aus. Ausnahmsweise war er jetzt einmal derjenige, der im Rampenlicht stand und den Applaus einheimste. Er hätte zu keiner Zeit geglaubt, dass er seine Kenntnisse über ansteckende Krankheiten einmal mit seinen politischen Ansichten verbinden können würde. Sieben lange Jahre hatte es seit dem Tag gedauert, als er Horton, den Leiter der Seuchenschutzbehörde, in dessen Büros in Atlanta kennengelernt hatte, doch für ihn war es das alles wert gewesen.
Der Erreger, den er hergestellt hatte und der jetzt allgemein verständlich »der Tod« genannt wurde, hatte genau das getan, wozu er geschaffen worden war, nämlich den Großteil der Weltbevölkerung umgebracht und den Planeten vom Einfluss des Menschen befreit.
Für Mueller beschränkte sich diese Anerkennung nicht nur auf das Berufliche, denn wer brauchte jetzt, wo die Welt im Sterben lag, noch professionelles Renommee? Es war weitaus persönlicher – ein Beleg dafür, dass er wirklich einzigartige Talente besaß, und diese Genugtuung erfuhr er nun endlich nach jahrelangen Minderwertigkeitskomplexen. Würde dies aber ausreichen? Konnte es das emotionale Loch füllen, das sich während seiner Zeit als Ausgestoßener mehr und mehr vergrößert hatte?
»Dr. Mueller, herzlichen Glückwunsch!«, sagte ein beleibter Mann, der am Kopfende des langen Eichentisches saß.
An den Wänden des abgedunkelten Sitzungssaals reihte sich ein 50-Zoll-LED-Monitor neben den anderen. Alle waren stumm geschaltet, doch die Bilder und Szenen des Chaos, die sie zeigten, schrien förmlich vor Deutlichkeit. An der Wand über dem Kopfende des Tisches hingen die Gesetze des Bündnisses – der Code, nach dem sie alle lebten, und der Wegweiser für ihren Plan.
1. Halte die Menschheit unter 500 Millionen, in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur
2. Lenke die Fortpflanzung weise – um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern
3. Vereine die Menschheit mit einer neuen, lebendigen Sprache
4. Beherrsche Leidenschaft – Glauben – Tradition und alles Sonstige mit gemäßigter (geringer) Vernunft
5. Schütze die Menschen und Nationen durch gerechte Gesetze und gerechte Gerichte
6. Lass alle Nationen ihre eigenen Angelegenheiten selbst/intern regeln und internationale Streitfälle vor einem Weltgericht beilegen
7. Vermeide belanglose Gesetze und unnütze Beamte
8. Schaffe ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen Rechten und den gesellschaftlichen/sozialen Pflichten
9. Würdige Wahrheit – Schönheit – Liebe – im Streben nach Harmonie mit dem Unendlichen
10. Sei kein Krebsgeschwür für diese Erde – lass der Natur Raum
Mueller sagte mit Verweis auf die Einstellungen der Bildschirme: »Vielen Dank, und damit meine ich Sie alle, denn ohne Sie wäre das nicht möglich gewesen. Sie haben mich gleichberechtigt an Ihrem Tisch sitzen lassen, mir vertraut und erlaubt, meine Fähigkeiten einzusetzen, damit wir gemeinsam eine bessere Welt erleben können.«
»Alles verläuft nach Plan«, erwiderte der Mann.
Horton nahm neben ihm Platz, wirkte aber keineswegs hellauf begeistert. Er fixierte Mueller mit seinen Augen, und wenn Blicke töten könnten, wäre der Doktor augenblicklich gestorben.
Dies beunruhigte ihn, denn er empfand Hortons Miene als anstößig und hätte gerne gewusst, was der Kerl gerade dachte.
Nachdem er mehrere Minuten lang über den grünen Klee gelobt worden war, wurde die Besprechung einberufen. Die Bündniskanzler verließen den Raum und kehrten in ihre jeweils zugewiesenen Verantwortungsbereiche zurück. Phase eins war noch immer im Gange, und sie mussten zur Stelle sein, um nun Phase zwei zu lancieren.
Mueller blieb vor dem Saal stehen, steckte die Hände in seine Hosentaschen und ließ den Kopf hängen. Unheimlich schnell schwenkte die Freude darüber, so viel erreicht zu haben, in Schwermut um. Was sollte er jetzt tun? Er hatte ungeheuer viel von seinem Leben für diese Mission geopfert, und jetzt war sein Beitrag erledigt. Im Vorbeigehen klopfte ihm jeder Kanzler auf den Rücken oder gab ihm die Hand. Er nahm es mit einem Lächeln zur Kenntnis, wurde das Gefühl, es sei vorbei, aber einfach nicht los.
Ein anderer dicker Mann kam zu ihm – Kanzler Franz Abert, dessen pummeliges Gesicht gerade ein breites, strahlendes Grinsen zierte. Er kümmerte sich um Europa und bekleidete sein Amt in Genf. »Dr. Mueller, ich freue mich … ich freue mich wirklich sehr«, beteuerte er mit breitem schweizerischen Akzent.
»Ich bin froh«, gab der Doktor zurück. »Ehrlich gesagt war es mitunter doch sehr nervenaufreibend.«
»Ich kann mir vorstellen, dass Sie bestimmt das Gefühl haben, nicht zu wissen, was Sie jetzt tun sollen.«
Mueller blickte ihn erstaunt an und machte große Augen.
»Das ist ja, als könnten Sie meine Gedanken lesen. Als ich hier so stand, dachte ich nämlich gerade genau darüber nach.«
»Lassen Sie sich davon nicht beirren, alle großen Männer hadern mit diesem Gefühl. Sich nicht zu fragen, was als Nächstes kommt, ist schwierig, denn man wähnt sich fast allein. Wer so hart arbeitet und etwas derart Gewaltiges geleistet hat, verspürt die natürliche menschliche Neigung, sich diese Frage zu stellen.« Aberts Tonfall war sanfter geworden. »Kommen Sie mit mir, begleiten Sie mich nach Genf, um sich ein wenig zu entspannen. Das haben Sie sich wirklich redlich verdient.«
Mueller senkte den Blick und wägte den Vorschlag im Geiste ab. Im Grunde hatte er kein Zuhause mehr und die Welt brach zusehends auseinander. Warum sollte er also nicht nach Genf reisen?
»Kanzler Abert, ich glaube …«
»Wenn ich bitten darf«, unterbrach ihn Horton, während er vortrat und einen Arm um Muellers Schultern legte. »Verzeihen Sie bitte die Störung, doch ich hörte gerade, worüber sie sprachen.«
»Kanzler Horton, das ist ja mal wieder typisch für Sie«, warf Abert hörbar verärgert ein.
»Dr. Mueller, Sie müssen leider bei mir bleiben, also hier vor Ort, denn vor uns liegt nach wie vor ein ganzer Berg an Arbeit.«
»Arbeit?«, fragte der Doktor verwirrt.
»Ein Vergnügen für Sie, könnte ich mir vorstellen«, meinte Horton lachend.
»Der Mann ist fertig. Welche Art von Arbeit könnte denn jetzt noch auf ihn warten?«, bohrte Abert neugierig nach.
»Vielleicht habe ich ein wenig übertrieben, aber es steht ein besonderes Projekt an, dem er sich widmen muss.«
Abert drehte sich um und schaute Horton neugierig an. »Lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen, erzählen Sie schon.«
»Ich wollte das eigentlich gar nicht zur Sprache bringen, aber es wird ja irgendwann sowieso herauskommen. Eigentlich habe ich gehofft, er könne sich darum kümmern, bevor es sich nicht mehr umkehren lässt.«
Nun neigte Abert seinen Kopf zur Seite. »Was ist los?«, wollte er alarmiert wissen.
Mueller verzog sein Gesicht und antwortete: »Ich weiß wirklich nicht, was Kanzler Horton meint.«
Dieser schaute sich sorgfältig um, weil er sichergehen wollte, dass sich gerade niemand in Hörweite aufhielt. Sobald er sich vergewissert hatte, dass sie allein waren, beugte er sich zu den anderen beiden und fragte: »Tiere …Sie haben doch keine Tierversuche durchgeführt, oder?«
Beinahe gaben Muellers Knie nach, so als habe jemand ein schweres Gewicht in seine Arme fallen lassen. Das Blut strömte aus seinem Gesicht und er wurde aschfahl. Weiter nachhaken musste er gar nicht. Horton lag nämlich richtig mit seiner Annahme, die ganze Zeit über hatte er Tests an Tieren unterlassen. Selbstverständlich war das Virus Laboraffen zugeführt worden, aber eine groß angelegte Versuchsreihe, um herauszufinden, wie es sich auf andere Tiere auswirkte, hatte es bislang nicht gegeben.
»Tiere? Was ist los?«, wiederholte Abert.
»Kanzler, ich habe das Ganze gerade erst selbst erfahren, aber so wie es aussieht, sterben wohl auch viele Tierarten an dem Virus.«
»Das ist unmöglich«, behauptete Mueller.
»Mein lieber Doktor, das mag es von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet vielleicht sein, aber es geschieht trotzdem. Ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet, aber irgendetwas tötet momentan die meisten Tiere gemeinsam mit den Menschen.«
»Das … ist … ausgeschlossen … das ist unmöglich«, beharrte Mueller. Er schaute keinen der beiden Männer an, sondern starrte nur ins Leere.
»Franz, ich wollte noch keine Pferde scheu machen, aber der Doktor sollte sich sofort an die Arbeit machen, um etwas dagegen zu unternehmen – einen Impfstoff entwickeln, am besten etwas zum Sprühen. Damit könnten wir dann eine große, weltweite Operation mit Sprinklern beginnen.«
Abert sah nun Mueller an, der immer noch »unmöglich« vor sich hinmurmelte.
»Doktor können Sie sofort damit anfangen?«, fragte Horton.
Der Angesprochene hatte sich anscheinend komplett in seinen zweifelnden Gedankengängen verloren.
»Doktor?«, drängte der Kanzler.
»Das ist unmöglich«, murmelte Mueller. Vor wenigen Augenblicken waren ihm noch Lob und Ehre zuteilgeworden. Diese Kleinigkeit könnte ihm zum Verhängnis werden, ja sogar sein Leben bedrohen.
Horton packte eine seiner Schultern und schüttelte ihn sanft. »Doktor!«
»Ja, ja.«
»Ich brauche Sie«, fuhr der Kanzler fort. Als er seinen Kollegen ansah, berichtigte er sich: »Wir brauchen Sie, denn Sie müssen sich dieses Problems annehmen.«
»Ja, ja, natürlich. Ich mache mich gleich an die Arbeit«, versicherte ihm Mueller. Er drehte sich um und eilte davon, bevor die Schwäche, die er spürte, allzu offensichtlich wurde.
»Was bedeutet das für unseren übergeordneten Plan?«, fragte Abert.
Horton ließ Mueller, während dieser den langen Flur hinuntereilte, nicht aus den Augen.
»Kanzler Horton sollen wir die anderen zurückrufen, um es mit allen zu diskutierten?«
»Verzeihen Sie, ich war kurz geistesabwesend. Ich finde, wir sollten es den anderen mitteilen, aber das tun wir erst, wenn sie in ihre jeweiligen Bereiche zurückgekehrt sind. Denn momentan gibt es nichts, was wir tun können, um etwas daran zu ändern, und wenn wir uns wirklich umorientieren müssen, werden sie genau an den richtigen Hebeln sitzen, um das Notwendige unternehmen zu können.«
»Na gut.«
»Kanzler Abert es hat mich sehr gefreut, Sie zu sehen, aber entschuldigen Sie mich jetzt bitte, ich habe Arbeit zu erledigen.« Horton bot ihm seine Hand an.
»Ich verstehe, aber bevor Sie weglaufen, lassen Sie sich gesagt sein, dass mich schwer beeindruckt hat, wie Sie mit dem Präsidenten und seinem Vize verfahren sind. Das war spitze. Die anderen Staatsoberhäupter waren nicht so schwer zu erledigen, doch Sie, mein Freund, haben alles aufs Spiel gesetzt, vielen Dank.«
»Ich danke Ihnen für die netten Worte, aber es musste getan werden, und im Grunde genommen fand ich sogar Gefallen daran, diesen Widerling und seine Erfüllungsgehilfen zu beseitigen.«
Abert klopfte ihm auf die Schulter. »Kommen Sie mit mir nach draußen«, bat er.
Während die beiden über die Korridore des Flughafens von Denver gingen, besprachen sie die Einzelheiten ihres Vorhabens und lachten darüber, wie gut Phase eins gelaufen war.
»Haben Sie schon eine Partnerin gefunden?«, fragte Abert mit Bezug auf den DNS-Abgleich, den Horton nebenbei betreute.
»Es ist noch ein bisschen früh.«
»Ich vermisse Tabitha«, seufzte Abert. »Sie war eine gute Frau.«
»Ja, das war sie, doch jetzt ist es an der Zeit, dass wir eine neue Welt aufbauen, und ich brauche eine neue Gefährtin … eine kompatible Frau ohne die fehlerhaften Gene, die sie hatte.«
»Bald also, nicht wahr?«
»Wenn der Katastrophenschutz seine Lager errichtet und mit den Bluttests begonnen hat, werde ich bestimmt fündig, aber bis dahin wird mein Fokus einfach nur auf unserer anstehenden Aufgabe liegen.«
»Richtig so, und halten Sie uns bezüglich der Sache mit den Tieren auf dem Laufenden.« Mit diesen Worten trat Abert durch die breite Metalltür hinaus auf das Rollband, wo es äußerst laut und hektisch zuging.
Als sie zufiel, sagte Horton: »Das werde ich, verlassen Sie sich drauf. Das werde ich.« Dann nahm er sein Handy und rief eine Nummer auf. Nachdem es mehrmals geläutet hatte, meldete sich Mueller.
»Doktor sind Sie im Labor?«
»Ja, Sir.«
Plötzlich ging die große Metalltür wieder auf, was Horton überraschte, da er sich noch keinen Zentimeter bewegt hatte.
Abert stand plötzlich wieder im Türrahmen und schrie gegen den Lärm an: »Ich habe ganz vergessen, Sie zu bitten, einen weiteren Wissenschaftler zur Hilfe für Dr. Mueller heranzuziehen.«
»Er hat doch schon ein Team«, entgegnete Horton, während er die Hand sinken ließ, in der er das Telefon hielt.
»Das weiß ich, aber wir brauchen einen neuen Leiter, denn sobald der Doktor seine Scharte ausgewetzt hat, werden Sie ihn töten!«
Als Abert die letzten Worte ausgesprochen hatte, heulten die Triebwerke eines Düsenjets auf, sodass Horton überhaupt nichts mehr verstand.
»Was haben Sie gesagt?«, hakte er nach.
Abert neigte sich zu ihm und wiederholte: »Ich sagte: Töten Sie den Doktor, sobald er seinen Fehler wiedergutgemacht hat. Nullnummern wie ihn können wir hier nicht gebrauchen!«
Sein Gegenüber nickte.
Abert drehte sich um und stolzierte davon.
Horton hielt sich das Telefon wieder ans Ohr und fragte: »Dr. Mueller, sind Sie noch dran?«
»Ja.«
»Haben Sie das gehört?«
»Ja.«
»Keine Sorge, Doktor, seinem Befehl zu folgen, liegt mir äußerst fern. Ich weiß um Ihren Wert für uns. Suchen Sie mich so bald wie möglich in meinem Büro auf, ich bin schon unterwegs. Wir sollten unsere weiteren Pläne auf jeden Fall ausarbeiten. Es gibt tatsächlich ein besonderes Projekt, an dem Sie für mich arbeiten sollen, und es hat nichts mit den Tieren zu tun.«
Tag 235 - 23. Mai 2021
Charleston, South Carolina
Devin wälzte sich unruhig im Schlaf hin und her, da ihn seine Träume in eine Situation zurückversetzten, von der er sich wünschte, sie niemals durchgemacht zu haben.
»Tess tritt zurück, ich traue ihm nicht.«
»Sei still, er ist doch nur ein Kind.«
Die Hand des Jungen, in der er das Kleinkalibergewehr hielt, zitterte, während er zu ergründen versuchte, wie er weiter mit den Fremden vor ihm verfahren sollte.
Tess trat noch ein Stück näher.
Dann fielen plötzlich drei Schüsse.
Sie wankte rückwärts und fiel auf den Boden, denn eine Kugel hatte sie in die Brust getroffen.
Devin war geschockt, er nahm sein Gewehr herunter und versuchte ihr zur Hilfe zu kommen.
Der Junge rief: »Sie sind hier drüben! Sie sind hier drüben!«
Devin hielt Tess unter einem Arm fest und richtete sie wieder auf. »Alles Okay? Bitte sag mir, dass du unversehrt bist.«
»Oh, dieser kleine Wichser hat auf mich geschossen!«, knurrte Tess mit überraschtem Gesichtsausdruck.
Weitere Schüsse fielen und Devin wurde in die rechte Schulter getroffen, Tess ebenfalls ein weiteres Mal, dieses Mal in den rechten Arm.
Sie stöhnte laut auf und sackte zurück gegen die Reling.
Durch den Aufprall der Kugel wurde Devin herumgerissen, sodass er Tess kurz losließ.
Daraufhin näherte sich der Junge wieder ein wenig. Er zielte erneut auf sie.
Tess machte einen unsicheren Schritt auf ihn zu, sah ihn an und fragte: »Warum? Ich gehöre doch zu den Guten. Ich bin hier, um euch zu retten.«
Der Junge neigte seinen Kopf zur Seite, weil ihn ihre Bemerkung offenbar verwirrte, und drückte erneut ab. Er traf ihren Oberkörper genau mittig, weshalb sie mit voller Wucht gegen die Reling knallte und hinüberstürzte.
»Nein, Tess!«, schrie Devin, noch während sie getroffen wurde. Er sprang auf sie zu und hätte sie um ein Haar noch zu fassen bekommen. Stattdessen aber musste er mit ansehen, wie sie im Dunkeln verschwand, und ins schwarze Wasser neben dem Schiff fiel.
Devin öffnete seine geschwollenen Augen und schreckte hoch, keuchend wie nach einem Wettrennen. Sein Herz schlug schnell und er schwitzte stark. Da es rings um ihn herum stockdunkel war, konnte er überhaupt nichts erkennen. Kein Lichtstreif drang in den Raum ein, in dem er festgehalten wurde. Es roch extrem nach Öl und Plastik. Er richtete sich auf und atmete langsam ein und aus, um die Schmerzen zu lindern, die seinen geschundenen Körper zermürbten. Wegen der Finsternis wusste er nicht, wo er war, und konnte auch die Tageszeit nicht einschätzen. Er schüttelte den Kopf, um einen klaren Gedanken fassen und die Erinnerung an Tess verdrängen zu können. Ruhig und fest zu schlafen hatte sich als schwierig herausgestellt, denn jedes Mal, wenn er in die REM-Phase übertrat, spielten sich jene grauenvollen letzten Momente, die sie gemeinsam erlebt hatten, wieder in allen Einzelheiten in ihm ab, so als schaue er sich einen Film in HD an.
Sein dürftiger, planloser Versuch, Tess zu finden, hatte ihn lediglich in die Gewalt der Piraten gebracht. Jetzt wünschte er sich, dass er sich Zeit zum Koordinieren genommen hätte, doch stattdessen war er der Versuchung erlegen, sich von seinen Emotionen leiten zu lassen. Sein törichtes Verhalten hatte ihm rein gar nichts gebracht. Streng genommen war dadurch sogar alles noch viel schlimmer geworden, und dies bezog nicht einmal mit ein, was ihn in dieser oder jener Form noch erwarten würde – nämlich ganz gewiss der Tod.
Brianna hatte ihn angefleht, gründlich zu überlegen, aber dazu war er nicht bereit gewesen. Jetzt befand er sich in Gefangenschaft, und die anderen waren allein in North Carolina, ohne dass sie jemand beschützte.
Voller Reue verfluchte er sich nun die ganze Zeit selbst dafür, so kopflos gehandelt zu haben in der Annahme, dass Tess noch am Leben sei.
Auf einmal polterte es laut, gefolgt von einem metallischen Quietschen, das ihn sofort aus seinem Selbstmitleid riss. Helles Nachmittagslicht fiel in den kleinen Kasten.
Er wich davor zurück und zog die Beine in ängstlicher Erwartung dessen an, was als Nächstes geschehen würde.
»Aufstehen«, brüllte ein großer, dünner Mann.
Als Devin zu ihm aufschaute, rechnete er damit, gleich sterben zu müssen, und diese Vermutung machte ihm fürchterliche Angst.
»Ich sagte aufstehen!«, befahl der Mann. Er bückte sich, packte den dichten, dunklen Schopf des Gefangenen und zog ihn daran hoch.
»Argh!«, stöhnte Devin gequält.
»Bewegung!«, blaffte ihn der Fremde an, während er ihn auf die offene Tür zustieß. Weil es so hell war, konnte Devin unmöglich sehen, wohin er ging.
Während er blinzelte, um sich an das helle Licht zu gewöhnen, waren seine anderen Sinne vollkommen überfordert – vor allem sein Gehör, da das laute Gejohle und die Schreie in der Nähe seinen Ohren unglaublich zusetzten. Während sich seine Augen noch anpassten, roch er plötzlich Rauch, und er schaute sich hektisch um. Überall standen schreiende Menschen.
»Ruhe!«, donnerte nun eine Stimme durch ein Megafon.
Die aufgebrachte Menge wurde schnell wieder still.
»Schaff ihn hier hoch!«, befahl die gesichtslose Stimme.
Devin blickte auf, konnte aber bei all den Schubsern und Stößen nicht erkennen, woher sie kam.
Der hagere Mann rammte ihm nun den Lauf seines Gewehrs ins Kreuz und wiederholte: »Bewegung!«
»Lasst ihn durch!«, brüllte die Stimme.
Daraufhin ging die Masse auseinander wie das Rote Meer vor Moses.
Als Devin nun wieder geradeaus schaute, sah er einen einzelnen Mann mit Megafon. Dieser hatte einen dichten, langen Bart und winkte den Gefangenen heran.
Hinter dem Mann lag aufgeschichtetes Holz, und dahinter ragte ein langer Pfahl in die Höhe, an dem Stricke hingen.
Nun stieg blanke Panik in Devin auf, weil er sich jetzt ausmalen konnte, welches Schicksal ihm beschieden sein würde: Er sollte lebendig verbrannt werden! Er zögerte, sich weiterzubewegen, und blieb schließlich ganz stehen.
Der Mann stieß ihn wieder in den Rücken, doch Devin wollte sich auf keinen Fall bewegen.
»Weiter, verdammt!«, schimpfte der Mann und versetzte ihm einen Tritt.
Dieser war so kräftig, dass Devins ohnehin schon weiche Knie einknickten und er auf den Boden fiel.
»Bring ihn her, ob er nun selbst geht oder er dabei auf dem Rücken liegt und du ihn hinterherziehst, tu es einfach!«, rief der Bärtige.
Devin wollte nicht mit geschleift werden, deshalb hielt er eine Hand hoch und sagte: »Ich gehe selbst, okay? Ich gehe selbst.«
»Na dann los.«
Obwohl er körperlich geschwächt war, konnte er trotzdem noch genügend Kraft und Mut sammeln, um aufzustehen. Die Gedanken an Tess kehrten nun unweigerlich wieder zurück, aber sie verliehen ihm die Stärke, sich gerade aufzurichten und seinem Los entgegenzutreten. Er hätte sie nie sehen lassen wollen, dass er vor Furcht zu Kreuze kroch. Falls er auf diese Weise sterben musste, dann sollte es eben so sein.
Mit jedem Schritt, den er ging, fühlte er sich entschlossener und zuversichtlicher. Bald schon würde er tot sein und er hoffte, Tess wiederzusehen, falls auch sie gestorben war. Derart in Gedanken versunken und durch die Bilder von ihr in seinem Kopf in Beschlag genommen, vergaß er seine Umgebung fast vollständig. Erst als der Bärtige ihn packte, wurde er wieder in die Gegenwart zurückversetzt.
»Nun sag schon, wer du bist«, forderte er den Mann auf.
Devin schaute ihn an und antwortete, während er seinen Rücken durchdrückte: »Devin Chase.«
»Devin Chase, was hast du gerade getrieben, als du von meinen Leuten geschnappt wurdest?«
»Ich habe jemanden gesucht.«
»Und wen bitteschön?«
Devin überlegte, was er nun am besten entgegnen würde. Sollte er ehrlich sein? Was, wenn Tess noch lebte und ebenfalls gefangengehalten wurde? Gefährdete er sie dann vielleicht womöglich, falls er die Wahrheit sagte?
»Also, Mr. Chase, ich höre.«
»Ich habe meinen Bruder Morgan gesucht.«
»Hmm Morgan.«
»Sind Sie Renfield?«, fragte Devin.
Damit handelte er sich einen erstaunten Blick ein. »Woher kennst du meinen Namen?«
»Morgan hat ihn mir genannt. Er hat gesagt, er würde für Sie arbeiten, und deshalb wollte ich zu ihm, um zu helfen.«
Der Mann wirkte weiterhin verwundert, während er Devin aufmerksam betrachtete. Schließlich richtete er sich an die Menge und rief: »Kennt hier irgendjemand einen Morgan?«
Ein paar im Pulk hoben ihre Hände.
»Tretet vor.«
»Falls Sie Renfield sind, lassen Sie mich für Sie arbeiten«, bot ihm Devin an.
»Schweig«, erwiderte der Anführer.
Ein imposanter, stämmiger Mann stellte sich nun vor. »Ich kenne Morgan, er und John sind nie aus Jacksonville zurückgekommen.«
»Hat er je einen Bruder erwähnt?«
Der riesige Kerl verdrehte seine Augen, während er nachdachte. »Nein, kein einziges Mal, Captain.«
Als er die Anrede Captain hörte, wusste Devin sicher, dass es sich um den berüchtigten Renfield handelte.
»Aber hat er irgendwann einmal ausdrücklich gesagt, dass er keinen Bruder hat?«, fuhr der Anführer fort.
»Nein, Sir, das hat er nicht.«
»Und du?« Renfield wandte sich nun an einen anderen, der auf die Frage nach Morgan seinen Arm gehoben hatte.
»Nein, Captain, er hat nichts dergleichen gesagt.«
Nun blickte Renfield über die Massen hinweg und rief: »Weiß irgendjemand von euch, ob Morgan einen Bruder hat oder nicht?«
Die Anwesenden blieben allesamt still.
»Anscheinend war Morgan nicht so redselig, oder ihr habt euren Kameraden nicht richtig gekannt«, argwöhnte Renfield und schaute wieder zu Devin. »Woher kommst du? Ich höre einen Yankee-Akzent bei dir heraus.«
»Aus New York.«
»Ha, New York! Dann sag mir doch, woher Morgan kam«, verlangte Renfield.
»Sir, er war kein Yankee, so viel steht fest«, beteuerte der korpulente Mann.
»Captain, bitte, Morgan ist mein Halbbruder. Wir haben unterschiedliche Mütter. Ich bin in New York aufgewachsen, aber vor Jahren in den Süden gezogen.«
»Warum sollte ich dir glauben?«, fragte der Anführer.
»Warum sollte ich mir das aus den Fingern saugen? Das letzte Mal, als ich meinen Bruder gesehen habe …«
»Wann war das?«, unterbrach ihn Renfield.
»Ist schon eine Weile her«, erklärte Devin. Dieses Verhör machte ihn allmählich extrem nervös. Sollte seine Lüge als solche entlarvt werden, käme er bestimmt in Teufels Küche.
Renfield wandte sich wieder den beiden Männern zu und fragte: »Wann wurde Morgan Mitglied bei uns?«
Die Zwei schauten sich an, so als wüssten sie es nicht.
Devin hoffte, ihr Zögern würde genau das bedeuten.
»Äh, ich weiß das genaue Datum nicht mehr, aber ich denke so vor drei, vier Monaten«, entgegnete der dicke Mann schließlich.
»Und ich habe vor zwei Monaten, als er in Jacksonville war, mit ihm gesprochen. Er hatte jemanden nach Norden geschickt, um sich über mich und seine Mutter zu erkundigen. In einem Brief schrieb er mir, wir würden uns in Jacksonville treffen, was wir dann auch taten, aber er brach bald danach wieder auf. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen.«
Renfield betrachtete jeden Quadratzoll von Devins Gesicht eingehend. »Chase, du bist also auf der Suche nach deinem Bruder hierhergekommen, der gar nicht mehr bei uns ist, weil du dich ihm und unserer Gruppe anschließen willst?«
»Ja, Sir.«
»Ihr zwei, geht aus dem Weg«, befahl er den beiden Männern, dann packte er Devin an den Schultern und drehte ihn zur Menge um. »Männer, ich überlasse die Entscheidung euch … nehmen wir Devin Chase in unsere Gruppe auf?«
Daraufhin redeten alle wild durcheinander, doch nach wenigen Sekunden riefen mehrere: »Ja!«
»Irgendwer dagegen?«, hakte Renfield nach.
Devin schloss die Augen und betete.
»Ich würde gerne noch etwas wissen, Captain«, rief nun ein Mann.
»Und zwar?«, fragte Renfield.
Devin versteifte sich vor Angst.
»Was hat er auf dem Kasten? Wir brauchen hier schließlich keine Faulenzer, sondern Leute, die zum Kämpfen und Plündern bereit sind.«
»Nun, Chase: Was hast du drauf?«, fragte Renfield.
»Ich weiß, wie man mit einem Gewehr umgeht«, bekräftigte Devin. »Ich kann ohne Weiteres auf die Jagd gehen und töten!«
Nun nickte Renfield und schob ihn von hinten an. »Willkommen in unserer Gruppe, Chase!«
Devin wollte am liebsten vor Freude jubeln und kam sich vor, als ob ihm eine Last von den Schultern genommen worden sei. Er hatte sich gerade vor dem sicheren Tod gerettet, doch wie lange würde er sich diese Tiere vom Leib halten können?
Die Männer spendeten ihm Beifall.
Renfield wandte sich seinem ersten Maat zu – Silas Gardener – und trug ihm auf: »Holt den anderen Gefangenen her.«
Einige Männer öffneten daraufhin einen großen Schiffscontainer neben dem, in dem Devin gelegen hatte, und zogen einen fremden Mann heraus. Dieser sah nicht älter als fünfundzwanzig Jahre aus.
»Was werfen wir ihm vor, Silas?«, fragte Renfield seine rechte Hand.
»Sir, er soll von seinen Kameraden geklaut, vor allem aber einen direkten Befehl missachtet haben.«
Nun lächelte Renfield und entgegnete erwartungsfroh: »Und welcher Befehl war das?«
»Captain, er weigerte sich, an unserem Überfall auf Savannah teilzunehmen.«
»Er bestahl seine Gefährten also erst und war dann, als sie ihn brauchten, nicht bereit, ihnen zu helfen? Bitte teile uns mit, was an jenem tragischen Tag geschehen ist.«
Erneutes Gegröle und Buhrufe kamen auf.
Renfield hob seine Arme und wedelte damit, um die Menge zu beschwichtigen.
»Sir, an jenem Tag haben wir sieben tapfere Männer verloren – fast das ganze Überfallkommando, um genau zu sein«, rekapitulierte Silas. »Hätte unser heldenhafter Freund Fitzpatrick nicht überlebt, wäre nie herausgekommen, wie feige dieser Kerl hier ist.«
Der Mob johlte erneut und stimmte einen Sprechgesang an: »Nieder mit ihm, nieder mit ihm!«
Devin stand nur wenige Fuß abseits und beobachtete die ganze Entwicklung. Einen Augenblick lang kamen ihm Zweifel, doch diese verdrängte er rasch wieder. Als er sich die Umstände auf der Welt vor Augen rief, sah er ein, dass solche Geschehnisse jetzt wohl an der Tagesordnung waren.
Der junge Mann wurde vorwärtsgestoßen und gezwungen, sich vor Renfield niederzuknien.
»Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?«, fragte der Anführer.
Angesichts der Tatsache, dass sein Schicksal bereits besiegelt war, antwortete der Mann unumwunden: »Du kannst mich mal, du bist doch nichts weiter als ein Monster.«
Renfield lachte und zog den Mann an seinen blonden Haaren, die lang und dicht waren, zu sich. »Was werden wir unseren Bräuchen gemäß mit diesem Typen tun?«
Im Einklang riefen die Männer aufgeregt: »Niedermachen, niedermachen, niedermachen.«
Ein paar forderten außerdem: »Verbrennen wir ihn!«
Abermals hob Renfield seine Arme, um sie zum Schweigen zu bringen.
Devin bemitleidete den Fremden, war gleichzeitig aber auch froh, nicht selbst derjenige zu sein, dem so ein entsetzlicher Tod bevorstand.
»Ihr habt gesprochen, führt ihn zum Scheiterhaufen!«, rief Renfield.
Beim Lärm der Menge, die sich mittlerweile in eine blutrünstige Meute verwandelt hatte, drehte sich Devins Magen um.
Tapfer bestand der junge Mann darauf, selbstständig zum Pfahl zu gehen. Er lehnte sich aufrecht dagegen und ließ sich die Handgelenke freiwillig über dem Kopf festbinden.
Renfield schaute mit vor Aufregung funkelnden Augen dabei zu, während sein Gefolge vor Begeisterung auf und nieder ging.
Devin musste dem Drang widerstehen, wegzuschauen. Denn falls er am Leben bleiben wollte, musste er so tun, als würde er sich an solch barbarischen Szenen ebenfalls weiden.
Mehrere von Renfields Männern kamen jetzt mit Fackeln in den Händen nach vorne, setzten den Boden unter dem jungen Mann aber noch nicht in Brand, sondern hielten erst einmal inne.
Als Renfield seine Arme zum dritten Mal hochreckte, wurde es abermals still in der Menge.
Wie er sie fast wie Hunde abgerichtet hatte, verblüffte Devin.
Nachdem der Anführer seine immerzu gehorsamen Schergen angesehen hatte, widmete er sich wieder dem jungen Mann, der ganz offensichtlich bar jeglicher Hoffnung war. Als die beiden einander ansahen, bewunderte Renfield ihn insgeheim dafür, dass er nicht um Gnade flehte. Sehr oft hatte er festgestellt, dass so mancher gewillt war, sich in der Hoffnung darauf, verschont zu werden, selbst demütigte. Dieser Mann aber wusste wohl genau, dass es weder Worte noch Taten gab, die ihm helfen könnten. Sein Leben würde an diesem Pfahl enden; darum war das Einzige, worauf es jetzt noch ankam, die Art und Weise, wie er sich in seinen letzten Minuten benahm. Genau diese Geistesstärke verlangte Renfield anscheinend Respekt ab. Er hätte eigentlich erwartet, dass der junge Mann unterwürfig betteln würde, doch das tat er nicht.