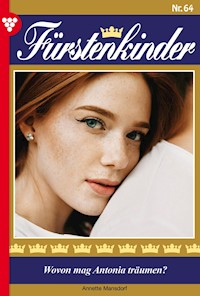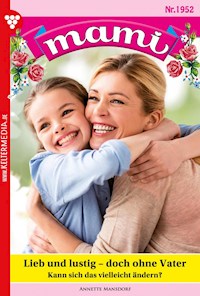Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mami Classic
- Sprache: Deutsch
Seit über 40 Jahren ist Mami die erfolgreichste Mutter-Kind-Reihe auf dem deutschen Markt! Buchstäblich ein Qualitätssiegel der besonderen Art, denn diese wirklich einzigartige Romanreihe ist generell der Maßstab und einer der wichtigsten Wegbereiter für den modernen Familienroman geworden. Weit über 2.600 erschienene Mami-Romane zeugen von der Popularität dieser Reihe. »Du mußt unbedingt am Sonntag zum Essen kommen, Christine. Schließlich mußt du dich doch davon überzeugen, welche Fortschritte dein Patenkind macht.« »Überredet, ich komme. Josi wird sich freuen, Sophie zu sehen. Sie ist sehr beeindruckt, weil Sophie so winzig ist.« »Ich freue mich auch, Josi wieder einmal hierzuhaben. Es ist wirklich ein Wunder, was du bei ihr erreicht hast.« »Daran haben wir wohl beide Anteil.« »Nett, daß du das sagst, aber seit ich geheiratet habe, hatte ich ja nicht mehr viel Zeit. Manchmal habe ich noch ein schlechtes Gewissen.« »Sei nicht albern, Verena. Hast du dir das denn noch nicht abgewöhnt?« Verena hatte sich immer sehr schnell für alles verantwortlich gefühlt. Als sie noch als Sozialarbeiterin tätig gewesen war, hatte sie darunter besonders gelitten. Christine dachte oft daran, wie deprimiert Verena abends meistens gewesen war, wenn sie nach Hause kam. »Ich wette, du denkst gerade mal wieder an unsere stürmische Vergangenheit, stimmt's?« erriet Verena ihre Gedanken. »Stimmt. Aber so stürmisch fand ich sie nicht.« »Es war nicht schlecht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mami Classic – 11 –Aussicht auf Happy-End?
Annette Mansdorf
»Du mußt unbedingt am Sonntag zum Essen kommen, Christine. Schließlich mußt du dich doch davon überzeugen, welche Fortschritte dein Patenkind macht.«
»Überredet, ich komme. Josi wird sich freuen, Sophie zu sehen. Sie ist sehr beeindruckt, weil Sophie so winzig ist.«
»Ich freue mich auch, Josi wieder einmal hierzuhaben. Es ist wirklich ein Wunder, was du bei ihr erreicht hast.«
»Daran haben wir wohl beide Anteil.«
»Nett, daß du das sagst, aber seit ich geheiratet habe, hatte ich ja nicht mehr viel Zeit. Manchmal habe ich noch ein schlechtes Gewissen.«
»Sei nicht albern, Verena. Hast du dir das denn noch nicht abgewöhnt?«
Verena hatte sich immer sehr schnell für alles verantwortlich gefühlt. Als sie noch als Sozialarbeiterin tätig gewesen war, hatte sie darunter besonders gelitten. Christine dachte oft daran, wie deprimiert Verena abends meistens gewesen war, wenn sie nach Hause kam. Und dann dieser unmögliche Daniel, der Zahnarzt, dem sie unverbrüchlich die Treue gehalten hatte, weil sie nicht merken wollte, wie egoistisch er war…
»Ich wette, du denkst gerade mal wieder an unsere stürmische Vergangenheit, stimmt’s?« erriet Verena ihre Gedanken.
»Stimmt. Aber so stürmisch fand ich sie nicht.«
»Es war nicht schlecht. Ich werde dir immer zu Dank verpflichtet sein, weil du mich mit Andreas zusammengebracht hast. Wenn ich ihn nicht getroffen hätte, stell dir vor, es gäbe Sophie dann gar nicht.«
»Stimmt, Daniel hätte so eine schöne Tochter sicher nicht zustande gebracht.«
»Laß ihn doch endlich. Das ist ja alles Schnee von gestern. Sag mal, kommt Hartwig nicht bald wieder?«
»Soweit ich weiß, hat er noch für einige Zeit verlängert. Du weißt, die Gerüchteküche hier an der Schule! Aber sicher bin ich nicht. Wir haben schon länger nichts mehr voneinander gehört. Ich glaube, er hat eine Kolumbianerin kennengelernt. Ich hoffe, er wird glücklich. Wenn ich an ihn denke, komme ich mir immer noch ziemlich schofelig vor.«
»Du hast ihm doch nichts vorgemacht, Christine. Ich war sicher, du liebtest ihn, aber es reichte eben nicht. Bereust du das jetzt?«
Auf diese Frage wußte Christine noch immer keine Antwort. Je mehr sie darüber nachdachte, desto mehr verwirrten sich ihre Gedanken.
Mit den Männern in ihrem Leben war das so eine Sache. Zuerst hatte sie ihren Freund aus der Kindheit geliebt, ihren Benedict. Er war mit dreizehn Jahren weggezogen, sie hatten sich geschrieben, bis mit sechzehn Jahren jeder Kontakt abgebrochen war. Christine hatte ihn lange nicht vergessen können. Es mochte schon sein, daß sie jeden Mann an ihm maß, obwohl sie doch gar nicht wußte, zu welcher Art Mann er sich entwickelt hatte.
Vor zwei Jahren war er dann plötzlich wieder in ihr Leben geplatzt, und gerade in dem Augenblick, wo auch sie ziemliche Turbulenzen durchzustehen hatte. Einmal war da die Sorge um die sich ständig überfordernde Verena gewesen, dann auch um Josi, die sie als Zweijährige aufgenommen hatten, weil ihre Mutter gestorben war, und die dann schließlich Christine als Pflegekind zugesprochen worden war. Inzwischen hatte sie Josi adoptieren dürfen.
Zu der Zeit hatten sich ihre Gefühle für Hartwig gewandelt. Sie hatte plötzlich geglaubt, ihn zu lieben, weil sie sich einfach großartig ergänzt hatten. Heute hatte Christine manchmal den Verdacht, daß sie ihn lieben wollte, weil auch Benedict verheiratet war und eine Tochter hatte, die inzwischen sechs Jahre alt sein mußte.
Aber das alles war nichts, was sie immer wieder besprechen wollte. Wenn Hartwig zurückkam und noch allein war, könnten sie sehen, was es da noch an Gefühlen gab. Christine dachte gern an ihn, an seine Begeisterung, wenn er leidenschaftlich gern kochte, an die Art, sie in den Arm zu nehmen, alles tat er mit großer Hingabe. Alles, was er anfing, beendete er auch. Hatte sie so etwas nicht immer gewollt?
Von Benedict hörte sie nichts mehr. Er hatte die große Villa seiner Großmutter, in der er die ersten Lebensjahre verbracht hatte, bevor seine Eltern sich getrennt hatten, noch immer vermietet. Offenbar konnte er sich nicht entschließen, sie aufzugeben, was Christine nachvollziehen konnte. Sie war ja wirklich prachtvoll. Hin und wieder fuhr sie daran vorbei, einfach so.
Im ersten Jahr nach ihrem Wiedersehen waren von Benedict je eine Karte zu Weihnachten und zu ihrem Geburtstag gekommen. Sie hatte sich höflich bedankt, auch seine Frau und die Tochter grüßen lassen, und dann war der Kontakt wieder abgerissen. Das war gut so. Christine hatte genug zu tun, zum Beispiel mit ihrer Tochter Josi, die jetzt eine sehr aufgeweckte Vierjährige war. Seit vier Wochen ging sie in den Kindergarten. Christines Mutter holte sie mittags ab, versorgte sie, bis Christine aus der Schule kam. Sie war eine hingebungsvolle Großmutter.
Außerdem waren da natürlich noch ›ihre‹ anderen Kinder, die jetzt in die dritte Klasse gingen. In einem Jahr würde sie sich von ihnen trennen müssen, wenn sie weiterführende Schulen besuchten. Aber bis dahin tat Christine alles für sie, was in ihrer Macht stand. Zwei Legastheniker-Kinder kamen dank ihrer Methode gut mit, und auch solche, die aus gestörten Familien stammten, konnte sie eingliedern. Christine liebte ihren Beruf.
Nein, ihr Leben war auch ohne Partner ausgefüllt. Hin und wieder ging sie mit einem Kollegen zum Essen aus, wenn ihre Mutter auf Josi aufpaßte, oder auch allein ins Theater oder Kino. Außerdem hatte sie natürlich Verena, der es während der Schwangerschaft nicht besonders gut gegangen war. Christine hatte sie oft besucht, ihr Gesellschaft geleistet, weil Verena eine Zeitlang liegen mußte, um das Baby nicht zu verlieren.
Andreas Schwert war nicht nur ein ausgezeichneter Kinderarzt, sondern auch ein sehr liebevoller Ehemann und Vater. Um Verena mußte sich Christine keine Sorgen mehr machen.
»Also, dann bis Sonntag. Sollen wir um zwölf da sein, wie immer?«
»Ja, das wäre schön. Dann kannst du noch zugucken, wenn ich Sophie stille. Josi hat das, glaube ich, besonders beeindruckt. Sie sagte, sie will auch mal eine eigene Milch haben.«
»Ich weiß, das hat sie mir auch erzählt. Sie war ganz enttäuscht, daß das erst geht, wenn sie selbst ein Baby hat.«
Verena lachte und verabschiedete sich dann. Christine überlegte, ob sie gleich ihre Mutter anrufen sollte, die sich heute mittag nicht gut gefühlt hatte. Aber dann dachte sie daran, daß sie sich hingelegt haben könnte. Lieber telefonierte sie abends mit ihr.
Josi kam aus dem Kinderzimmer. Christine bewohnte die große Wohnung, die sie früher mit Verena geteilt hatte, jetzt mit ihr. Ihr Gehalt reichte mittlerweile aus, um sich das leisten zu können.
»Mama, ich möchte zu Sabine gehen.«
»Dann tu das, mein Schatz. Aber um sechs bist du wieder hier, ja?«
»Okay«, gab Josi lässig zurück.
Sabine war ihre Freundin aus dem Kindergarten. Komisch, was es für Zufälle gab. Auch Christines erste Freundin hieß so. Sabine hatte mit ihren Eltern vor Benedict in der anderen Doppelhaushälfte gewohnt. Christine hatte nie mehr von ihr gehört, nachdem sie weggezogen war.
Es schien so, als würden alle Menschen, die sie liebte, nach einiger Zeit wieder aus ihrem Leben verschwinden. Ob das einen Sinn machte? Klammerte sie noch immer zu sehr? Ihre Mutter erzählte Christine oft, daß sie als Kind Abschiede nicht hatte ertragen können. Alle sollten bleiben, an denen Christine etwas lag. Nun, heute ging sie wesentlich rationaler vor. Sie wußte, daß Abschiede zum Leben gehörten.
Christine schaute nach, ob Josi sich auch den Anorak angezogen hatte. Sabine wohnte nur zwei Häuser weiter, aber draußen war es kalt und stürmisch. Doch Josi dachte an solche Dinge. Sie war ein aufgewecktes, lebhaftes Kind, aber auch sehr darauf bedacht, Christine Freude zu machen. Oft malte sie ihrer Mama kleine Bildchen, die sie dann morgens auf den Frühstückstisch legte. Christine war dem Schicksal dankbar, daß es ihr Josi geschenkt hatte.
Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und begann, Diktate zu korrigieren. Manche Kinder schafften es schon fehlerlos, andere waren nicht so sicher. Christine nahm sich vor, sie noch einmal besonders zu fördern. Wenn sie Nachhilfe-Unterricht anbot, dann führte sie ihn hier zu Hause durch, damit Josi nicht unnötig lange bei ihrer Mutter bleiben mußte. Daniela Breuer hatte sich durch ihre kunstvollen Seiden- und Trockenblumengestecke einen Namen gemacht und verdiente damit recht gut. Christine rechnete es ihr hoch an, daß sie trotzdem soviel Zeit für Josi aufbrachte. Sie wußte, daß ihre Mutter ein wenig traurig war, weil es keinen Partner im Leben ihrer Tochter gab. Doch diesen Wunsch konnte Christine ihr nicht erfüllen, denn passende Männer wuchsen nun mal nicht auf Bäumen.
Sie zog die Schublade ihres Schreibtisches auf. Dort lag das Foto, das sie und Benedict bei ihrer ›Hochzeit‹ zeigte. Christine trug einen Schleier aus einer Küchengardine und den seidenen Unterrock ihrer Mutter, den diese mit Schleifen und Nadeln so gesteckt hatte, daß er nicht allzusehr an ihr herumschlotterte.
Benedict sah sehr ernst in die Kamera. Er hatte den Arm um sie gelegt. Christine lächelte, als sie daran dachte, wie peinlich es ihr gewesen war, wenn einmal jemand dieses Foto zufällig sah. Sie hatte auf die Rückseite ein Bild geklebt und es schließlich so an die Wand ihres Kinderzimmers gehängt.
»Warum hebe ich es eigentlich noch auf?« fragte Christine das Foto. Doch sie brachte es auch jetzt nicht fertig, es wegzuwerfen und schloß die Schreibtischschublade mit einem dumpfen Knall.
Die Diktate…
Eine halbe Stunde später klingelte das Telefon. Ihr Vater.
»Schatz, ich habe Mama ins Krankenhaus gebracht. Sie fühlte sich plötzlich sehr schlecht. Ich will dir nur rechtzeitig Bescheid sagen, weil du ja wegen Josi vorsorgen mußt.«
»Mein Gott, was ist denn? Sie sagte heute mittag schon, daß es ihr nicht gutginge. Ich habe ihr vorgeschlagen, sich hinzulegen.«
»Sie hat Schmerzen im Unterleib. Ich wollte mich gar nicht erst darauf einlassen, den Arzt zu holen. Natürlich wehrte sie sich, aber es war ziemlich halbherzig. Heute abend fahre ich zu ihr. Vielleicht können die Ärzte dann schon etwas sagen.«
»Ich komme dann auch, Papa. Es tut mir so leid…, kann ich etwas für euch tun? Möchtest du hier wohnen, solange Mama im Krankenhaus bleiben muß?«
»Nein, Schatz, aber lieb, daß du es anbietest. Ich komme schon klar. Mama soll nicht denken, daß gleich alles zusammenbricht, wenn sie einmal nicht für mich sorgen kann. Dann macht sie sich noch zusätzlich Gedanken. Sie soll sich jetzt nur um sich kümmern, damit sie schnell wieder gesund wird.«
Christine wußte, wie sehr ihre Eltern sich noch immer liebten. Sie hatten sich immer gut verstanden, auch wenn es einmal Krach gegeben hatte. Heute, wo so viele Ehen zerbrachen, war das besonders bemerkenswert.
»Ich rufe gleich bei Verena an. Sie kann sich um Josi kümmern, wenn ich in der Schule bin. Bis heute abend, Papa. Mach dir nicht zuviel Sorgen, vielleicht ist es ja nichts Schlimmes.«
Keiner von beiden glaubte dieser Beteuerung, nicht einmal Christine selbst. Ihre Mutter war nie krank gewesen. Diese plötzliche Erkrankung war um so beunruhigender. Sie müßte doch schon vorher Beschwerden gehabt haben…
Verena war auch ganz erschrocken.
»Natürlich kannst du Josi nachher herbringen. Sie kann ja gleich hier schlafen, dann bringt Andreas sie morgen früh zum Kindergarten, und ich hole sie ab.«
»Das wäre vielleicht gut, weil ich dann erst einmal alles abklären und mich meinem Vater widmen kann. Ist es dir auch wirklich nicht zuviel?«
»Aber nein. Ich bin dir wegen Josi immer zu Dank verpflichtet. Natürlich mache ich das.«
»Hör auf mit diesen Dankesbezeugungen, Verena. Wir sind doch Freundinnen.«
»Ich steh dir bei, Christine. Du bist nicht allein. Wenn du Angst hast, kannst du auch herkommen.«
»Angst? Wovor denn? Also, wirklich, Verena.«
Aber als Christine aufgelegt hatte, überschwemmte sie die Angst wie eine schwarze Woge. Irgendeine Veränderung stand in ihrem Leben an. Sie spürte es ganz deutlich.
*
Christines Mutter hatte Unterleibskrebs. Und sie hatte es schon lange gewußt.
Christine und ihr Vater waren außer sich. Wie hatte sie es nur aushalten können, nie ein Wort darüber zu verlieren? Woher nahm man solche Kraft? Oder war es ein Zeichen für mangelndes Vertrauen? Ihre Empfindungen gingen hin und her.
Daniela Breuer erklärte es ihnen. Sie war ganz ruhig, als einzige.
»Ich bin vor einem halben Jahr bei Dr. Heuser gewesen. Er hat mir da schon mitgeteilt, daß es schon sehr weit fortgeschritten sei. Ich war damals drei Tage im Krankenhaus, aber euch hatte ich gesagt, ich fahre zu einer Ausstellung, wißt ihr noch? Es tut mir leid, daß ich euch belogen habe, aber ich wollte nicht, daß ihr mich als Kranke behandelt. Ich hatte keine Schmerzen, weil ich Tabletten bekam. Es wäre noch eine Chemotherapie möglich gewesen, aber der Arzt im Krankenhaus sagte mir ganz offen, daß die Aussichten auf Erfolg sehr gering seien. Nun, jetzt geht es eben langsam zu Ende. Es tut mir sehr leid, wenn ihr mir böse seid. Ich habe es für mich getan, aber auch für euch. Bitte glaubt mir, es wäre ein schlimmes halbes Jahr gewesen. Ihr hättet mich ständig beobachtet und bemuttert. Wir wären alle ganz verkrampft gewesen. Ich liebe euch sehr, aber das wollte ich nicht.«
Sie hatten alle drei geweint, nachdem Daniela Breuer ihre Gründe dargelegt hatte. Christine konnte sie jetzt besser verstehen.
Trotzdem war die Vorstellung, daß ihre Mutter sterben mußte, nicht erträglich. Sie war doch erst gerade Anfang sechzig.
»Und dann habe ich dir auch noch zugemutet, dauernd auf Josi aufzupassen«, schluchzte sie. Jetzt empfand sie es geradezu als Rücksichtslosigkeit. Wieso hatte sie nie gemerkt, daß ihre Mutter so krank war? Sie war ein wenig stiller, aber auch irgendwie inniger geworden… das ja, aber wer sollte ahnen, daß das so einen ernsten Hintergrund hatte?
»Darüber bin ich besonders glücklich. Du hättest mich nie mehr gefragt, ob ich aufpasse oder für Josi koche. Da wäre mir viel Schönes entgangen.«
»Aber ich will nicht, daß du… stirbst!«
Da. Sie hatte es ausgesprochen. Christine hielt vor Entsetzen die Luft an. Ihre Mutter lächelte und drückte ihre Hand.
»So schnell wird das auch nicht gehen. Ich bekomme neue Medikamente, so daß ich die Schmerzen nicht mehr so spüre. Gott sei Dank brauche ich noch kein Morphium. Ich kann auch wieder nach Hause. Aber jetzt mußtet ihr es doch erfahren, denn nun brauche ich doch ein wenig Hilfe.«
»Ach, Mama…, ich werde wieder nach Hause kommen, damit ich mich um dich kümmern kann.«
»Das mußt du nicht.«