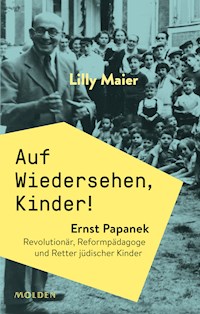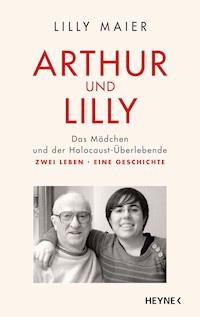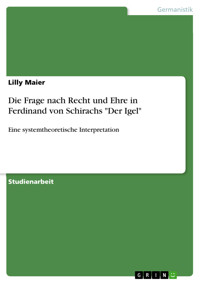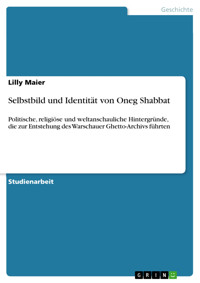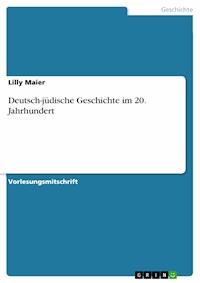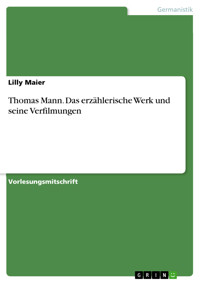15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Geschichte Europas - Mittelalter, Frühe Neuzeit, Note: 1,0, Ludwig-Maximilians-Universität München (Historisches Seminar - Abteilung für Mittelalterliche Geschichte), Veranstaltung: Das Kaisertum in Italien im Mittelalter: Friedrich I. und Friedrich III. im Vergleich, Sprache: Deutsch, Abstract: Am 19. März 1452, einem Rosensonntag, wurde Friedrich III. von Papst Nikolaus V. zum Kaiser gekrönt – es war die letzte Kaiserkrönung, die jemals in Rom stattfand. Im Anschluss daran erteilte der Habsburger mehreren hundert Männern den Ritterschlag auf einer Brücke am Tiberufer, die wegen ihrer Lage an der römischen Engelsburg und ihrer Verzierung durch Engelsstatuen Engelsbrücke genannt wird. In der vorliegenden Arbeit geht es nun um zwei Fragen: Was bedeutete Friedrichs III. Ritterschlag auf der Engelsbrücke für die damalige Zeit? Und was bedeutet er für die heutige Forschung? Der gesamte Romzug des Habsburgers ist eines der bestbezeugtesten Ereignisse in der mittelalterlichen Geschichte. In der Forschung wurde das Thema und vor allem der Ritterschlag auf der Engelsbrücke bis jetzt aber nur sehr nebensächlich behandelt: Es gibt eine einzige Monographie von Johannes Martens aus 1900 über die Krönung, und speziell zum Ritterschlag nur einen Aufsatz von Achim T. Hack (2004). Die meisten Erkenntnisse lassen sich also aus den zahlreichen Quellen und den Sekundärwerken über die Quellen gewinnen. Sowohl die Darstellung durch Augenzeugen, als auch die meist negative Rezeption in der späteren Forschung geben Auskunft über die Bedeutung des Ritterschlags und werden deshalb im ersten Teil dieser Arbeit ausführlich behandelt Da die Ereignnisse auf der Engelsbrücke Ausdruck des Herrscherzeremoniells von Friedrich III. waren, gehe ich außerdem der Frage nach, ob der Ritterschlag ein Ritual oder eine Zeremonie war. Im zweiten Teil der Arbeit geht es dann darum zu zeigen, welche Auswirkungen Friedrichs Ritterschlag hatte. Angefangen von der naheliegendsten, nämlich neuen Rittern, bis hin zum erstmaligen Aufkommen von Ritterschlagslisten, werden eine Vielzahl von Folgen der Ritterpromotion Friedrichs III. vorgestellt. Ein eigener Punkt ist außerdem der zeitgenössischen Kritik gewidmet. Bevor die Bedeutung und die einzelnen Auswirkungen ausführlich behandelt werden, ist der Arbeit ein kurzer historischer Abriss über die Geschichte der Rittererhebung und ein Überblick über den Ablauf der Ereignisse des 19. März 1452 vorangestellt. Im Schlussteil fasse ich dann die in der Arbeit vorgestellten Erkenntnisse zusammen, um sie gesammelt zu interpretieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
2.Die Geschichte der Rittererhebung: Von der Schwertleite bis zur Massenpromotion
3.Der Ritterschlag auf der Engelsbrücke: Ablauf
4.Die Bedeutung des Ritterschlags
a.Darstellung durch Augenzeugen
i.Eneas Silvius Piccolomini
ii.Andreas von Lappitz
iii.Anonymer Romzugsbericht (Ps-Enenkel)
b.Darstellung in der Forschungsliteratur
c.Der Ritterschlag auf der Engelsbrücke: Ritual oder Zeremonie?
5.Die Auswirkungen des Ritterschlags
a.Neue Ritter
b.Prestige
c.Ritterschlagslisten
d.Weiterentwicklung zum normativen Text
e.Zeitgenössische Kritik
i.Unwürdigkeit der Teilnehmer
ii.Karlsfrömmigkeit
f.Unfreiwillige Erhebung
6.Zusammenfassung und Fazit
7.Quellen
8.Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Am 19. März 1452, einem Rosensonntag, wurde Friedrich III. von Papst Nikolaus V. zum Kaiser gekrönt – es war die letzte Kaiserkrönung, die jemals in Rom stattfand.[1]Im Anschluss daran erteilte der Habsburger mehreren hundert Männern den Ritterschlag auf einer Brücke am Tiberufer, die wegen ihrer Lage an der römischen Engelsburg und ihrer Verzierung durch Engelsstatuen Engelsbrücke genannt wird. In der vorliegenden Arbeit geht es nun um zwei Fragen: Was bedeutete Friedrichs III. Ritterschlag auf der Engelsbrücke für die damalige Zeit? Und was bedeutet er für die heutige Forschung?
Der gesamte Romzug des Habsburgers ist eines der bestbezeugtesten Ereignisse in der mittelalterlichen Geschichte. In der Forschung wurde das Thema und vor allem der Ritterschlag auf der Engelsbrücke bis jetzt aber nur sehr nebensächlich behandelt: Es gibt eine einzige Monographie von Johannes Martens aus 1900 über die Krönung,[2] und speziell zum Ritterschlag nur einen Aufsatz von Achim T. Hack (2004).[3] Die meisten Erkenntnisse lassen sich also aus den zahlreichen Quellen und den Sekundärwerken über die Quellen gewinnen.
Sowohl die Darstellung durch Augenzeugen, als auch die meist negative Rezeption in der späteren Forschung geben Auskunft über die Bedeutung des Ritterschlags und werden deshalb im ersten Teil dieser Arbeit ausführlich behandelt Da die Ereignnisse auf der Engelsbrücke Ausdruck des Herrscherzeremoniells von Friedrich III. waren, gehe ich außerdem der Frage nach, ob der Ritterschlag ein Ritual oder eine Zeremonie war.
Im zweiten Teil der Arbeit geht es dann darum zu zeigen, welche Auswirkungen Friedrichs Ritterschlag hatte. Angefangen von der naheliegendsten, nämlich neuen Rittern, bis hin zum erstmaligen Aufkommen von Ritterschlagslisten, werden eine Vielzahl von Folgen der Ritterpromotion Friedrichs III. vorgestellt. Ein eigener Punkt ist außerdem der zeitgenössischen Kritik gewidmet.
Die Sekundärliteratur über Friedrichs Ritterschlag ist wie bereits erwähnt sehr spärlich. Achim T. Hack ist der einzige Historiker, der sich wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Neben seinem Aufsatz über den Ritterschlag hat er sich auch äausführlich mit dem erhaltenen Quellenmaterial beschäftigt[4] und eine der Chroniken ediert.[5]
Bevor die Bedeutung und die einzelnen Auswirkungen ausführlich behandelt werden, ist der Arbeit ein kurzer historischer Abriss über die Geschichte der Rittererhebung und ein Überblick über den Ablauf der Ereignisse des 19. März 1452 vorangestellt. Im Schlussteil fasse ich dann die in der Arbeit vorgestellten Erkenntnisse zusammen, um sie gesammelt zu interpretieren.
2. Die Geschichte der Rittererhebung: Von der Schwertleite bis zur Massenpromotion
In der Literatur existieren eine Vielzahl von unterschiedlichen Definitionen für den mittelalterlichen Titel Ritter.[6] Einig sind sich aber alle darin, dass ein Ritter „durch ein bestimmtes Ritual zu dem gemacht wurde, was er ist: […] ein Mann, der den ‚Ritterschlag’ erhalten hatte“[7] und dass er sich dann „von demjenigen Standesgenossen unterscheidet, der diese Rangerhöhung nicht erfahren hat.“ [8]
Die Zeremonie der Rittererhebung veränderte sich im Lauf der Jahrhunderte immer wieder grundlegend. Ihre Wurzeln reichen sogar bis in die Antike zurück: Bei den Römern bekamen Würdenträger, die ein Amt übernahmen, feierlich einen Gürtel überreicht.[9] Ihren eigentlichen Ursprung hat die Rittererhebung aber in der Wehrhaftmachung germanischer Jugendlicher, die zur Volljährigkeit in öffentlicher Versammlung mit ihren Waffen umgürtet wurden.[10]
Anfang des 12. Jahrhunderts entwickelte sich daraus dann die Schwerleite. Erst jetzt kann wirklich von einer Aufnahmezeremonie ins Rittertum gesprochen werden, „da erst in dieser Zeit die spezifisch höfisch-ritterliche Kultur entstand.“[11] Der Begriff Schwertleite bezeichnet das „ganze Fest der Ritterweihe“,[12] deren Höhepunkt die feierliche Umgürtung mit dem Schwert bildete. In der mittelalterlichen Literatur existierten parallel zahlreiche Begriffe, die den selben Vorgang beschreiben: „Waffen nehmen“, swert geben“,„swert umgürten“,„ritters namen gewinnen“, „in ritters namen kômen“, „zur ritterschaft bringen“ und viele mehr. [13]
Mit der Zeit wurde die umfangreiche und zeitaufwendige Zeremonie der Schwertleite vom Ritterschlag abgelöst. Erste Belege für diese „unfeierliche Kurzform“[14] finden sich Ende des 12. Jahrhunderts in Flandern. Ab 1377 ist der Ritterschlag dann auch in Deutschland nachweisbar, wo er sich bald zur „beliebtesten […] Form der Ritterpromotion“ entwickelte. [15]
Zeitgleich mit der Verleihung der Ritterwürde an Einzelpersonen (sei es nun durch Schwertleite oder durch Ritterschlag) kam es auch zu Massenpromotionen, die ab Ende des 12. Jahrhunderts immer häufiger wurden. Im Spätmittelalter wurde die kollektive Ritterwürde oft bei besonderen Anlässen (Krönungen, Hochzeiten, Hoffesten, Schlachten, Feldzügen) oder an besonderen Orten (am Heiligen Grab, auf Englandfahrten, auf Preußenfahrten, auf der Engelsbrücke in Rom) verliehen. Diese speziellen Ritterpromotionen wurden durch die hohe Zahl an neuen Ritter als besonders prunkvoll angesehen und in immer größerem Umfang zur Verherrlichung von Festen eingesetzt. Bei diesen Gelegenheiten war es außerdem „auch Nichtadligen möglich, die Ritterwürde zu erlangen.“ [16]
Durch die geänderte Kriegsführung wurde der Ritterstand im Lauf des 16. und 17. Jahrhunderts überflüssig und der Brauch des Ritterschlags starb aus.
3. Der Ritterschlag auf der Engelsbrücke: Ablauf
„Vnd also mitten vff der teifer prugg hielt da des hailigen Reichs paner vnd sant Iörigen venlin, vnd schlůg da der Römisch kaiser Ritter, / Fürsten, graufen, h[er]rn vnd edel leŵt wol bey dreyhundert, / als sy dann all mit namen beschriben sind. Vnd da die Ritter nun all geschlagen wurden mit dem hailigen des kaiser Carls swert, das der Engel gotz […] von himel hatt pracht, das In auch allen besunder genad von got, Ere vnd lob vor den menschen ist. Da můsten sy all nider knyegen, vnd ward In da ordenlichen nach notdurft erzelt ritterliche ordnung. Darnach raitt der kaiser mit allem seinem volck durch die Statt zu Rom bis zu sant Iohanns Latron in aller seiner kaiserlichen wirdikait, mit der costlichen Cron vff dem haubt, vnd fůrt die guldin Rosen, die Im der Babst hett geschenckt, in der gerechten hannd. “[17]
Am 19. März 1452 wurde Friedrich III. in der Peterskirche in Rom von Papst Nikolaus V. zum Kaiser gekrönt. Dank der vielen bis heute erhaltenen Berichte und Chroniken lässt sich der Ablauf des Tages sehr gut rekonstruieren:[18]Nach der Krönung kehrte ein Teil der anwesenden Gäste gemeinsam mit Kaiserin Eleonore in ihre Unterkünfte zurück. Auch der neugekrönte Kaiser und der Papst verließen den Dom und der Papst bestieg sein Pferd. Bevor auch Friedrich III. auf sein Pferd stieg, leistete er den traditionellen Stratordienst, indem er Nikolaus’ V. Pferd einige Schritte lang am Zügel führte. Anschließend ritten die beiden
– Friedrich III. immer noch in vollem Ornat und mit großem Gefolge – zur Kirche Santa Maria in Traspontina. Dort überreichte Nikolaus V. dem Kaiser, dem Brauch des Rosensonntags entsprechend, eine geweihte goldene Rose. Danach kehrte der Papst in den Vatikan zurück und Friedrich III. ritt mit seinem Gefolge bis zur Engelsbrücke weiter. Auf der Brücke am Tiberufer erteilte der Kaiser mit seinem Schwert rund dreihundert Männern den Ritterschlag. Die Männer mussten vor dem Kaiser hinknien und erhielten der Reihenfolge ihres Ranges entsprechend die Ritterwürde, einer der ersten war Friedrichs Bruder Herzog Albrecht VI. Teil der Massenpromotion war auch ein langer Vortrag über die Pflichten von Rittern. Die gesamte Zeremonie wird auf zwei bis drei Stunden geschätzt. Den Abschluss des langen Krönungstages bildete ein Festmahl im Lateran, von dem der Kaiser mit seinem Gefolge erst spät in der Nacht in den Vatikan zurückkehrte, wo er auf Einladung des Papstes wohnte.
4. Die Bedeutung des Ritterschlags
Die Bedeutung eines Ereignisses lässt sich gut daran ermessen, wie es im Nachhinein beurteilt wurde. Im Folgenden werden zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen vorgestellt: die der Augenzeugen und die der späteren Historiker. Um die Darstellung der Augenzeugen besser einordnen zu können, werden die Chronisten kurz biographisch vorgestellt, wobei besonders auf ihre persönliche Rolle während Friedrichs III. Riterschlagszeremonie eingegangen wird.
a. Darstellung durch Augenzeugen
Über 25 Augenzeugen aus mehreren Ländern berichteten in Chroniken oder Briefen von der letzten Kaiserkrönung in Rom. An drei dieser Chroniken lassen sich besonders gut verschiedenste Aspekte des Ritterschlags aufzeigen. Alle drei stammen von sehr unterschiedlichen Zeitgenossen Friedrichs III.: seinem Vertrauten Eneas Silvius Piccolomini, einem kroatischen Adelssohn und einem anonymen Beobachter.
i. Eneas Silvius Piccolomini
Eneas Silvius Piccolomini (1405-1464), der spätere Papst Pius II., gilt als eine der interessantesten Gestalten des 15. Jahrhunderts und als erster Humanist nördlich der Alpen.[19] Ausgehend vom Basler Konzil machte der Diplomat rasch Karriere in der Politik. 1442 trat er in die österreichische Kanzlei ein und übernahm dort eine „führende Rolle in der königlichen Diplomatie“,[20] 1452 bereitete er dann die Kaiserkrönung Friedrichs und dessen Heirat mit Eleonore von Portugal vor. Piccolomini – inzwischen Bischof von Siena – war selbst sehr aktiv in das Geschehen um die Kaiserkrönung und den Ritterschlag Friedrichs III. eingebunden und ohne Zweifel „unter den Teilnehmern des kaiserlichen Gefolges […] einer der besten Romkenner.“[21]
Neben seiner politischen Arbeit war der Diplomat Zeit seines Lebens auch als Schriftsteller und Historiker tätig und hinterließ ein sehr umfangreiches Werk. Er kannte also nicht nur die Politik des Kaisers und der römischen Kurie, sondern konnte die Romfahrt Friedrichs III. auch noch im historischen Kontext betrachten, was er in seiner „Historia Austrialis“ ausführlich tat. Die vier Bücher umfassende Geschichte Österreichs reicht zwar bis in die römische Zeit zurück, aber die Jahre 1449-1553 nehmen fast zwei Drittel des Textes ein.
An der Textmenge zeigt sich schon, welche Bedeutung der Humanist Piccolomini dem Italienzug Friedrichs beimaß. In seiner Darstellung des Ritterschlags auf der Engelsbrücke sind aber nicht nur seine detaillierten Beschreibungen spannend. Piccolomini kritisierte auch wiederholt die Unwürdigkeit der Teilnehmer und den mystifizierten Volksglauben, der die von Friedrich verwendeten Krönungsinsignien Karl dem Großen zuordnete. Die bedeutende Rolle, die er selbst bei der Krönung von Friedrich III. spielte, hebt Piccolomini auch in der „Historia Austrialis“ immer wieder hervor. Interessanterweise spricht er dabei von sich selber in der dritten Person[22] und erweckt so den Eindruck, als wäre er ein Unbeteiligter.
Piccolominis Beschreibung vom Romzug Friedrichs III. ist die mit Abstand ausführlichste zeitgenössische Schilderung des Ereignisses, was den Chronisten für die Forschung ungeheuer wichtig macht. Der Historiker Achim T. Hack bezeichnet ihn aber trotzdem als einen „unberechenbaren Informanten“ und kritisiert, dass Piccolomini aus stilistischen Gründen immer wieder wichtige Begebenheiten weglässt.[23]
ii. Andreas von Lappitz
Andreas von Lappitz (1435-1506) war der Sohn eines kroatischen Adligen und kam mit zehn Jahren in den Dienst des Steirers Erasmus von Wildhaus.[24] Als 16-jähriger Knappe nahm er in dessen Gefolge am Romzug von Friedrich III. teil, wo er auch selbst den Ritterschlag vom neugekrönten Kaiser erhielt. Im Verlauf seines Lebens war Lappitz im Dienst verschiedenster Herren, gegen Ende des 15. Jahrhunderts kaufte er sich dann die Burg Lappitz in Niederösterreich, nach der er sich und sein Geschlecht von nun an nannte. Wahrscheinlich gegen Ende seines Lebens schrieb Lappitz eine Familienchronik, von der bis heute nur ein Fragment von Johann Willhelm Graf Wurmbrandt ediert wurde.
Lappitz schrieb seine Chronik mit einer „informativ-belehrenden Absicht“[25] für seine Nachfahren: „zu einem Unterricht mein Khindern/ nahmblich mein Söhnen/ daß sie doch wissen/ was Wunders und unglaublicher Handl ist beschehen bey meinen Zeiten.“[26]
Zwar enthält Lappitz’ Text einige Fehler (zum Beispiel datiert er Friedrichs Romzug fälschlicherweise auf die Jahre 1450/51),[27] trotzdem ist er für die Forschung über den Ritterschlag auf der Engelsbrücke äußerst wichtig, da Lappitz der einzige Chronist ist, der selbst zum Ritter geschlagen wurde.
Für Lappitz stellt der Ritterschlag auf der Engelsbrücke das bedeutendste Ereignis des gesamten Romzugs dar. In der Familienchronik zeigt sich immer wieder, wie wichtig und bedeutend Lappitz auch seine eigene Promotion einschätzte. Der gesamte Text ist laut dem Historiker Harald Tersch der „Ausdruck eines Aufstiegswillens“[28] – und für diesen sozialen Aufstieg hatte der junge Adelssohn viel unternommen. Als Lappitz erstmals von Friedrichs Romzug hörte, war er mit 16 Jahren eigentlich schon zu alt, um als Knappe von seinem Herrn mitgenommen zu werden: „Nun het mein Herr von Wildhausen unser drey Knaben alles Edelleuth, da hat Ich grosse Sorg Er wurd ain andern mit Im nehmen.“[29] In seiner Chronik beschreibt Lappitz detailliert, wie er heimlich einen alten Diener mit Geschenken und Diensten bestach, damit dieser seinen Herrn überredete, ihn mitzunehmen.[30] Die Tatsache, dass Lappitz den Diener nicht nur bestach, sondern die Begebenheit auch für seine Nachfahren aufschrieb, zeigt nur noch einmal, wie bedeutend das Erlangen des Ritterschlags durch Kaiser Friedrich III. für ihn war. Diese „Darstellung einer Bestechung im Dienste der eigenen Sache“ ist für Harald Tersch eine der „atmosphärisch dichtesten Äußerungen österreichischer Selbstzeugnisse im Spätmittelalter“ [31] und wurde in der Forschung immer wieder wegen ihrer ungewöhnlichen Offenheit beachtet.
iii. Anonymer Romzugsbericht (Ps-Enenkel)
In zahlreichen Handschriften ist auch ein anonymer Bericht über Friedrichs Romzug überliefert, der in der älteren Forschung „wiederholt, jedoch ohne hinreichende Gründe dem kaiserlichen Rat Kaspar Enenkel zugeschrieben“ wurde.[32] Achim T. Hack, der den Text edierte, nennt den unbekannten Autor deswegen Pseudo-Enenkel (Ps-Enenkel). Der anonyme Romzugsbericht entstand sehr bald nach der Kaiserkrönung Friedrichs III. – „zu einem Zeitpunkt also, als das Interesse an derartigen Informationen nördlich der Alpen zweifellos am stärksten war.“[33]
Die anonym überlieferte Chronik besteht aber nicht nur aus einem erzählenden Teil. Fast noch wichtiger sind die dem Text angehängte Personenlisten. Die Römische Einzugsordnung, die den feierlichen Einzug in die Stadt Rom regelte, und die sogenannten Ritterschlagslisten, auf die später noch genauer eingegangen wird, stammen wohl beide aus der kaiserlichen Kanzlei und verleihen der Chronik „einen quasi-offiziellen Charakter.“[34]
Der anonyme Romzugsbericht ist außerdem ein Zeichen dafür, welche Bedeutung Friedrichs Ritterschlag auf der Engelsbrücke auch noch Jahrhunderte später zugemessen wurde. Im 17. Jahrhundet veröffentliche Job Hartmann Enenkel eine Version des Textes in der er erstmals Kaspar Enenkel als Verfasser angab: „Mein Caspar des Ennenckl Verzeichnuß was sich bey Kayser Friedrichen Rays nach Rom zugetragen, als der selbst mit dem Kayser gewest, und alles angesehen.“[35] In der dem Text angehängten Ritterschlagsliste steht „Caspar Enenkel“ außerdem an 100. Stelle.[36] Auch wenn die ältere Forschung Kaspar Enenkel daraufhin als Verfasser der Chronik ansah, erwähnen ihn die zahlreichen anderen überlieferten Handschriften weder als Autor noch als promovierter Ritter. Achim T. Hack kommt deshalb zu dem Schluss, „daß der Name […] nachträglich [von Job Hartmann Enenkel] interpoliert wurde, um die Bedeutung des Vorfahrens und damit der eigenen Familie zu unterstreichen.“[37]
b. Darstellung in der Forschungsliteratur
Sowohl in der älteren als auch in der neueren Forschung wurde Friedrichs Ritterschlag auf der Engelsbrücke als unwichtig oder sogar lächerlich abgetan. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts veröffentlichte Ferdinand Gregorovius seine „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“. Über die Massenpromotion im März 1452 schreibt er:
„Wenn sie diesen Imperator betrachteten, wie er auf der Engelsbrücke dreihundert Personen zu Rittern schlug, mochte er ihnen bemitleidenswert erscheinen; denn diese ermüdende Zeremonie dauerte mehr als zwei Stunden. Man spottete über die Ritter von der Engelsbrücke, welche das hingeschwundene Rittertum parodierten wie der Kaiser das Kaisertum.“ [38]
In seinem Text betrachtet Gregorovius Friedrich III. sehr kritisch, unter anderem nennt er ihn „ein mit Gold und Edelsteinen bedecktes Idol aus einer glücklich abgestorbenen Vergangenheit.”[39] Auch den gesamten Romzug befindet Gregorovius als von geringer historischer Bedeutung, danach „kehrte Friedrich III. von der genußreichsten aller Romfahrten“ zurück, immerhin aber „mit einem Titel […], der ihm unter den Würdenträgern der Welt den ersten Platz gab.“ [40]
Die einzige Monographie über den Romzug Friedrichs III. ist die Dissertation von Johannes Martens aus dem Jahr 1900. Auf gerade einmal 85 Seiten fällt der Doktorand ein vernichtendes Urteil über den Habsburger, dem er eine „Unfähigkeit zur Regierung des Reiches“ attestiert.[41] Nachdem Martens einen kurzen Absatz lang den Ablauf des Ritterschlags beschrieben hat, nutzt er die nächsten eineinhalb Seiten um ihn zu kritisieren. In seinem abschließenden Fazit nennt er den Ritterschlag auf der Engelsbrücke „eine Zeremonie, die in keiner Beziehung mehr irgend welchen Wert hatte.“ [42]
Auch im 20. Jahrhundert änderte sich der Grundtenor nicht: Bernd Rill bezeichnet den Ritterschlag 1987 in einem Nebensatz als „eine ermüdende Prozedur“ und Friedrichs III. „schwerstes Tagewerk“,[43] Heinrich Koller nennt ihn schlicht ein „weiteres anstrengendes Zeremoniell“.[44] Die geringe Bedeutung, die die beiden Friedrich-Biographen der Massenpromotion zukommen lassen, zeigt sich auch in ihrer ungenauen Beschreibung des Ereignisses, Koller bringt zum Beispiel die Reihenfolge durcheinander.[45] Außerdem sprechen beide Autoren jeweils von genau 300 neuen Rittern,[46] was – wie sich im folgenden Kapitel zeigen wird – nicht stimmt.
Der einzige, der nicht negativ über den Ritterschlag von Friedrich III. auf der Engelsbrücke schreibt, ist Achim T. Hack, der wegen seiner zahlreichen Publikationen zu der Thematik ohne Zweifel der wichtigste Forscher auf diesem Gebiet ist.
c. Der Ritterschlag auf der Engelsbrücke: Ritual oder Zeremonie?
In der historischen Fachliteratur wird der Ritterschlag auf der Engelsbrücke manchmal als Ritual und manchmal als Zeremonie bezeichnet. Durch eine klarere Definition lässt sich die Bedeutung des Ereignisses allerdings besser einordnen: Der Soziologe Robbie Davis-Floyd definiert Ritual als „ a patterned, repetitive, and symbolic enactment of a cultural belief or value.“[47]Die Hauptaufgabe von Ritualen ist es demnach, innerhalb einer Gruppe ein Gefühl von Einheit zu schaffen und dadurch die individuellen Überzeugungen und Werte an das Glaubens- und Wertesystem der Gruppe anzugleichen.Dabei ist es egal, ob es sich bei dem Ritual um einen indigenen Tanz, eine Krönung oder ein Rockkonzert handelt – entscheidend ist, dasskünstlich Öffentlichkeit hergestellt wird.
Die „International Encyclopedia of the Social Sciences“ aus 1968 unterscheidet neben Ritual auch noch zwischen Zeremonie und Brauch: „Ritual is then usually […] associated with religious performance, while ceremony and custom become […] categories for the description of secular activity.“[48]Der Ritterschlag Friedrichs III. ist also dieser Definiton nach kein Ritual, sondern eine Zeremonie: eine weltliche Zeremonie der Aufnahme und der „öffentlichen Verpflichtung auf die Lebensform“[49] des Ritters.
Zeremonien finden meist bei repräsentativen Anlässen statt und wie bei Ritualen ist auch hier das Erzeugen von Öffentlichkeit wichtig, da diese durch ihre Zeugenschaft die Handlung legitimiert: „Herrschaftliche Akte […] bedurften der Akzeptanz und Rezeption bei den maßgeblichen Referenzgruppen, wenn sie nicht völlig wirkungslos bleiben sollten.“[50] Rituale und Zeremonien sind Formen der symbolischen, nonverbalen Kommunikation.„For the majority of their subjects all kings are symbols: they symbolize the kingdom they reign over and its people, even its very existence,“[51] schreibt der Soziologe J. H. M. Beattie. In Szene gesetzt werden diese Symbole durch monarchische Zeremonien, was diese zum wichtigsten Mittel dermittelalterlichen Kommunikation macht.
Ein weiteres Kennzeichen von Zeremonien ist ihr formalisierter Charakter: Um einen Überblick über die vielen Regeln zu behalten, wurden im Laufe der Zeit normative Texte mit Anweisungen verfasst, vergleichbar mit dem heutigen Protokoll bei Staatsempfängen.
Sowohl religiöse Rituale als auch säkulare Zeremonien setzen sich vom alltäglichen Leben ab: Sie finden oft an speziellen Orten und unter Verwendung bestimmter symbolträchtiger Gegenstände und Kleidungsstücke statt. Im Fall des Ritterschlags von Friedrich III. war der spezielle Ort die Engelsbrücke in Rom, der symbolträchtige Gegenstand das vermeintliche Schwert Karls des Großen und die bestimmte Kleidung das aufwendige Krönungsornat. Der „entscheidende zeremonielle Vorgang“ bei dieser kaiserlichen Rittererhebung war die „körperliche Berührung (im ‚Ritterschlag’)“, die die faktische Verleihung der Ritterwürde bedeutete[52] und eine rechtliche Statusveränderung für den Promovierten nach sich zog.
In der soziologischen Terminologie handelt es sich beim Ritterschlag eindeutig um eine säkulare Zeremonie. Trotz allem verwenden Nicht-Soziologen die Begriffe Ritual und Zeremonie oft synonym. So kann es vorkommen, dass Historiker, die über die Thematik der Ritterpromotion schreiben, im selben Werk einerseits von einem „bestimmten Ritual“, durch das ein Mann zu einem Ritter gemacht wird,[53] und andererseits von der „Zeremonie der Schwertleite“[54] reden.
5. Die Auswirkungen des Ritterschlags
Auch wenn die Forschung den Ritterschlag von Friedrich III. auf der Engelsbrücke überwiegend als unwichtig ansieht, hatte er eine ganze Reihe von Auswirkungen – für die Zeitgenossen des Habsburgerkaisers, aber auch für die spätere Mittelalterforschung. Im Folgenden wird nun eine Auswahl dieser Auswirkungen präsentiert.
a. Neue Ritter
Die direkteste Auswirkung des Ritterschlags auf der Engelsbrücke sind sicherlich die neu promovierten Ritter. Die Zahlen der Erhebungen weichen sehr stark voneinander ab, je nach Chronist erteilte Friedrich III. zwischen 160 und 400 Männern den Ritterschlag.[55]Im anonymen Romzugsbericht (Ps-Enenkel)[56]und in Piccolominis „Historia Austrialis“[57]ist jeweils von 300 Promotionen die Rede, was Historiker wie Rill und Koller übernahmen. Achim T. Hack verglich hingegen alle erhaltenen Chroniken und fand einen Bereich von fünf sehr nah beieinander liegende Zahlen (260, 263, 268, 275, 281), der für ihn eher der Realität entspricht.[58]
Einige junge Adelssöhne nützen die Gelegenheit des Romzugs, um vom Kaiser persönlich die Ritterwürde zu erhalten.„Von der höchsten weltlichen Person in der ewigen Stadt an einem so denkwürdigen Tage mit einer Würde belehnt zu werden“, war laut Johannes Martens für die Beteiligten eine sehr „hohe Ehre”.[59] Einer dieser jungen Adelssöhne war der schon genannte Andreas von Lappitz. „Da waren vil Pueben auch zu Ritter geschlagen, Ich auch mit“,[60] schrieb er Jahre später in seiner Familienchronik. Lappitz ist der einzige Chronist, der selbst auf der Engelsbrücke zum Ritter geschlagen wurde und an seinem Beispiel lassen sich gut die persönlichen Auswirkungen solch einer Promotion aufzeigen: „Die Romreise bedeutete nicht nur eine verbesserte Ausgangsposition für Lappitz’ weiteren Werdegang etwa durch die Möglichkeit einflußreicher Bekanntschaften, sondern durch den Ritterschlag auch eine Erhöhung des Sozialprestiges.“ [61]
Trotz der aufwendigen Zeremonie bedeutete der Ritterschlag auf der Engelsbrücke für die Mehrzahl der Betroffen keine Aufnahme in den Ritterstand – weil sie nämlich schon Ritter waren! Dieses„Phänomen des wiederholten Ritterschlags“[62] tauchte ab Mitte des 15. Jahrhunderts vermehrt auf. [63] Wer nacheinander mehreren Herren diente oder mehreren Orden angehörte, konnte mehrmals mit der Ritterwürde ausgezeichnet werden. Auch vor oder nach Schlachten wurden oft alle Kämpfer auf einmal in den Ritterstand erhoben, ohne vorher nachzuprüfen, wer schon Ritter war. [64]
Wie sich zeigt, war„die ursprüngliche Funktion des Ritterschlags als Aufnahmeritus“[65] beim Ritterschlag auf der Engelsbrücke nicht mehr gegeben. Das Hauptziel dieser Massenpromotion war also nicht die Schaffung neuer Ritter. Wichtig war stattdessen die Zeremonie an sich – alsAusdruck monarchischer Repräsentation und kaiserlicher Macht!
b. Prestige
„Es ist jedenfalls nicht zu übersehen, dass Friedrich in Rom [politisch] wenig erreichte“,[66] resümiert Heinrich Koller. Auch Johannes Martens schließt sich seinem Urteil an, beide finden dann aber doch noch einen positiven Aspekt des Italienzugs: Friedrichs erhöhtes Prestige. „So gering die Bedeutung des Zuges war, so groß war der dabei entfaltete Pomp“,[67] schreibt Martens und über hundert Jahre später ergänzt Koller: „Diese umfangreichen Feierlichkeiten waren Anlass für eine Prunkentfaltung, von der die Allgemeinheit begeistert war. Der Kaiser nützte die Gelegenheit, den Glanz des Hauses Österreich hervorzuheben, […] Friedrich war damit in Rom als Herr der Welt, seine Familie als Träger und Garant imperialer Macht vorgestellt worden.“[68]
Alle Ritter und Adligen, die Friedrich III. begleiteten, waren in voller Rüstung und boten laut dem in erster Reihe stehenden Piccolomini einen beeindruckenden Anblick: „ Undique viri, arma, equi, vexilla pariter oculos astantium in se convertere.“[69]
Bei Friedrichs Krönung zum Kaiser im Petersdom waren vor allem hochrangige Männer anwesend, Knappen und das einfache Volk sahen von der langwierigen Zeremonie nur wenig. Gerade deswegen war der anschließende Festzug durch Rom, der seinen Höhepunkt auf der Engelsbrücke fand, umso wichtiger.Friedrich III. nutzte den Ritterschlag am Tiberufer geschickt, um sich und sein Kaisertum in Szene zu setzen: Er präsentierte sich als „erster Ritter im Reich“ und bezog so sein Gefolge in die „monarchische Repräsentation“ mit ein.[70]
c. Ritterschlagslisten
Im Zuge der Kaiserkrönung von Friedrich III. wurden erstmals Listen über neupromovierte Ritter während eines Romzuges erstellt. Dabei handelt es sich um zwei Ritterschlagslisten, die die Erhebungen auf der Engelsbrücke dokumentieren. Beide Listen sind sich in ihrer Textstruktur sehr ähnlich, haben aber komplett unterschiedliche Funktionen.
Die „Ordnung die ritter zu vordorn vnd zu schlahen“[71] ist ein Namensverzeichnis, das im Vorhinein geschrieben wurde und normativ darüber Auskunft gibt, wer zum Ritter geschlagen werden sollte. Am Tag nach Kaiserkrönung und Massenpromotion wurden das Datum und einige Namen hinzugefügt, was aus der Ordnung ein bestätigendes Dokument macht.
Für die Forschung interessanter ist die zweite Liste[72], die erstmals „den Usus [erwähnt], die neuen Ritter in einer Liste zu verzeichnen.“[73] Wie sich schon im Titel zeigt, geht es hier um das Dokumentieren einer bereits vollzogenen Zeremonie: „Das sind die Fürsten, Grauen und H[er]n, die der Keÿser zu Rittern geslagen hat An dem tag, als er die Keÿserlichen Kron empfieng auf der Teÿfferbrugk.“[74]
Es lässt sich schwer sagen, ob alle aufgeschriebenen Männer auch wirklich zu Rittern geschlagen wurden. Insgesamt stehen nur zirka 200 Namen auf beiden Listen, die außerdem nicht zu hundert Prozent übereinstimmen.[75] Eine Erklärung für die unterschiedlichen Zahlen
– auch im Vergleich zu den bereits erwähnten Chroniken – findet sich im Nachsatz der zweiten Liste: „Vnd vil teutscher edelleuwt die sich nit schreiben haben lassen.“[76] Seinen Namen aufschreiben zu lassen, war demnach also freiwillig. Dazu passt eine Theorie von Achim T. Hack, der in seiner Analyse der Ritterschlagslisten darauf hinweist, dass die Listen
auch politisch zu deuten sind: als schriftlicher Beweis der Unterstützer Friedrichs III.[77]
Vor Beginn des Romzugs hatte die ständische Opposition im österreichischen Landtag von Friedrich die Herausgabe seines Mündels Ladislaus Postumus[78] gefordert, auf einer entsprechenden Bündnisurkunde finden sich 254 Unterschriften.[79] Außerdem nahmen sehr viele hohe Adlige und Stadtvertretungen (unter dem Vorwand, der Termin sei zu kurzfristig bekannt gegeben worden) nicht an der Krönungsreise nach Rom teil. Demgegenüber sind die Ritterschlagslisten von „Friedrichs Romzug gewissermaßen das Register seiner Getreuen und ein Ausweis ihrer Loyalität gegenüber dem Habsburger.“ [80]
Da die zweite nach der Massenpromotion geschriebene Liste geographisch sortiert ist, sieht Hack sie außerdem als „bemerkenswertes und unmittelbares Zeugnis für den Wirkungsbereich des deutschen Königtums um die Mitte des 15. Jahrhunderts.“[81] Nicht nur deswegen sind Ritterschlagslisten so spannend für die Forschung über Schriftlichkeit. Von Jerusalemzügen zum Heiligen Grab existieren schon länger Namensverzeichnisse über die neuen Ritter, aber von keinem der früheren Romzüge sind Personenlisten überliefert.[82] Die Ritterschlagslisten von 1452 haben also eine „Vorreiterrolle“ und sind Ausdruck der „zunehmenden Bedeutung listenartiger zeremonieller Aufzeichnungen“ in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.[83] Bei der Kaiserkrönung von Maximilian I. 1468 in Aachen war „die Textgattung Ritterschlagsliste”, wie Hack schreibt, dann „vollständig etabliert.“[84]
d. Weiterentwicklung zum normativen Text
Nicht nur die Ritterschlagszeremonie an sich hatte eine Vielzahl von Auswirkungen, sondern auch die Chroniken, die darüber berichteten. 1488 schrieb der päpstliche Zeremonienmeister Agostino Patrizi de’Piccolomini die „Cæremoniale Romanum“, eine normative Ordnung für Herrscherempfänge.[85] Der päpstliche Zeremonienmeister war lange Zeit Teil des engsten Gefolge von Eneas Silvius Piccolomini und nahm sogar dessen Namen an.[86]
Über Jahrzehnte hinweg war das Zeremoniell im Umgang mit Papst und Kaiser in Rom nicht aufgeschrieben, sondern nur mündlich weitergegeben worden. Dadurch entstanden immer wieder Unsicherheiten, Verwechslungen und sogar Streitereien, denen Agostino durch eine klare „Festlegung der Zeremonien“ ein Ende setzen wollte.[87] Seine „Cæremoniale Romanum“ wurde zu einem der wichtigsten Texte des Papsttums und jahrhundertelang nicht nachbearbeitet. Für die Kapitel über Königseinholung und Kaiserkrönung verwendete Agostino die „Historia Austrialis“ – durch die Beschreibungen von Eneas Silvius Piccolomini fand Friedrichs III. „Ritterschlagszeremonie […] sogar Eingang in die normative Literatur.“[88]
e. Zeitgenössische Kritik
Trotz der Bedeutung, die die Augenzeugen dem Ereigniss beimaßen, kritisierten sie einzelne Aspekte der Zeremonie. Im Folgenden werden die zwei wichtigsten Kritikpunkte vorgestellt.
i. Unwürdigkeit der Teilnehmer
Nicht nur junge Adlige erhielten auf der Engelsbrücke den Ritterschlag, auch einige bürgerliche Romzugsteilnehmer (wie die BaslerBernhard Sürlin und Bernhard von Efringen)wurden von Friedrich III. promoviert.[89]Darauf bezugnehmend klagt Andereas von Lappitz inseiner Beschreibung der Ereignisse auf der Engelsbrücke: „Ihr vil wurden geschlagen die nit galten und nimmer fůerten.“[90] Für Lappitz erfüllt der Ritterschlag seinen moralischen und politischen Zweck nicht mehr, vor allem die niedrige Herkunft von vielen Promovierten kritisiert der junge Adlige.[91] Lappitz fühlte sich den unteren Schichten überlegen und schrieb seine Familienchronik aus einem klaren Standesbewusstsein heraus: Bei der Beschreibung seines Herrn Erasmus von Wildhaus betont er, dass dieser aus „guetes alts Gschlecht“[92] war, an anderer Stelle schimpft er die Bürger von Bologna Bauern, weil sie Friedrich III. keinen gebührenden Empfang bereiten.[93]
Der zweite, noch weitaus schärfere Kritiker der Ereignisse war Eneas Silvius Piccolomini, seine „Historia Austrialis“ ist voll von „zeitkritischer Tendenz“.[94] Piccolomini beschreibt den Ritterschlag auf der Engelsbrücke in wenigen Zeilen, hängt dann aber eine ausführliche Kritik an, die sich gegen die unwürdigen Teilnehmer wendet:
„Sed nos hodie delicatos et in plumis nutritos, qui nudatum ensem
nunquam | vident, quin et infantes in cunis iacentes militaribus decoramus honoribus. Quid, quod homines docti atque inter litteras educati, qui se debili corpore et animo pavido sciunt, sumere insignia militiæ non verentur?“[95]
Einige der Neu-Promovierten hält er zwar für kriegserfahrene Männer, aber Piccolomini beurteilt die Mehrheit der neuen Ritter als ungeeignet. Dabei legt der „Berater und Freund“[96] Friedrichs III. allerdings Wert darauf, klarzustellen, dass sich seine Kritik nicht gegen den Kaiser, sondern gegen die Irrtümer seiner Zeit richtet.[97] In einer langen Liste zählt Piccolomini anschließend auf, was Männer seiner Ansicht nach geleistet haben müssen, um die Ritterwürde zu erhalten (einem Bürger das Leben retten, einen Feind töten, eine Mauer übersteigen, einen Graben überspringen, uvm.),[98] wobei er Motive aus dem mittelalterlichen Ritterethos mit dem antiken Soldatenethos vermischt.
Piccolominis Kritik ist zu Teilen sicher berechtigt – Friedrich III. verlieh im weiteren Verlauf des Italienzugs sogar einem einjährigen Säugling die Ritterwürde – „dennoch lässt sich nicht ganz der Eindruck vermeiden, daß aus den Worten des Enea auch der Neid eines Klerikers spricht, der die ritterlichen Auszeichnungen selbst nicht erhalten kann.“[99] Als Papst Pius II. machte er in späteren Jahren jedenfalls eine radikale Kehrtwendung und promovierte so viele Männer, dass manche Forscher sein „Pontifikat als Höhepunkt päpstlicher Ritterernennungen“ bezeichnen.“[100]
Friedrich III. war nicht der erste Kaiser, bei dem neue Ritter kritisiert wurden. Die Problematik von Massenpromotionen zeigte sich schon bei Kaiser Sigismund: 1434 wurde einigen der Bürger, die er nach seiner Krönung zu Rittern geschlagen hatte, die Teilnahme an einem Turnier in Nürnberg verweigert, „denn es war mittlerweile bekannt geworden, wie Sig[is]mund die Würde verschleuderte.“[101] Im Hintergrund dieser Kritik sieht Achim T. Hack auch das erstmalige Auftauchen von Ritterschlagslisten bei Friedrich III., um jegliche „Zweifel am Rittertum der Neupromovierten“ von vorneherein auszuschließen.[102]
ii. Karlsfrömmigkeit
Fast alle Chronisten schreiben die in der Krönung und beim Ritterschlag von Friedrich III. verwendeten Herrschaftszeichen Karl dem Großen zu: „Der Khayser schlueg die Ritter mit dem Schwerdt, das Khayser Carl vom Himmel khumen ist,“schreibt zum Beispiel Andreas von Lappitz.[103] Im anonymen Romzugsbericht (Ps-Enenkel) heißt es:„geschlagen wurden mit dem hailigen des kaiser Carls swert, das der Engel gotz […] von himel hatt pracht.“[104]
Die Reichskleinodien, die 1452 extra für die Kaiserkrönung aus Nürnberg nach Rom gebracht wurden, wurden vom Volk gemeinhin für Karlsinsignien gehalten, ein „Gerücht, dem im Mittelalter durchaus der Status einer Tradition zugemessen werden konnte.“[105] Für die Chronisten verstärkte sich durch die (vermeintliche) Verwendung des Schwerts von Karl dem Großen die„besondere Würde“[106] des Ritterschlags auf der Engelsbrücke 1452.
Einzig Eneas Silvius Piccolomini schloss sich der Begeisterung nicht an. Er hätte Friedrich III. lieber in seinem modernen Privatornat gesehen[107] und ist außerdem davon überzeugt, dass das verwendete Schwert nicht von Karl dem Großen, sondern von Karl IV. stammte:
„Verum mihi singula exactius contemplanti, cum ensem inspexi, non Magni illius primique Caroli, sed quarti visus est, qui Sigismundi genitor fuit. Nam leo Bohemicus sculptus in eo visebatur, quo ille tanquam rex utebatur Bohemiæ.“[108]
Piccolomini unterzieht aber nicht nur das Schwert einer quellenkritischen Betrachtung, sondern kritisiert auch stark den Volksglauben, der an der Idee vehement festhielt:
„In plebe tamen rumor mansit Magni Caroli ornamenta fuisse. Ingens enim tanti viri fortuna etiam sua vult esse, quæ sunt aliorum Carolorum, quemadmodum Thebanus Hercules aliorum sui nominis virorum facta illustria ad sese trahit et Iulii Cæsaris multa dicuntur, quæ post eum alii | cæsares petravere.“[109]
Lucas Burkart, der Piccolominis Kritik einen eigenen Aufsatz gewidmet hat, ist von der Analyse des Humanisten begeistert: „Der kritische Blick den Enea Silvio Piccolomini auf die letzte in Rom vollzogene Kaiserkrönung richtete, zerstört nicht nur ein Geschichtsbild, indem er eines der zentralen politischen Rituale mittelalterlicher Herrschaftsgeschichte dekonstruierte, sondern konstruierte zugleich ein neues Bild von Geschichte, indem er die Interaktion von Vergangenheit und Geschichte neu anordnete.“ [110]
Knapp zwanzig Jahre zuvor hatte Lorenzo Valla erstmals ein Dokument (die konstantinische Schenkung) „sprachkritisch als Fälschung entlarvt.“[111] Piccolominis Analyse bezieht sich nun nicht mehr nur auf einen Text, stattdessen „verwandelt [er] […] ehemals machtvolle Zeichen und Gesten in decorum.“ [112] Dabei lieferte der spätere Papst ein sehr frühes und bedeutendes Beispiel für Traditionskritik und die historische Kritik mittelalterlicher Herrschaftszeichen.
Tatsächlich verwendete Friedrich III. für den Ritterschlag auf der Engelsbrücke das staufische Zeremonienschwert, das 1220 in Palermo hergestellt wurde.[113] Es wurde zwar nicht von Karl IV. in Auftrag gegeben, sondern lediglich am Knauf überarbeitet,[114] trotzdem hatte Eneas Silvius Piccolomini mit seiner Karlsinsignienkritik recht. Problematisch ist nur, dass er seine Erkenntnisse „stillschweigend und wohl auch wider besserers Wissen auf den gesamten Ornat“ übertrug[115] und alle Stücke Karl IV. zuordnete.[116] Nur wegen des Schwerts alle Insignien in die Zeit von Karl IV. zu datieren, muss sich Piccolomini „als schwerwiegenden methodischen Fehler ankreiden lassen.“ [117]
f. Unfreiwillige Erhebung
Abschließend soll es noch um eine letzte Auswirkung gehen, die sich zwar nicht im Umfeld von Friedrichs III. Ritterschlag auf der Engelsbrücke ereignete, aber trotzdem berichtenswert ist: die unfreiwillige Erhebung. Wie bereits erwähnt, schlug Friedrich auf seinem gesamten Italienzug wiederholt Ritter, darunter auch den Mailänder Gesandten Niccolò Arcimboldi.[118]
Am 18. Mai 1452 schickte Arcimboldi eine Depesche an den mit Friedrich III. verfeindeten Herzog Sforza, in der er beschreibt, wie er gegen seinen Willen zum Ritter geschlagen wurde:
„Der Kaiser ernannte viele Ritter, unter welchen er auch mich hervorrufen liess, nachdem mir diesen Morgen war gesagt worden, der Kaiser würde gerne sehen, dass ich die Ritterschaft mit vielen anderen ausgezeichneten Herren und Edelleuten annähme. Obgleich ich mich entschuldigte, konnte ich in jenem Gewirre nicht entrinnen und liess mich durch den Kaiser mit dem Schwerte schlagen, indem ich mich allerdings nicht darauf verstehe, andere zu schlagen, ebensowenig, wenn immer möglich mich der Gefahr aussetzen möchte, von anderen mit dem Schwerte geschlagen zu werden.“ [119]
Es ist natürlich fraglich, ob der Diplomat wirklich nicht zum Ritter erhoben werden wollte oder ob er sich nur gezwungen sah, sich aus politischen Gründen vor seinem Fürsten zu rechtfertigen. In der Forschung wurde Arcimboldis Depesche ironisch interpretiert: Lorenz Böninger nennt das Schreiben „die Gelegenheit eines witzigen Kommentars” [120] und Achim T. Hack spricht vom „Spott des Verfassers” , bevor er dann doch noch auf die „Zwangslage des Diplomaten”, der in der Auseinandersetzung zwischen Sforza und Friedrich III. gefangen war, eingeht. [121]
Auch schon früher gab es Fälle von Bürgern, die etwas dagegen hatten (von einem Kaiser) in den Ritterstand erhoben zu werden. Florenz verbat zum Beispiel seinen Botschaftern Gunstbeweise von Kaiser Karl IV. – und dazu gehörte auch die Ritterwürde – anzunehmen.[122] Zu Zeiten Friedrich III. sah die Kommune das Kaisertum allerdings nicht mehr als Bedrohung, „so daß selbst Florenz entgegen aller offiziellen Verlautbarungen ‚erlauben’ konnte, daß der Kaiser im Februar 1452 im Dom von Florenz drei Bürger (wenn auch keineswegs bedeutende) zu milites erhob.”[123]
6. Zusammenfassung und Fazit
Der gesamte Romaufenthalt von Friedrich III. und besonders der Tag der kaiserlichen Krönung, der 19. März 1452, sind eine Aneinanderreihung von Zeremonien und Ritualen.
Wie sich in dieser Arbeit gezeigt hat, hatte Friedrichs III. Ritterschlag auf der Engelsbrücke eine Vielzahl von Auswirkungen. Als erstes kam es zur Schaffung von neuen Rittern, auch wenn diese nicht das Ziel der Massenpromotion war. Neben einer Ehrung für die loyalen Gefolgsleute des Habsburgers war der Ritterschlag auf der Engelsbrücke vor allem eine Präsentation der kaiserlichen Würde und Macht. Um das Prestige von sich und seinem Geschlecht zu erhöhen, nutze Friedrich III. geschickt die Öffentlichkeit und bezog sein Gefolge in die monarchische Repräsentation mit ein. Die große Anzahl an Beobachtern sorgte dafür, dass sich die Kunde über die Ereignisse des 19. März 1452 rasch im ganzen Reich verbreitete und legitimierte außerdem durch ihre Zeugenschaft alle vollzogenen Handlungen.
Der Ritterschlag am Tiberufer war eine formalisierte Aufnahmezeremonie, bei der eine Vielzahl von Regeln beachtet werden musste. Umso passender ist es, dass eine Beschreibung davon Eingang in die normative „Cæremoniale Romanum“ von Agostino Patrizi de’Piccolomini nahm. Die ganze Zeremonie war außerdem eines der „bemerkenswerte[sten] Zeugnisse für die weit verbreitete Karlsfrömmigkeit des 15. Jahrhunderts.“[124] Gleichzeitig war die Massenpromotion aber auch Auslöser für eine ganze Reihe von zeitgenössischer Kritik – an eben jener Karlsfrömmigkeit und an der Unwürdigkeit der Teilnehmer.
Für die moderne Forschung ist vor allem das Auftauchen von Ritterschlagslisten als historischem Dokument bedeutend. Die Listen nahmen nicht nur eine Vorreiterrolle in der späteren habsburgerischen Verwaltung ein, sondern wurden so oft überliefert, dass man von einem „grundlegendem Funktionswandel“ von der „pragmatischen hin zu einer dokumentarischen Bedeutung“ sprechen kann.[125]
Noch bedeutender für die Geschichtsschreibung war die erstmalige Anwendung von historisch-kritischen Methoden durch Eneas Silvius Piccolomini. Seine humanistische Geschichtsschreibung und seine Kritik an mittelalterlichen Herrschaftszeichen und Traditionen sorgte für ein „erhöhtes Bewusstsein der Geschichtlichkeit der eigenen Epoche“.[126] Beachtlich ist aber auch, dass sich nicht nur der gebildete Piccolomini, sondern mit Andreas von Lappitz auch ein einfacher Adliger kritisch gegenüber dem Ritterschlag äußerte.
Alle in dieser Arbeit beschriebenen Chroniken sind für die Mittelalterforschung bedeutende Darstellungen des schwindenden Rittertums. Wie sich – gerade auch an der Kritik über die Unwürdigkeit der Teilnehmer – gezeigt hat, war das Rittertum im 15. Jahrhundert längst nicht mehr das ritterlich-höfische Idealgebilde des 11., 12. oder 13. Jahrhunderts.Ein Ritterschlag, noch dazu ein kollektiver Ritterschlag, war trotz allem auch im Spätmittelalter etwas Besonderes: ein öffentlichkeitswirksames, repräsentatives Ereignis, das sich sehr stark vom mittelalterlichen Alltag unterschied. Im Verlauf des ersten Italienzuges von Friedrich III. kam es im Jahr 1452 allerdings in jeder größeren Stadt zu feierlichen Rittererhebungen und Massenpromotionen. Der Ritterschlag auf der Engelsbrücke ist also eigentlich nur der Höhepunkt „einer Reihe prinzipiell gleichartiger Zeremonien.“ [127]
Was ihn so besonders und bedeutend macht, ist die Tatsache, dass er so oft und so detailliert von Augenzeugen beschrieben wurde, wodurch der Ritterschlag auf der Engelsbrücke zu einem der bestbezeugtesten Ereignisse des Mittelalters wurde. Auch wenn – abgesehen vom Prestigegewinn und der Ehrung seiner Gefolgsleute – viele der in dieser Arbeit beschriebenen Auswirkungen nicht direkt von Kaiser Friedrich III. intendiert waren, ist doch alles was im Umfeld des Ritterschlags passierte und entstand, Aufforderung an die moderne Forschung, sich mehr mit dem Ereignis zu beschäftigen. Noch Generationen später brüsteten sich Familien damit, dass ihre Vorfahren von Friedrich III. höchstpersönlich die Ritterwürde erhielten. (Oder fälschten, wie im Fall desJob Hartmann Enenkel,Dokumente, um zumindest den Anschein zu erzeugen, einem Familienmitglied wäre diese besondere Ehre widerfahren.) All das spricht klar dagegen, dass Friedrichs III. Ritterschlag auf der Engelsbrücke im März 1452 eine Zeremonie war, „diein keiner Beziehung mehr irgend welchen Wert hatte.“ [128]
7. Quellen
Anonymer Romzugsbericht (Ps-Enenkel). In: Achim T. Hack (Hrsg.): Ein anonymer Romzugsbericht von 1452 (Ps-Enenkel). Mit den dazugehörigen Personenlisten (Teilnehmerlisten, Ritterschlagslisten, Römische Einzugsordnung). Stuttgart 2007, S. 81-98 (Romzugsbericht), S. 128-132 (Ritterschlagsliste A), S. 133-136 (Ritterschlagsliste B).
Piccolomini, Eneas Silvius: Historia Austrialis. Buch IIII. 2./3. Redaktion, bearb. von Martin Wagendorfer. Hannover 2009. (= Monumenta Germaniae Historica. Scriptores Rerum Germanicarum. Nova Series; XXIV)
Lappitz, Andreas von: Fragment einer Familienchronik. In: Johann Wilhelm von Wurmbrand (Hrsg.): Collectanea genealogico-historica, ex archivo inclytorum Austriae inferioris statuum, ut et aliis privatis scriniis, documentisque originalibus excerpta. Wien 1705, S. 63-68.
8. Literaturverzeichnis
Beattie, J. H. M.: Kingship In: David L. Sills (Hrsg.): International Encyclopedia of the Social Sciences. Volume 8. New York 1968, S. 386-389.(Gale Virtual Reference Library, letzter Aufruf 29. Juni 2012).
Burkart, Lucas: Schatzinszenierungen: Die Verwendung mittelalterlicher Schätze in Ritual und Zeremonie. In: Edgar Bierende, Sven Bretfeld, Klaus Oschema (Hrsg.): Riten, Gesten, Zeremonien. Gesellschaftliche Symbolik in Mittelalter und Früher Neuzeit. Berlin und New York 2008, S. 253-288.
Burkart, Lucas: Der kritische Blick, oder: Enea Silvio Piccolomini schildert die letzte Kaiserkrönung in Rom am 19. März 1452. In: David Ganz und Thomas Lentes (Hrsg.): Sehen und Sakralität in der Vormoderne. Berlin 2011, S. 120-132.
Böninger, Lorenz: Die Ritterwürde in Mittelitalien zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit. Berlin 1995.
Davis-Floyd, Robbie: Rituals. In: William A. Darity, Jr. (Hrsg.): International Encyclopedia of the Social Sciences. Volume 7. Detroit 2008, S. 259-264.(Gale Virtual Reference Library, letzter Aufruf 29. Juni 2012).
Gregorovius, Ferdinand: Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Vom V. bis zum XVI. Jahrhundert.Band III, 1, Dreizehntes Buch,barb. v. Waldemar Kampf. Darmstadt 1978.
Hack, Achim Thomas: Das Empfangszeremoniell bei mittelalterlichen Papst-Kaiser-Treffen. Köln, Weimar, Wien 1999. (="Forschungen" zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii; 18).
Hack, Achim Thomas: Der Ritterschlag Friedrichs III. auf der Tiberbrücke 1452. In: Nikolaus Staubach (Hrsg.): Rom und das Reich vor der Reformation. Frankfurt am Main 2004, S. 197-236.
Hack, Achim Thomas: Ein anonymer Romzugsbericht von 1452 (Ps-Enenkel). Mit den dazugehörigen Personenlisten (Teilnehmerlisten, Ritterschlagslisten, Römische Einzugsordnung). Stuttgart 2007.
Hammes, Barbara: Ritterlicher Fürst und Ritterschaft. Konkurrierende Vergegenwärtigung ritterlich-höfischer Tradition im umkreis südwestdeutscher Fürstenhöfe 1350-1450. Stuttgart 2011.
Hechberger, Werner: Adel, Ministerialität und Rittertum im Mittelalter. München 2004.
(= Enzyklopädie deutscher Geschichte Band 72, hrsg. v. Lothar Gall).
Keen, Maurice: Das Rittertum. München und Zürich 1987.
Koller, Heinrich: Kaiser Friedrich III. Darmstadt 2005.
Krieger, Karl-Friedrich: Die Habsburger in Mittelitalien. Von Rudolf I. bis Friedrich III. Stuttgart 2004
Leach, Edmund R.: Ritual. In: David L. Sills (Hrsg.): International Encyclopedia of the Social Sciences. Volume 13. New York 1968, S. 520-526. (Gale Virtual Reference Library, letzter Aufruf 29. Juni 2012).