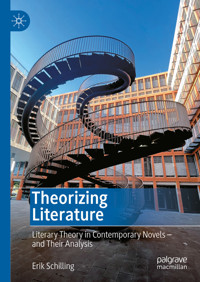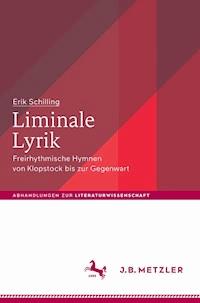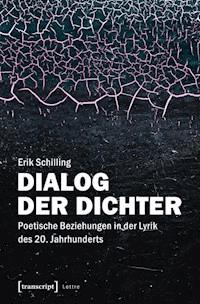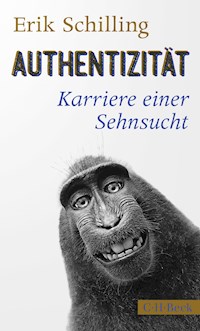
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Authentizität ist das Schlagwort der Stunde, die Sehnsucht der Gegenwart. Politiker sollen authentisch auftreten. Romane erzählen ungefiltert vom wahren Leben. Und im Dasein des Individuums verspricht Authentizität unverfälschtes Glück. Aber was ist der Preis? Erik Schilling beschreibt glänzend und pointiert, wie sich der Authentizitätskult in unserer Gesellschaft entwickelt hat und wieso er umschlägt in einen Verlust von Pluralität, Toleranz und Freiheit.
Das Streben nach Authentizität hat die Gegenwart erfasst. Wonach wir uns dabei sehnen, sind Wahrheit, Eindeutigkeit, Übersichtlichkeit und Kontrolle. Doch die Schattenseiten bleiben meistens unbemerkt. Wollen wir unsere Chefinnen und Minister wirklich unverstellt erleben – oder nicht lieber professionell? Wenn wir immerzu nach unserem ‹wahren Ich› suchen, wo bleibt dann die Lust an der Veränderung und den Ambivalenzen des Lebens? Und wem wollen wir die Deutungshoheit darüber geben, was ‹authentisch› deutsch sei? Erik Schilling geht dem Aufstieg des Authentizitätskults in Gesellschaft und Kultur nach und zeigt, dass seine Dominanz nicht nur zu langweiliger Kunst, laienhaften Politikern und unglücklichen Menschen führt, sondern auch zu Intoleranz und Spaltung. Indem er der Sehnsucht nach Authentizität auch philosophisch den Boden entzieht, plädiert er für ein freieres Verhältnis zu den Widersprüchen, mit denen die Welt und wir alle behaftet sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Erik Schilling
AUTHENTIZITÄT
Karriere einer Sehnsucht
C.H.Beck
ZUM BUCH
Authentizität ist das Schlagwort der Stunde, die Sehnsucht der Gegenwart. Politiker sollen authentisch auftreten. Romane erzählen ungefiltert vom wahren Leben. Und im Dasein des Individuums verspricht Authentizität unverfälschtes Glück. Aber was ist der Preis? Erik Schilling beschreibt glänzend und pointiert, wie sich der Authentizitätskult in unserer Gesellschaft entwickelt hat und wieso er umschlägt in einen Verlust von Pluralität und Freiheit.
Wenn wir nach Authentizität streben, sehnen wir uns nach Wahrheit, Eindeutigkeit, Übersichtlichkeit und Kontrolle. Doch wollen wir unsere Chefinnen und Minister wirklich unverstellt erleben – oder nicht lieber professionell? Wenn wir immerzu nach unserem ‹wahren Ich› suchen, wo bleibt dann die Lust an der Veränderung und den Ambivalenzen des Lebens? Und wem wollen wir die Deutungshoheit darüber geben, was ‹authentisch› deutsch sei? Erik Schilling geht dem Aufstieg des Authentizitätskults in Gesellschaft und Kultur nach und zeigt, dass seine Dominanz nicht nur zu langweiliger Kunst, laienhaften Politikern und unglücklichen Menschen führt, sondern auch zu Intoleranz und Spaltung. Indem er der Sehnsucht nach Authentizität auch philosophisch den Boden entzieht, plädiert er für ein freieres Verhältnis zu den Widersprüchen, mit denen die Welt und wir alle behaftet sind.
ÜBER DEN AUTOR
Erik Schilling lehrt Neuere deutsche Literatur und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er hat in München, Pavia, Salamanca und Stanford studiert und in Harvard und Oxford geforscht. 2020 wurde er mit dem Heinz Maier-Leibnitz-Preis der DFG ausgezeichnet. Er ist Mitglied der Jungen Akademie an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Leopoldina.
INHALT
ECHT – EHRLICH – WAHR: AUTHENTIZITÄT ALS SEHNSUCHT DER GEGENWART
Fünf Thesen zur Authentizität
Die Karriere des Authentischen
Die Willkür des Authentischen
Authentizität als Sehnsucht nach Wahrheit
Authentizität als Sehnsucht nach Übersichtlichkeit
Authentizität als Sehnsucht nach Kontrolle
Ist Authentizität erstrebenswert?
Ein Liberalitätsparadox
Die Alternativen: Professionalität, Situativität, Ambiguität
Welcher Lesertyp sind Sie?
WESEN ODER WIRKUNG?BEGRIFFLICHES ZU AUTHENTIZITÄT
Intersubjektive Authentizität
Subjektive Authentizität I: Wesen
Subjektive Authentizität II: Erfahren
Subjektive Authentizität III: Sprechen
Authentizität: Eine neue Definition
Gegenargument I: Erwartungsbruch
Gegenargument II: Relative Stabilität
Authentizität als Konstrukt
Authentizitätsindikatoren und Authentizitätskonventionen
Was verbindet Juristen und Walfänger?
WAHRE GESCHICHTEN?AUTHENTIZITÄT IN LITERATUR UND KULTUR
Wie jammert ein Mann?
Bin ich gar nicht der Typ, den jeder in mir sieht?
Wie werde ich schwul?
Wie war es wirklich?
Würde ich der SS beitreten?
Ist Christian Kracht ein Nazi?
Was ist der nackte Wahnsinn?
Kann man ‹unpolitisch› sein?
Was passiert vor dem Denken?
Warum schauen Intellektuelle nicht RTL II (oder doch)?
ECHTE POLITIKER?AUTHENTIZITÄT IN DER GESELLSCHAFT
Wie viele Körper hat Angela Merkel?
Können Affen Selfies machen?
Ist Donald Trump real?
Sind Fakten Fakten?
Gibt es ‹Fake News›?
Sind Facebook, Instagram und Twitter authentisch?
Welche Funktion hat der Rechtsstaat?
Gab es das nicht alles schon einmal?
Wer sind die Urenkel der Nihilisten?
Was verbindet Eigentlichkeit und Metaphysik?
EHRLICHE MENSCHEN?AUTHENTIZITÄT IM VERHALTEN DES INDIVIDUUMS
Wann ist ein Mann ein Mann?
Wann ist ein Mensch ein Mörder?
Wie wird man, was man ist?
What is the Question of Nigga Authenticity?
Bin ich Teil meiner Generation?
Wie authentisch ist mein Porno-Konsum?
Wozu dienen Körperflüssigkeiten?
Was ist der Wert des Verborgenen?
Wie schreibe ich einen Roman aus der Perspektive einer Frau?
Bedarf es einer Authentizitätsquote?
VON DER LUST AN DER MASKE:PLÄDOYER FÜR PLURALITÄT
Authentizität versus Pluralität
Handeln statt Sein
Alternativkonzept I: Professionalität
Alternativkonzept II: Situativ angepasstes Verhalten
Alternativkonzept III: Ambiguitätstoleranz
Das Rätsel der Freiheit
DANK
ANMERKUNGEN
Echt – Ehrlich – Wahr: Authentizität als Sehnsucht der Gegenwart
Wesen oder Wirkung?Begriffliches zu Authentizität
Wahre Geschichten?Authentizität in Literatur und Kultur
Echte Politiker? Authentizität in der Gesellschaft
Ehrliche Menschen?Authentizität im Verhalten des Individuums
Von der Lust an der Maske:Plädoyer für Pluralität
PERSONENREGISTER
ECHT – EHRLICH – WAHR: AUTHENTIZITÄT ALS SEHNSUCHT DER GEGENWART
Authentizität ist die Sehnsucht unserer Gegenwart: «Was steckt hinter den vielen Gesichtern des Schauspielers Lars Eidinger?», wollte das Bahn-Magazin DB mobil im März 2020 wissen. «Wie authentisch darf die Royal Family sein?», zerbrach sich Der Spiegel anlässlich des Rückzugs von Harry und Meghan aus dem britischen Königshaus den Kopf. «Trotz Corona-Ausbruch: Ischgl bleibt authentisch», versicherte die taz den krisenfesten Skifreunden unter ihren Lesern.
Politik, Gesellschaft und Kunst haben längst auf diese Sehnsucht nach Authentizität reagiert: Angela Merkel gewann eine ganze Bundestagswahl mit dem Satz «Sie kennen mich». Donald Trump nutzt Twitter als «way for me to get the truth out». Hannelore Kraft, ehemalige Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, brachte sogar ihr politisches Programm auf den Slogan: «Ich bin authentisch.»[1]
Unzählige Coachings und Seminare werden zu Authentizität angeboten, sei es für bestimmte Bedürfnisse («Authentisch Frau sein», «Authentizität in der Führungsrolle»), sei es für das Leben insgesamt («Echt ist das neue Schön», «authentisch sein, aber richtig!»).[2] Authentisch zu sein, so wird suggeriert, ist in jedem Lebensbereich eine erstrebenswerte Verhaltensweise, die man mit wenigen Tricks aus sich herauskitzeln kann.
Auch die Werbung holt ihre Zielgruppen bei dem Bedürfnis nach Authentizität ab: «Frau verwöhnt, Kinder belustigt, Rasen gemäht … Jetzt ist meine Haut dran», war auf einem Plakat der «Kampagne für authentische Männer» eines Kosmetikherstellers zu lesen. «Kesselblick und Hochgefühl – fürs Leben gern ein Stuttgarter», so behauptet eine Brauerei, für lokale Authentizität zu stehen. Und: «Es gibt sie noch, die guten Dinge», verspricht ein Einzelhandelsunternehmen.[3]
In der Literatur ist es gegenwärtig Mode, zwischen Autor und Erzähler bzw. Protagonist keinen Unterschied zu machen. Wohlmeinende Leser dürfen daher Karl Ove Knausgård dabei zusehen, wie er einige tausend Seiten lang an seinem Leben leidet. Sie dürfen mit Thomas Melle in die Abgründe einer manisch-depressiven Erkrankung abtauchen. Oder von Édouard Louis alles über dessen Leben als Homosexueller in der französischen Provinz erfahren.
Wo wir also noch nicht so ehrlich, unverstellt, aufrichtig sind wie Angela Merkel, Donald Trump oder Hannelore Kraft, da wollen wir es werden, durch Coaching, Konsum oder Lektüre. Der Weg ist flexibel, der Wunsch aber klar: Wir wollen authentisch sein.
Fünf Thesen zur Authentizität
In diesem Buch entwickle ich fünf Thesen, um Authentizität als Phänomen der Gegenwart kritisch zu analysieren:
(1)
Authentizität spielt aktuell eine so große Rolle, dass sie für die Gegenwart als zentrale Sehnsucht zu beschreiben ist. Ihre Karriere belege ich an Beispielen aus dem kulturellen, politischen und sozialen Bereich.[4]
(2)
Der Authentizitätsboom ist eine Reaktion auf eine zunehmende gesellschaftliche Komplexität, bedingt durch Digitalisierung, Globalisierung und die scheinbare Beliebigkeit der Postmoderne.
(3)
‹Authentizität› ist eng verwandt mit Begriffen wie ‹Echtheit›, ‹Eindeutigkeit› und ‹Wahrheit›. Die Rede von Authentizität besitzt daher metaphysische Anklänge.
(4)
Um diese metaphysischen Anklänge zu vermeiden, sollte der Begriff ‹authentisch› nicht essentialistisch (im Sinne von: auf einen ‹wahren Kern› verweisend) verstanden werden. Ein essentialistisches Konzept von Authentizität führt zu Einschränkungen von Pluralität und Ambiguität.
(5)
Eine sinnvolle Definition von ‹Authentizität› bezeichnet daher ausschließlich die Übereinstimmung einer Beobachtung mit einer Erwartung des Beobachters. Wer in diesem Sinne ‹authentisch› sagt, sagt nichts über die beobachtete Person oder Sache aus, nur über seine Erwartung und seine Beobachtung. Diese terminologisch präzisere Definition von ‹Authentizität› vermeidet, dass mit dem Begriff implizite Wertungen und Verabsolutierungen einhergehen.
Im Kern ist dieses Buch somit ein Plädoyer für Freiheit und Toleranz. Es lädt ein, das Leben leicht zu nehmen, Widersprüche im eigenen und fremden Verhalten zu akzeptieren und beim Denken das Interessante in der Unschärfe und der Frage zu sehen, nicht in der Klarheit und der eindeutigen Antwort.
Die Karriere des Authentischen
Das Authentische bedient eine Sehnsucht nach dem Hier und Jetzt, nach dem Greifbaren, dem Realen, dem Echten. In einer Welt, in der wir in wenigen Stunden von Berlin nach Boston, von Paris nach Peking jetten, in der Skype und WhatsApp kommunikative Distanzen aufheben, in der Fakes und Deep Fakes den Glauben an Evidenz erschüttern und künstliche Intelligenz die Grenze zwischen Mensch und Maschine verschwimmen lässt, da wächst der Wunsch nach Realem und/oder Lokal-Greifbarem, an dem man sich festhalten kann.
Das Digitale hat unser Leben in den vergangenen fünfzehn Jahren stärker verändert als die Industrialisierung in den 150 Jahren zuvor. Ich entsperre mit dem Handy das Car-Sharing-Auto vor der Tür, lasse mich von Google zum Bahnhof navigieren und kaufe auf dem Weg vom Auto zum Gleis ein Ticket in der DB-App. Im Hintergrund dieser individuellen Erfahrungen verbinden global angelegte und digital optimierte Lieferketten Rohstoffe, Fabriken und Konsumenten auf unterschiedlichen Kontinenten. All dies ist Zeichen einer digitalen Verfügbarkeit in einer globalisierten Welt, die noch vor zwanzig Jahren undenkbar schien.
Digitalisierung überbrückt Distanzen, erspart es uns, Zeit auf unangenehme Tätigkeiten zu verwenden, ermöglicht bessere Therapien bei Krankheiten, macht Wissen weltweit in Sekundenschnelle verfügbar, verbindet Menschen mit ausgefallenen Hobbys oder Vorlieben und erlaubt auch denjenigen gesellschaftliche Teilhabe, die in ökonomisch schwachen oder abgelegenen Regionen leben. Globalisierung ermöglicht individuelle Mobilität, optimiert den Einsatz von Ressourcen und verbindet unterschiedliche Kulturen.
Einerseits also sind Digitalisierung und Globalisierung ein Geschenk. Andererseits sind wir schlichte Steinzeitmenschen, die zu ihrem Glück nicht mehr brauchen, als – in ein flauschiges Fell gehüllt – mit einigen lieben Menschen am Lagerfeuer zu sitzen und ein leckeres Stück Säbelzahntiger zu braten. In einer digitalen und globalisierten Welt aber läuft das Lagerfeuer auf YouTube, das Fell stammt von Ikea, der Säbelzahntiger von Beyond Meat, und die lieben Menschen sind auf Tinder anwesend, wo sie gemütlich nach links und rechts gewischt werden. In einer solchen Welt verspricht das Streben nach Authentizität Abhilfe. Charles Taylor schlug schon 2007 vor, die Gegenwart als Age of Authenticity zu bezeichnen.[5] Seitdem hat sich die Sehnsucht nach dem Authentischen noch deutlich verstärkt.
Digitalisierung bedeutet ‹Fake›, Globalisierung bedeutet Ungebundenheit. Beides durchaus mit positiven Konsequenzen: Das digitale Lagerfeuer spendet auch denjenigen wohlige Geborgenheit, die sich keinen eigenen Kamin leisten können. Das künstliche Fleisch erspart Tierleid und verringert den CO2-Ausstoß. Die App der Bahn verhindert, dass ich eine halbe Stunde am Schalter anstehen muss, um einen ‹authentischen› Ticket-Kauf zu erleben. Skype, WhatsApp und Co. ermöglichen es mir, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, ohne wochenlang auf die echte Postkarte aus Australien warten zu müssen. Doch weil wir gleichzeitig in der digitalen Zukunft und in der steinzeitlichen Vergangenheit leben, weil wir in unmittelbarer Folge um die Welt reisen und uns über unser kleines Zuhause freuen, bedingen Digitalisierung und Globalisierung ein zu ihnen gegenläufiges Momentum: die Sehnsucht nach Authentizität. Was aber ist daran das Problem?
Die Willkür des Authentischen
Wenn jemand sagt, jemand oder etwas sei ‹authentisch›, behauptet er willentlich oder unwillkürlich Folgendes: Eine Beobachtung lasse Rückschlüsse auf eine Eigenschaft des Beobachteten zu (z.B. eines Menschen oder eines Objekts), und zwar dass dessen äußere Erscheinung übereinstimme mit seinem ‹wahren Kern›. Ist dies der Fall, wird das Prädikat ‹authentisch› verliehen. Ein extrovertierter Mensch ist ‹authentisch›, wenn er sich extrovertiert benimmt. Ein italienisches Restaurant ist ‹authentisch›, wenn Optik und Essen so sind wie in ‹echten› italienischen Restaurants. Dieser Gebrauch des Begriffs weist jedoch zwei Probleme auf: Er unterstellt, dass die Beobachtung objektiv sei (dass also das beobachtet werde, was für den ‹wahren Kern› charakteristisch sei) und dass es einen ‹wahren Kern› eines Menschen oder Objekts tatsächlich gebe.
Ein dilettierender Heideggerianer könnte hier das Sich-Entbergen eines Wesenskerns in Menschen und Dingen annehmen. Für alle anderen ist die Zuschreibung von Eigenschaften in hohem Maße kulturelle Praxis: Die deutsche Erwartung unterstellt, dass ein italienisches Restaurant Pizza serviert, obwohl Pizza als Gericht historisch nur für Neapel und die umliegende Campania charakteristisch ist. Wenn es einen ‹Wesenskern› eines italienischen Restaurants gäbe, würde dieser daher eher in der Ab- als in der Anwesenheit der Pizza auf der Speisekarte bestehen. Dass Pizza trotzdem in den meisten italienischen Restaurants in Deutschland zubereitet wird, hängt mit der kulturellen Erwartung der Restaurantbesucher (sozusagen: der Rezipienten) zusammen. Für viele von ihnen wäre ein italienisches Restaurant nicht ‹authentisch›, wenn es keine Pizza servierte. Dasselbe gilt, mit geänderter, elitärerer Zielgruppe und Erwartung, für diejenigen italienischen Restaurants, die den Anschein von Authentizität gerade dadurch erreichen, dass sie keine Pizza servieren.
Es geht keineswegs darum, diese Erwartungen abzuwerten – das wäre ebenso überheblich wie das vorschnelle Diskreditieren jeder kulturellen Praxis. Wichtig ist allerdings ein Bewusstsein dafür, dass die Bezeichnung eines Menschen, Ortes oder Objekts als ‹authentisch› die entsprechende Eigenschaft nur zuschreibt. Authentizität jenseits dieser Zuschreibung gibt es nicht. Weil die Bezeichnung als ‹authentisch› lediglich die Übereinstimmung einer Erwartung mit einer Beobachtung konstatiert, lässt sie nur Rückschlüsse zu über denjenigen, der «authentisch» sagt, über seine Erwartung und Perspektive – was potentiell hochinteressant ist. Wenig bis nichts hingegen sagt die Rede vom ‹Authentischen› über den Menschen oder das Objekt aus, das als ‹authentisch› bezeichnet wird. Auf diese Diskrepanz aufmerksam zu machen und damit verbundene Zusammenhänge als kulturelle Phänomene nachzuzeichnen, ist wesentliches Ziel dieses Buches.
Gut, könnte man einwenden, dann nennen wir das Bezeichnete also nicht ‹authentisch›, sondern beispielsweise ‹wahr› oder ‹echt›. Doch eine solche hypothetische Umbenennung unterstreicht die Problematik des Begriffs ‹authentisch›. Als kleines Experiment kann man die Alternativvorschläge in zwei Beispielsätze einfügen, in denen das Wort ‹authentisch› wohl unproblematisch akzeptiert würde: «Frau Merkel hat ihre authentische Haltung zum Atomausstieg präsentiert» oder «Christian Krachts Roman Faserland stellt das authentische Leben der 1990er Jahre dar». Aus dem ersten Satz würde: «Frau Merkel hat ihre wahre Haltung zum Atomausstieg präsentiert» (impliziter Unterton: «und nicht ihre vorgegaukelte»). Und aus dem zweiten Satz: «Christian Krachts Roman Faserland stellt das echte Leben der 1990er Jahre dar» (impliziter Unterton: «und nicht das Leben, von dem alle fälschlicherweise meinen, dass es für die 1990er Jahre charakteristisch sei»).
Durch den Austausch ist das Problem zu greifen: Während bei den Worten ‹wahr› und ‹echt› eine Sensibilisierung für mitschwingendes Pathos und Übertreibung besteht, suggeriert die Verwendung des Begriffs ‹authentisch›, beobachterunabhängig und neutral etwas über einen Menschen oder Gegenstand auszusagen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Ebenso wie die Rede vom ‹Wahren› und ‹Echten› ist diejenige vom ‹Authentischen› zu großen Teilen raunende Spekulation, die behauptet, Zugang zu einer Art Spezialwissen hinter den oberflächlichen Erscheinungen zu haben.
Vor diesem Hintergrund zielt das Buch darauf, ein Bewusstsein für den Vorgang der Authentizitätszuschreibung zu schaffen[6] und die entsprechende kulturelle Praxis kritisch (als quasi-metaphysisch) zu beschreiben. Es geht also im Folgenden nicht nur um Authentizität, sondern auch um einen prüfenden Blick auf verwandte Konzepte: Eindeutigkeit, Identität, Echtheit und Wahrheit.
Authentizität als Sehnsucht nach Wahrheit
«Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. […] Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen.» (Joh 18,37f.) Pilatus wirft mit seiner rhetorischen Frage das Problem auf, ob es Wahrheit überhaupt gibt und wie sie zu erkennen ist. Seinen Verzicht auf ein Urteil kann man in diesem Kontext so lesen: Wo keine Wahrheit erkannt wird, ist kein Urteil möglich.
‹Authentizität› behauptet das Gegenteil. Einen Menschen oder ein Objekt ‹authentisch› zu nennen, suggeriert das Wissen darum, wie er oder es in Wahrheit beschaffen sei. Aus der Zuschreibung von Authentizität spricht daher ein Wille zur Wahrheit. Wo sich die Erwartung vieler Menschen in einem bestimmten Kulturkreis deckt, beispielsweise hinsichtlich der Frage, wie ein italienisches Restaurant beschaffen sei, ist die Rede vom ‹authentischen Restaurant› nicht unbedingt sinnvoll, aber ungefährlich. In anderen Kontexten ist dies anders: Jemand, der ‹authentisch› sagt, behauptet – freilich meist unbeabsichtigt –, verstanden zu haben, was in Wahrheit ‹deutsch› oder das Wesen eines Mitmenschen sei.
Gemeinsam mit dem Willen zur Wahrheit offenbart die Rede von Authentizität eine Sehnsucht nach Eindeutigkeit. Etwas ‹authentisch› zu nennen, lässt keinen Raum für Unschärfe, Ironie, wechselnde Facetten. Stattdessen behauptet der Begriff, dass alles genau wahrgenommen werden könne und auch genau so beschaffen sei. Weil Authentizität häufig positiv besetzt ist,[7] führt dies zu einem Eindeutigkeitspostulat, das verkennt, dass viele Dinge weder eindeutig schwarz oder weiß sind noch sich eindeutig in unmissverständliche Worte fassen lassen.
Überraschenderweise treffen sich gegensätzliche politische Überzeugungen und Weltanschauungen darin, dass sie das Wahrheits- und das Eindeutigkeitsproblem übersehen. Die Rede vom ‹Authentischen› verbindet den kosmopolitischen Weltbürger, der die Mate in seiner argentinischen Stammkneipe oder das Saxophon-Solo des afroamerikanischen Mitbürgers ‹authentisch› findet, mit dem Nationalisten, der zu wissen glaubt, dass Anstand und Ordnung ‹authentisch› deutsch seien. Beide verkennen, dass Authentizität nur eine Formulierung ist, die die Übereinstimmung von (subjektiver) Erwartung und (subjektiver) Beobachtung konstatiert, nicht aber tatsächlich etwas über ein Saxophon-Gen von Afroamerikanern oder ein angeborenes Ordnungsbedürfnis von Deutschen aussagt.