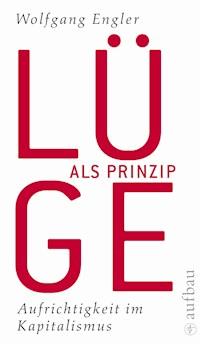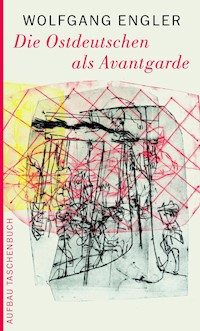Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Theater der Zeit
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Authentischsein gilt zu allen Zeiten als erstrebenswert, doch was genau ist damit gemeint? Welche Eigenschaften muss ein Mensch in sich vereinen, um als authentisch wahrgenommen zu werden? Und welche gesellschaftlichen Rahmungen sind dem Streben nach Authentizität förderlich oder hinderlich? Wie "natürlich" darf, kann oder muss man sein, um als authentisches Individuum zu gelten? Und verstellt sich zwingend, wer sich verwandelt, in Szene setzt, im Alltag oder auf der Bühne Rollen spielt? Der Soziologe Wolfgang Engler verfolgt das Konzept der Authentizität in seiner historischen Entwicklung und kritisiert das zeitgenössische Ideal, in allen Lebenslagen – im Privaten, in der Öffentlichkeit, im Beruf, in der Kunst – ohne Abstriche 'man selber' sein zu wollen. Was dabei letztlich auf dem Spiel steht, sind Spiellust und Spielvermögen des Menschen wie des Schauspielers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Engler – Authentizität!
Wolfgang Engler
Authentizität!
Von Exzentrikern, Dealern und Spielverderbern
© 2017 by Theater der Zeit
Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich im Urheberrechts-Gesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung von Autor, Verlag und Alexeij Sagerer. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
Verlag Theater der Zeit
Verlagsleiter Harald Müller
Winsstraße 72 | 10405 Berlin | Germany
www.theaterderzeit.de
Lektorat: Nicole Gronemeyer
Gestaltung: Sibyll Wahrig
unter Verwendung einer Umschlagabbildung: © Andreas Zahlaus
Fotos S. 94 und 95: August Sander © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Köln; VG Bild-Kunst, Bonn, 2017
ISBN 978-3-95749-096-4
eISBN 978-3-95749-110-7
Wolfgang EnglerAuthentizität!
Von Exzentrikern, Dealern und Spielverderbern
DAS PROBLEM
WIE MENSCHEN „WIRKLICH“ SIND
1. Wir Ex-Zentriker
2. Entgrenzungen
3. Das Eigene und das Fremde
4. Verstelltes Dasein, richtiggestellt
DIE DRAMEN DER HANDLUNG
1. Heldendämmerung
2. Sonderlinge, Informanten
3. Kurze Geschichte einer Entfremdung
4. Fahrer und Beifahrer
5. Probehandeln als politischer Vorgang
6. Wiederkehr der Helden
7. Das Handeln darstellen
MACHEN KLEIDER LEUTE?
1. Madame Bovary im Büro
2. In Funktion: Stolz, Scham und ein Deal
3. Vor und hinter dem Vorhang
4. Die Kunst der Angestellten
DIE WOHLMEINENDEN
1. Die Grenzen des Diskurses
2. Zweierlei Repräsentationskritik
3. Der Schleier der Sprache
AUTHENTIZITÄT IM WANDEL
1. Die Prüfung der Besten
2. Bürgerpflichten, Bürgersinn
3. Die Stunde der Exzentriker
4. Die Option für das ‚Natürliche‘
5. Authentizität und Kollektivität
6. Die „volkseigene Erfahrung“
7. Lesen, Streiten, Lachen
8. Shared Personality
Über den Autor
Anmerkungen
DAS PROBLEM
Authentizität, das gibt es nicht.Das lernt man in derSchauspielschule.
Devid Striesow(Berliner Morgenpost, 2016)
Vor geraumer Zeit blätterte ich während eines Aufenthalts in einem Quartier der Hotelkette Motel One in einem Werbekatalog des Hauses und stieß alsbald auf eine Doppelseite. Dort versammelten sich neun Angestellte des Unternehmens auf einem Gruppenfoto. Durchgehend in ihren Zwanzigern, präsentierten sie sich dem Betrachter offenen Gesichts, dezent lächelnd, in charakteristischer Dienstkleidung: türkises Hemd unter braunem Anzug die beiden Männer und in türkise Bluse zuzüglich Halstuch und braunes Kostüm gefasst die Frauen. Die Anordnung der Gruppe vermittelte den Eindruck wechselseitiger Vertrautheit; drei Mitarbeiterinnen hatten, wie gute Freundinnen das tun, ihren Arm über die Schultern der anderen gelegt. Tatsächlich arbeiteten die neun in Niederlassungen quer durch Deutschland, eine war sogar in Wien beschäftigt. Diese Zusatzinformation erschloss sich über Zahlen, die den Einzelnen zugeordnet waren und auf nummerierte, die Figuration einrahmende Textblöcke verwiesen. Dort waren Arbeitsort und Alter der Personen zu erfahren sowie ihre Kurzantworten auf Deutsch und Englisch auf die Frage, die in Großbuchstaben links oben auf der Doppelseite stand: WARUM MOTEL ONE?
„Weil Motel One ein verantwortungsvoller Arbeitgeber ist, der mir als alleinerziehender Mutter die nötige Sicherheit für mein Leben gibt“, sagt eine 27-Jährige von der Service Lounge. Andere preisen die flachen Hierarchien, die den Mitarbeitern schnelles Weiterkommen ermöglichen, die harmonische Atmosphäre in jungen Teams, nennen das Unternehmen „supercool“ oder streichen die Anmutung eines Designs heraus, das haargenau dem eigenen Geschmack entspricht. Die verbalen Kundgaben bekräftigen die visuelle Botschaft: Erwerbsarbeit unter solchen Umständen hat den einst ihr anhaftenden Fluch, von fremder Hand verfügt zu sein, gebannt. Warum also letztlich Motel One? „Weil wir einen super Spirit in der Belegschaft haben. Da macht das Arbeiten vor allem eines: Spaß!“, freut sich die 25-jährige Juliane. Und dann noch Toni, Rezeptionist aus Berlin. Die ihm zugeschriebene Antwort fasst den allgemeinen Wohlfühlgestus in denkwürdige Worte: „Weil ich mich bei der Arbeit nicht verstellen muss und so sein kann, wie ich wirklich bin. Wo gibt’s das noch?“
Wir befinden uns in der Welt des Marketings; Gestus und Äußerungen der jungen Angestellten dienen dem leicht durchschaubaren Zweck, Gäste zum Wiederkommen zu bewegen, den expandierenden Geschäften Nachwuchs zuzuführen. Dennoch, gerade deshalb ist die Präsentation von durchaus theoretischem Interesse. Sie verweist auf einen kulturellen Code, der die Kommunikation des Unternehmens mit seiner Umwelt auf lehrbuchhafte Weise regelt. Mitarbeiter vorzuführen, die ihre Aufgaben ‚ordentlich‘ erfüllen, liefe auf dasselbe hinaus, wie Waren feilzubieten, in denen ‚solide Arbeit‘ steckt. Die Ware soll ein inniges Band mit ihrem Käufer, der Mitarbeiter ein ebensolches mit seiner Stelle knüpfen. Arbeitnehmer anzuhalten, sich mit ihrer Arbeit pflichttreu anzufreunden, reicht nicht aus. Gefragt sind Individuen, die die Grenzen zwischen ihrem Eigensten und ihrem Wirken für die Firma räumen, ihren Beruf offenherzig praktizieren. In Funktion und gleichzeitig man selber bleiben, sein, wie man „wirklich“ ist, so geht man zeitgemäß zu Werke.
Keine Verstellung im anstelligen Dasein, Tonis Tagtraum, wer teilte ihn nicht gern? Von der Verwandlung der Arbeit in ein Lebensbedürfnis träumten Sozialisten, Kommunisten schließlich seit Jahrhunderten. Das Vorrecht der freien Berufe, der gebildeten Stände – Arbeit, die den Menschen ausfüllt, in der er sich bewähren kann – sollte gebrochen, Allgemeingut werden, eine Aristokratie für jedermann. Nun träumt das Kapital den Traum und viele, die ihm Dienste leisten, träumen mit. Daran ist nichts Verwerfliches. Das in unabweisbare Notwendigkeiten eingespannte Leben bevorzugt seit jeher Pflichten, die sich zu den eigenen Wünschen neigen.
Nur mit der Wunscherfüllung haperte es von allem Anfang an. Elementare Not zu wenden, darin erschöpfte sich der Sinn der Arbeit für unzählige Generationen, und für die weitaus meisten Erdbewohner gilt das noch heute. Man wählt nicht, wird vielmehr erwählt und schätzt sich glücklich, wenn die Wahl auf einen selber statt auf den Nächsten fällt. Die gesamte geschriebene Menschheitsgeschichte berichtet von Herren der Arbeit und vom Arbeitsvolk. Die Seiten, auf denen dieses durchatmen, selbst bestimmen durfte, was welche Mühe lohnt, bestehen aus Fragmenten und wappnen den Leser mit einiger Skepsis bezüglich der Aussichten arbeiterlicher Selbstbestimmung. Mitbestimmung auf Grundlage einer bürgerlichen Form der Lohnabhängigkeit – das war der Beitrag des Westens zur Chronik „humaner“ Erwerbsarbeit. Der Osten steuerte eine Staatsform lang die „volkseigene Erfahrung“ bei. Herrenloses Eigentum, herrische Arbeitsplatzbesitzer, unkündbare Machtbesitzer obenauf, so war das „Reich der Freiheit“ nicht zu pflanzen.
Arbeitern, Angestellten Starrsinn und deplatzierte Herrschsucht auszutreiben, geht umso leichter von der Hand, wenn man ihnen das Eigentum der Eigentümer auch als unternehmerisch Denkenden, Waltenden anvertraut. Die Offerte knüpft an ein tief verwurzeltes Bedürfnis der populären Klassen an und unterstellt es der Kapitalregie. Gelingt der Kurzschluss zwischen Eigenem und Fremdem, stehen die Leute unter Strom? „Entfremdung verboten!“, das ist der Wahlspruch unserer Zeit, eine recht verquere Art, nichtentfremdetes, authentisches Sein zu denken und zu leben. Der Gegensatz wird überbrückt, nicht überwunden, wandert aus in die Latenz und züchtet dort Symptome bald diffuser, bald greifbarer Unzufriedenheit. Die Komplizenschaft zwischen Arbeitsherren und Arbeitsvolk beruht auf der Funktionalisierung des Wunsches nach unverstelltem, authentischem Sein in allen Lebenslagen. Dass nicht jede Lebenslage dazu taugt, das Innerste zu offenbaren, ist so offenkundig wie die Verführungskraft neuer Medien und Technologien, die eine ungeschützte Selbstbeziehung unterstützen; man fängt sich da leicht Viren ein.
Authentizität als Problem, unser Problem – das ist das Thema der folgenden Überlegungen. Das Besondere, Zeitbedingte unserer Art der Problematisierung herauszustellen, verlangt ein teils systematisches, teils historisches Vorgehen.
Wie wir „wirklich“ sind, „wirklich“ zu sein glauben – den Realitätsbezug dieser Selbstwahrnehmungen zu ermessen, müssen wir von uns ab- und auf das hinsehen, was in allen steckt, die „wir“ sagen konnten und können: das Menschsein. Wie Individuen, die dieses Menschsein in sich tragen, gebaut, beschaffen, wozu sie disponiert sind, damit setzt die Darstellung ein.
Geschichtlich erfahrbar wird das Wirklichsein von Menschen in ihrem Wirklichwerden, ihrer Verwirklichung unter sich wandelnden Bedingungen. Unter allen möglichen Praxisformen, die darüber Aufschluss geben können, ragt das Handeln heraus. Handelnd enthüllen sich Menschen vor anderen wie vor sich selbst. Welche Handlungskontexte und Handlungsweisen diese Selbstenthüllung fördern oder hintertreiben, das Handeln in authentische oder entfremdete Bahnen lenken, ist näher zu betrachten.
„Kleider machen Leute“, sagt man. Gilt das noch immer, für alle? Und welche Aufmachung trägt dem heutigen Komment, unverstellt ‚man selbst‘ zu sein, genügend Rechnung? Die Darstellung des Selbst ringt vor dem Hintergrund einer aufkommenden Rollen- und Funktionsscham mit aufschlussreichen Widersprüchen.
Wie offenbart man sich auf eine Art und Weise, die bezeugt, dass man es wirklich selbst ist, der sich offenbart, statt nur Klischees der Offenbarung abzuspulen, Kopie statt Original? Die Fragestellung greift die vorherige auf und treibt sie weiter in Richtung auf einander ablösende Grundspielarten authentischen, weil selbst verfertigten Lebens. Authentizitätsbestrebungen gewinnen ein sehr verschiedenes Aussehen je nachdem, worauf sie ihren Fokus richten: auf das Individuum, auf das Kollektiv oder auf die Kapitalisierung der Persönlichkeit. Wo wir derzeit stehen, lässt sich sagen, und ahnen, wohin die Reise gehen könnte.
WIE MENSCHEN „WIRKLICH“ SIND
Wir dürfen, so viel steht fest, mehr„Mensch“, mehr „wir selbst“ sein alsunter den alten Bedingungen. Damitist zugleich die Sphäre verschwunden,in der wir, entlassen aus der Fabrik-und Bürowelt, „endlich Mensch“,endlich wir selbst sein konnten.
Christoph Bartmann,Leben im Büro (2012)
1. Wir Ex-Zentriker
Seit frühesten Zeiten leben Menschen in Verbänden und begreifen sich darin. Die Art, wie sie sich begreifen, ändert sich mit der Art und Weise ihres Verbundenseins. Die tiefgreifendste Veränderung ihres Selbstbildes wie ihrer Beziehung zu anderen bewirkte die Herausbildung einer auf kapitalistischer Warenproduktion beruhenden Gesellschaft. Dieser Prozess entband zugleich das soziologische Denken, und einer der ersten, der die Zäsur reflektierte, die beides entstehen ließ, war Adam Ferguson.
„Es geschah stets in Gruppen und Gesellschaften, daß die Menschen umhergewandert sind oder sich niedergelassen haben, daß sie sich einig gewesen sind oder sich gestritten haben. Wie immer ihr Zusammenkommen beschaffen sei, seine Ursache liegt im Prinzip des Bündnisses oder der Vereinigung.“1 Mit diesen Sätzen formulierte Ferguson gleich zu Anfang seiner Schrift die unumstößliche Wahrheit menschlicher Existenz und ging im Weiteren der Frage nach, warum sie außer Acht geraten konnte. Seine Antwort ist nach wie vor bedenkenswert: Die Herausbildung marktbasierter Gesellschaften (die er „kommerzielle“ nennt) verdunkelt die Wahrheit, stellt sie auf den Kopf. „Wenn überhaupt jemals, so findet sich in der Tat hier der Mensch zuweilen als ein losgelöstes und einsames Wesen. […] Die mächtige Maschine, von der wir annehmen, daß sie die Gesellschaft bildet, sie dient hier nur dazu, ihre Mitglieder zu entzweien oder ihren Verkehr fortzusetzen, nachdem die Bande der Zuneigung zerrissen sind.“2 Diese Entwicklung verändert den Blick der Einzelnen auf ihren sozialen Zusammenhang fundamental: „Das Individuum schätzt sein Gemeinwesen nur noch insofern, als es seinem persönlichen Vorankommen oder Gewinn dienstbar gemacht werden kann.“3 Die Sorge um sich wird allbeherrschend und die Tugend, statt gleichermaßen das „Wohl der Menschheit“ wie das eigene zu bezwecken, verknöchert zu einem „Akt der Strenge und Selbstverleugnung“.4
Individuelles und soziales Wohlergehen, bis dato komplementäre Aspekte des Handelns, treten auseinander. Der Wertakzent verschiebt sich hin zum Einzelwohl, dem gegenüber das allgemeine Wohl Forderungen geltend macht, die zu erfüllen Einschränkungen der Freiheit mit sich führt, Freiheitsopfer fordert. Verfassungsrechtler erläutern, wie dabei zu verfahren ist: „Je schwerwiegender die gesetzgeberischen Freiheitsbeschränkungen sind, desto höher sind die Anforderungen an den Nachweis der Dringlichkeit und Angemessenheit eines Schutzes des gemeinen Wohls vor den in Rede stehenden Freiheitsbetätigungen des Bürgers.“5 Der Gegenbegriff „Gemeinwohlbeschränkungen zum Schutz der Freiheit“ taucht in diesem Zusammenhang nicht auf, wohl deshalb, weil sich das Vorfahrtsrecht der Freiheit von selbst versteht. Wir sind zu Hause, in unserer Welt.
Eine Welt voller Missverständnisse. Als von anderen abgesonderte Überlebenseinheit kommt der einzelne Mensch unter keinen wie auch immer gearteten Umständen in Betracht. Menschen können nur gemeinsam frei sein und sind es, sofern sie ihre Abhängigkeiten voneinander so gestalten, dass sie mit der Selbstbestimmung der darin Verwickelten verträglich werden. Solange die Einzelnen sich auf zuvor festgelegte, überschaubare Weise aneinander binden, bleibt ihr Entfaltungsspielraum in enge Grenzen gebannt. Das ändert sich mit der Vervielfältigung der Bindungsarten. Georg Simmel hat Wesentliches hierzu zeitig unter dem Stichwort „soziale Differenzierung“ festgehalten. Er fand: Je reger, vielgestaltiger der Austausch innerhalb und zwischen den Verbänden abläuft, desto mehr emanzipieren sich die Individuen, pendeln zwischen verschiedenen sozialen Kreisen hin und her, bilden unterschiedliche Identitäten aus, erfahren sich, ihr Selbst, als Überschuss respektive als subiectum, als unerschöpflichen Grund all ihrer Aktivitäten und Beziehungen. Sie sind gewissermaßen doppelt da, haben ein „Sein für die Gesellschaft“ und ein „Sein für sich“. Dank dieses Reziprozitätsverhältnisses „[kann] die individuelle Seele nie innerhalb einer Verbindung stehen, außerhalb deren sie nicht zugleich steht […].“6
Selbst- und Fremdbezug bilden ein spannungsvolles Paar. Ohne Selbstbezug kein freiheitsverträgliches Zusammenleben, ohne soziale Einbettung kein gelingender Selbstbezug. Neigt das Pendel zu sehr einem dieser beiden Pole zu, verzerrt dies die „Wirklichkeit“ des Menschen. Die Geschichte der Moderne ist nicht zuletzt die Geschichte solcher Ausschläge.
Menschen als ‚bipolare‘ Wesen ohne feste Mitte, Anthropologen unterstreichen das Kippbildhafte dieser Spezies. Schon Kant sprach vom Antagonismus der Menschennatur, von ihrer „ungeselligen Geselligkeit“, und schrieb: „Der Mensch will Eintracht; aber die Natur weiss besser, was für seine Gattung gut ist; sie will Zwietracht. Er will gemächlich und vergnügt leben; die Natur will aber, er soll aus der Lässigkeit und unthätigen Genügsamkeit hinaus, sich in Arbeit und Mühseligkeiten stürzen, um dagegen auch Mittel auszufinden, sich klüglich wiederum aus den letzteren heraus zu ziehen.“7 Helmuth Plessner sah den Menschen, jeden Menschen in einer „exzentrischen Position“ sich selbst wie seinesgleichen gegenüber. Weder könne er je mit sich, mit seinem Leib, noch mit seinen Artgenossen zusammenleben, ohne gleichzeitig ein Verhältnis dazu aufzubauen: zum Leib als Körper, zu den anderen als Person. Sein Wesen dränge ihn in einem zur Fixierung hin und von der Fixierung fort.8
Michael Tomasello stellte diese Dialektik in einen evolutionsgeschichtlichen Rahmen. Für ihn bilden mitmenschliche Strebungen unsere Grundausstattung: „Es gibt kaum Beweise dafür, dass der […] von Kindern gezeigte Altruismus das Ergebnis von kultureller Prägung, elterlichem Einfluss oder irgendeiner anderen Art von Sozialisation ist“, fasst er seine vergleichenden Forschungen zum frühkindlichen Verhalten zusammen.9 Ein besonders aussagekräftiges Exempel dieser kollektiven Mitgift lieferte das Verhalten von Soldaten im Ersten Weltkrieg. Wann immer sich eine Gelegenheit dazu bot, fraternisierten sie zum Entsetzen der Heeresleitungen über die Gräben hinweg, schossen gezielt über die Köpfe des Feindes oder verließen an Feiertagen ihre Stellungen, um einander zu umarmen und Fotografien ihrer Frauen und Kinder herzuzeigen.10 Ihnen diese Unart auszutreiben, verwickelten die Vorgesetzten die feindlichen Brüder wiederkehrend in Scharmützel, deren einziger Zweck in der Aufrechterhaltung militärischer Tugenden bestand.
Vieles spricht dafür, dass die grundständige, auf jedermann gerichtete Neigung zum Kooperieren, Helfen und Teilen weniger erlernt als vielmehr verlernt wird.11 Sollte die „Sozialisation“ das ihr zugeschriebene Ziel, Heranwachsenden moralische Kompetenzen zu vermitteln, weit verfehlen, sogar das glatte Gegenteil bewirken, das Abtrainieren der zunächst subjektblinden Empathie zugunsten einer berechnenden, auf den persönlichen Nutzen bedachten Einstellung zu anderen – erst ich und dann der Rest der Welt?
Angenommen, wir wüssten, dass die Erde dreißig Tage nach unserem Tod – wobei unser eigenes Leben von normaler Dauer wäre – durch eine Kollision mit einem riesigen Asteroiden vollständig zerstört würde. Welchen Einfluss hätte dieses Wissen auf unser Fühlen, Denken und Handeln? In seinem jüngsten Buch unterbreitet der New Yorker Philosoph und Rechtsprofessor Samuel Scheffler seinen Lesern dieses etwas morbide Gedankenexperiment.
Die meisten nähmen wohl umgehend Abstand von Vorhaben, die erst in vielen Jahren Früchte trügen. Vermutlich würden wir uns, im Schmerz vereint, unseren Nächsten zuwenden, zutiefst betrübt über das schreckliche Ende, das ihnen bevorsteht. Manche würden schlechtweg verzweifeln und in Apathie versinken, andere die verbleibende Zeitspanne mit den Beschäftigungen füllen, die ihnen am meisten am Herzen liegen, und dabei Trost finden. Freundschaften gewännen vielleicht an Intensität, nur: Worüber sprechen, was miteinander unternehmen, wenn der Erwartungshorizont derart rapide schrumpft?
Im Fortgang seiner Darstellung variiert Scheffler sein Thema. Jetzt ist die Menschheit unfruchtbar geworden, jeder führt ein Leben von normaler Dauer, aber es bleibt absehbar, wann der Letzte für immer die Augen schließt. Die lange Kette der Generationen, der Begebenheiten, Überlieferungen reißt jäh ab, alles, was je im Leben von Milliarden und Abermilliarden von Menschen Bedeutung besaß, weil andere nachfolgten, die daran anknüpfen, davon berichten konnten, wird mit einem Schlag ausgelöscht, irrelevant. Und das ist der eigentliche, überaus lehrreiche Schrecken beider Untergangsszenarien. Er verweist uns auf das, was definitiv unverzichtbar für unser eigenes Leben ist: das Leben anderer, jener, die mit, mehr noch jener, die nach uns auf diesem Planeten existieren, der Fortbestand, das Wohl der Menschheit. Wir werden der Grenzen unseres Individualismus und Egoismus gewahr. „In bestimmten […] Hinsichten macht uns die Tatsache, dass wir und alle, die wir lieben, verschwinden werden, weniger aus als die Nichtexistenz zukünftiger Menschen, die wir nicht kennen und die noch nicht einmal eine eindeutige Identität haben. Wir können es auch positiver formulieren und sagen, dass uns die zukünftige Existenz von Menschen, die wir weder lieben noch kennen, wichtiger ist als das Überleben von Menschen, die wir kennen und lieben. […] Die Menschheit selbst, als fortdauerndes, historisches Projekt, bildet den impliziten Bezugsrahmen für den Großteil unserer Urteile darüber, was von Bedeutung ist. Entfernen wir diesen Bezugsrahmen, gerät unser Sinn dafür, was wichtig ist, […] ins Wanken und geht uns verloren.“12
Scheffler findet es seltsam, dass Menschen die Vorstellung ihres eigenen Endes, das unabänderlich ist, zwar ängstigt, aber nicht entmutigt, das ebenso vorstellbare Ende der Gattung hingegen bislang kaum jene Kräfte freisetzt, die nötig wären, es abzuwenden.13 Woran liegt das? Ist Selbstsucht unser Schicksal, in die Humana conditio gleichsam eingebrannt? Oder entfremden uns spezifische gesellschaftliche Organisationsformen unserer Bestimmung, dem „Projekt Menschheit“ in unseren persönlichen Bestrebungen den Rang einzuräumen, der ihm gebührt?
Menschheitswohl vor Einzel- und Gruppenwohl: Die Formel, die diese Wahrheit überblendet, lautet: funktionale Differenzierung plus Privatisierung. Jene verlängert und verzweigt die Handlungsketten, diese verwandelt deren Glieder in verselbständigte, formell voneinander unabhängige Subjekte, in Eigentümer. Und was bindet diese zusammen? Der Tausch, Kauf und Verkauf, in einem Wort der Markt? Ja und Nein. Ja insofern, als die Eigentumsschranke, die private Verfügungsgewalt über gesellschaftliche Ressourcen, von sich aus zum Austausch drängt, diesen erzwingt. Nein wiederum, weil der Warentausch den gesellschaftlichen Zusammenhang nicht konstituiert, vielmehr auf spezifische Weise realisiert. Die Subjekte hängen immer schon zusammen, bilden, ehe sie darüber nachdenken können, eine Einheit, und zwar in desto höherem Grade, je mehr diese Tätigkeiten und Bedürfnisse sich spezialisieren beziehungsweise differenzieren. Unabhängigkeit und Abhängigkeit, Autonomie und Bindung steigern sich aneinander: Émile Durkheims berühmte „organische Solidarität“.14 Der Markt ist das Medium der sekundären Vergesellschaftung der Subjekte, das „System der Tätigkeiten und Bedürfnisse“ (Hegel) ihr primärer Vergesellschaftungsmodus.
Kommerzielle Gesellschaften verdecken ihr Konstruktionsprinzip, den Bauplan, der dem Markt zugrunde liegt, lassen Gesellschaft aus dem Gegeneinander unabhängiger, eigennützig handelnder Individuen hervorgehen.
Die kardinale Frage lautet nicht (mehr): Wie weit kann die Selbstzentrierung gehen, ohne die Wohlfahrt aller zu beeinträchtigen?, sondern: Wie viel Rücksichten auf das Gemeinwohl sind der Selbstsorge zuzumuten, ohne die für elementar erachteten persönlichen Freiheiten und Antriebskräfte zu ersticken? Das liberale Freiheitsdispositiv verortet die Gefahren für das Gelingen von Gesellschaft stets auf dem Gegenpol der einzelnen Subjekte, beargwöhnt Kollektivierungen jeglicher Art und setzt denselben Grenzen – Grenzen des Staats,15 Grenzen der Gemeinschaft(en),16 Grenzen der Mehrheit, ihrer Meinung, ihres Geschmacks.17
Der neoliberale Diskurs hält sich bei derlei Grenzbestimmungen nicht länger auf. Seine Wortführer billigen Staaten, Gemeinschaften, Individuen ihr Daseinsrecht nur mehr vor dem Hintergrund ihres Verzichts auf Fisimatenten sowie ihres Einverständnisses zu, sich selbst zu Unternehmen umzuformen. Für sie begründet der Markt die Gesellschaft, ihre Institutionen, ihre Gliederungen, statt diese, wie vordem, zu begrenzen, und veranstaltet ein Dauertribunal über nicht marktgerechtes Verhalten jeder nur denkbaren Art.18
Die soziale Welt, die diese sich selbst verleugnende Ideologie entwarf, ist Tonis Welt. Wie „wirklich“ kann er in ihr sein?
2. Entgrenzungen
Menschen drängen zur Fixierung hin und von ihr fort, sie exponieren ihr Selbst und verhüllen es, verleihen ihrem Innersten Ausdruck oder wahren das Caché und finden im Wechsel dieser Haltungen ihr fragiles Gleichgewicht. Die Haltungen auf die jeweiligen Verhaltenskontexte passgenau abzustimmen, ist Aufgabe der ‚Außenpolitik‘ der Individuen. In Funktion – Minister, Anwalt, Ärztin, Lehrerin – und gleichzeitig ‚man selber‘ sein zu wollen, unverstellt, so, wie man „wirklich“ ist, verrät eine beunruhigende Verunsicherung der Instinkte.
Wohl toleriert das funktionale Dasein im Postfordismus expressivere Selbstdarstellungen als vordem. Ein gewisses Maß an Offenheit, Einfühlungsvermögen und Sensibilität gilt als Ausweis zeitgemäßer Professionalität.19 Nur fungieren diese Eigenschaften gleichzeitig als Spieleinsätze in einem Wettbewerb, der Sieger und Verlierer produziert. Am besten fährt, wer Offenheit glaubwürdig ausstrahlt, andere ins Offene lockt und deren Mangel an Aufsicht auszunutzen weiß. Man kontrolliert seine Gefühle, panzert sich mit inszenierter Aufgeschlossenheit und münzt seine emotionale Intelligenz in Extraprofite um.20 Keine Freiheit ohne Preis, das ist die Regel; abgelebte Zwänge weichen selten, ohne dass neue sie ersetzen.
Der heutige Berufsmensch unterliegt, wie in der Vergangenheit auch, Zwängen rein funktionaler Natur und verwandelt diese in Selbstzwänge des Verhaltens. Das reibungslose Zusammenwirken Vieler verlangt die Dämpfung ungestümer Leidenschaften, das Zurückstellen von Akutwünschen zugunsten aufgeschobener Triebbefriedigung, Langsicht, Stresstoleranz und manches mehr. In diese rein funktionalen Zwänge mischen sich auf häufig schwer zu entwirrende Weise solche, die ausschließlich der sozialen Disziplinierung zuarbeiten.21 Diese segeln nicht länger unter der Flagge von Verbot, Versagung, Unterwerfung; sie kommen als Chancen daher, laden zur Verausgabung ein, zur Selbstverwirklichung. Je größer die Spielräume, die ein Beruf tatsächlich eröffnet, desto leichter fällt die Verkennung dieser rein sozialen Zwänge, deren kritiklose Internalisierung.
Der moderne Fußball liefert ein diese Problematik gut beleuchtendes Exempel. In den 1950er Jahren legten Spitzenspieler während eines Matches im Durchschnitt drei Kilometer zurück. Zwei Jahrzehnte darauf hatte sich der Laufweg in etwa verdoppelt und gegenwärtig liegt der Wert bei über zehn Kilometern. Es ist noch nicht allzu lange her, da bestritten die Profis selbst der obersten Ligen ein Spiel pro Woche, jetzt sind es derer zwei, mitunter drei. Die Wettbewerbe wurden vervielfacht, die Zahl der teilnehmenden Mannschaften aufgestockt, Spielzeiten entflochten, um das Produkt Fußball einträglicher zu vermarkten. Die Gehälter der Besten stiegen himmelwärts, die Transfersummen ebenso, um die Geschäfte profitabel zu halten, mussten noch mehr Spiele her. Kein Tag ohne Fußball, speziell im Fernsehen, erst Mord, dann Sport – aus diesem Volksvergnügen noch den allerletzten Cent herauszupressen, ist die Devise der Veranstalter.
Die ultimativen Grenzen dieses Unternehmens geraten in Sicht, indem sie hier und da schon überschritten werden. Sich bei inflationiertem Spielbetrieb stets aufs Neue aufzuraffen, fällt immer schwerer, die überspannten Glieder ermüden, brechen, Depressionen nehmen zu, mancher wirft das Handtuch, steigt aus, trotz aller Verlockungen, oder geht auf die Gleise, wenn seelisch nichts mehr geht. Das alles bei höchster intrinsischer Motivation, exorbitanter Entschädigung, herausgehobener Prominenz, weltweitem Ruhm. Man muss schon über eine außergewöhnlich robuste Ausstattung verfügen, um die Belastung ‚sportlich‘ zu nehmen, die Zwänge zu verdrängen, die dem außer Rand und Band geratenen Verwertungstrieb geschuldet sind.
Dieselbe schmerzhafte Entwicklung vollzog sich quer durch alle Branchen und Professionen. Die Verdichtung der Arbeit wuchs, der Kreis der den Einzelnen zugewiesenen Aufgaben erweiterte sich, die Forderung, selbständig Entscheidungen zu treffen, stand und steht nur allzu oft im Widerspruch zum effektiven Entscheidungsspielraum. Ermüdung, Frustration, starker Leidensdruck, Aussetzer infolge wachsender Arbeitslast selbst, gerade bei denen mit hohem Arbeitsethos – empirische Untersuchungen belegen diese Phänomene zweifelsfrei.22
Die Notrufe aus den Reihen der Überspannten häufen sich, desgleichen die Bedenken, Leben und Beruf fraglos in eins zu setzen. Ein kombinatorischer Lebensstil gewinnt unter Endzwanzigern, Anfang Dreißigern wachsende Attraktivität. Pragmatisch orientiert, rechts- und regelkundig, stellen sie sich den Unternehmen in wohl abgemessenen Dosen zur Verfügung, durchaus willens, vorübergehend im Crunchmodus zu arbeiten, Date- und Deadlines ausgesetzt. Nur hören sie dabei auf ihre innere Stimme und schalten, wenn die sich meldet, entweder einen Gang zurück oder klinken sich eine Zeitlang aus dem Treiben aus. Sie wenden sich ihren Familien, Freunden, Hobbys zu und warten, bis sich das Bedürfnis erneuert, wieder intensiver einzusteigen. Ihre Erzeuger, vorwiegend Akademiker wie sie selbst, waren stets zu viele, um phasenweise auszuspannen; Konkurrenz macht geschäftig. Die Jüngeren bilden kleinere Kohorten, so dass es ihnen leichter fällt, ihre Dienstherren für die langfristigen Vorteile ihres Angebots „volle Leistung gegen halbes Leben“ einzunehmen.
Wächst hier eine neue Generation heran? Jahrgangsgruppen bilden nicht allein deshalb Generationen, weil man sie dazu ernennt; seit der „Generation Golf“ geschieht das in immer kürzeren Intervallen. Inzwischen begrüßen wir die Generationen „Y“ und „Z“, das Alphabet ist ausgereizt, kaum jemand weiß zuverlässig anzugeben, was das eigentlich ist, ein Generationszusammenhang, eine Generationseinheit, Karl Mannheim sei’s geklagt. Ob die Arbeitspragmatiker den Arbeitsfanatikern den Rang ablaufen, bleibt abzuwarten. Das abschließende Urteil über das Modell Toni ist noch nicht gesprochen.
3. Das Eigene und das Fremde
Gleichgültig, welchem sozialen Feld wir uns zuwenden, beobachten wir Grenzüberschreitungen, die den Menschen als solchen betreffen, sein Menschsein. Um deren Richtung und Ausmaß genauer zu bestimmen, muss man die menschliche Grundverfassung noch einmal kurz ins Auge fassen. Als geborene Ex-Zentriker leben Menschen beständig in der Gefahr, ins Extrem zu fallen, zu exponiert, offen, involviert oder das Gegenteil davon zu sein. Dann erlischt der Streit der Dispositionen, ihr Antagonismus, läuft das Menschsein auf eine seiner Dimensionen ein. Authentisch sein, in soziobiotischer Perspektive, ist eine Frage der Balance.
Die ist nur allzu oft gestört. Zwei Arten dieser Störung stechen besonders hervor. Entweder wird das Selbst von seinen vitalen Regungen abgeschnitten oder es wird umgekehrt aufgerufen, sich mitsamt seinem Unterbau und also ganz zu geben. Unter dem Einfluss des ersten, älteren Zwangsregimes verkümmert der Mensch zum homo clausus23 und leidet unter dem klaustrophobischen Gefühl, in sich selbst eingesperrt zu sein. Der Zugang zu sich, den eigenen Antrieben, Wünschen, ist gehemmt, und diese Hemmung überträgt sich auf die Beziehung zu anderen. Ursprünglich ein Defekt bürgerlicher Oberschichten, spaltet er das Individuum, indem er dessen Mitte durchtrennt. Als animal rationale gehört es der Welt, agiert in ihr, der Rest verkapselt zu einem rätselhaften Ich, das auf der anderen Seite der Grenze siedelt. Immerhin bleibt in dieser Konstellation das Begehren rege, dieses Reich zu betreten, auszukundschaften.
Die Geheimnisse dieser terra incognita zu lüften, das enträtselte Selbst ans große Ganze anzuschließen, so, dass es nichts für sich zurückbehalte, fokussierte den Ehrgeiz der postmodernen Ingenieure der Seele. Dank ihrer Bemühungen trat dem homo clausus ein nicht minder deformierter Zwilling an die Seite, der noch die letzten Reservate seines Selbst der Funktionalisierung zuführt: der homo connectus (always in, always on).
Funktionales vs. autonomes Selbst, das ist der Kern unsererFreiheitsproblematik, und der ist nirgends aufgeweichter als in der Welt der neuen Angestellten. Hier weiß man am wenigsten zu sagen, wo das verzweckte Leben endet und das eigene Reich beginnt. Wer die Frage aufwirft, auf eine klare Unterscheidung drängt, verrät einen haarsträubenden Mangel an Kompetenz. Den Vorwurf a priori abzuschmettern, preist sich der neue Angestellte als jener Arbeitnehmer an, den diese Frage nicht tangiert.
Dabei könnte er seinen Scharfsinn an ihr üben, ist sie doch alles andere als trivial. Die Zeit nach Dienstschluss, kurz oder lang, gehört dem Dienstbefreiten und zugleich, gewollt oder nicht, der Wiederherstellung seines Arbeitsvermögens. Ihre Einbettung in reproduktive Zusammenhänge hindert die einzelnen Akte – Essen, Trinken, Vergnügungen, Urlaub, Kulturkonsum etc. – mitnichten daran, über ihren objektiven Zweck zu triumphieren, eigensinnig, lustvoll praktiziert zu werden.
Der klassische Angestellte jedenfalls bestand auf seinem Recht, seine Freizeit nach seinem Gutdünken einzurichten, und erholte sich für das Unternehmen, indem er sich unbekümmert von ihm erholte. Ein Spielfilm von King Vidor aus dem Jahr 1928, The Crowd, zeigt gleich zu Beginn eine Halle von ungeheurem Ausmaß, darin Angestellte in endlos langen Reihen hinter ihrem Schreibtisch sitzend, den Blick ungeduldig auf eine große Wanduhr in Sitzrichtung geheftet. Nun endlich zeigt sie 17 Uhr, nun klappen in einem Takt die Ordner zu, das Schreibgerät wird abgelegt und alle stehen auf, streben dem Waschraum entgegen, ein kurzer Blick in den Spiegel und dann, die Kleidung geordnet, im Eilschritt zum Ausgang, aus dem zur selben Zeit, gleichfalls in Scharen, weibliche Angestellte strömen. Im Reißverschlussprinzip hakt man einander unter und spaziert erwartungsfroh von dannen; jetzt geht das Leben los.
Die räumliche Trennung zwischen Heimstatt und Werkstatt, Konsequenz des kapitalistischen Fabriksystems, schärfte zusammen mit der anfänglichen Arbeitspein das Bewusstsein für die Aufspaltung der Lebenszeit in Arbeitszeit und Freizeit, und verständlicherweise richteten sich alle Leidenschaften auf die Letztere. Die Eigenzeit auf Kosten der Systemzeit auszuweiten, blieb das Hauptinteresse der Arbeiter und Angestellten, auch nachdem die Arbeit vielfach erträglicher, einträglicher geworden war, sodass man im Grunde gern zur Arbeit ging, so etwas wie Firmenstolz entwickelte. Zwischen Betrieb und Privatsphäre ohne das untrügliche Gefühl zweier separater Reiche hin und her zu wechseln – so weit ging die Liebe nicht. Dass ganze Berufsgruppen die über Generationen hinweg eingefleischte Unterscheidung zwischen fremd- und selbstbestimmtem Leben unterdessen nicht mehr treffen und die Arbeit (vielfach unter Fortbestand der räumlichen Scheidung beider Sphären) auf eine geradezu libidinöse Weise besetzen, ist wahrlich bemerkenswert.
Denkschablonen – „vergoldete Ausbeutung“, „perfekt verschleierte Entfremdung“ – fassen den Einstellungswandel unzureichend auf. Die Verwandlung der Arbeit in ein Lebensbedürfnis aller zählte zu den Grundforderungen erst des utopischen, später des „wissenschaftlichen Sozialismus“, durchsetzbar freilich nur nach vollbrachtem Umsturz der bürgerlichen Eigentumsordnung. Sollte dieses Anliegen im Rahmen kapitalistischer Machtverhältnisse auch nur teilweise und widersprüchlich aufgegriffen werden, warum dagegen wettern? Der Übergang zum postfordistischen Produktionsregime entsprang nicht zum Geringsten der massenhaften Unzufriedenheit mit dem öden Repetitorium fordistischer Arbeitsverhältnisse.
Die Transformation vollzog sich unter dem Kommando des Kapitals, das daraus Nutzen zog, profitabler wirtschaftete als zuvor. Annulliert dieser Umstand den Nutzen dieser Wende für etliche Fraktionen der abhängig Beschäftigten? Errangen sie, naiv, wie sie nun einmal sind, wieder nur einen Pyrrhussieg? Die Verfechter der ‚objektiven Ausbeutung‘ müssen die Meinung der ‚Ausgebeuteten‘ nicht eigens einholen oder entkräften sie nach gehabter Kenntnisnahme. Für sie bleibt die kapitalistische Arbeitsgesellschaft trotz aller Einschnitte, Brüche und Metamorphosen dieselbe wie vor zweihundert Jahren. Fast gewinnt man den Eindruck, unverblümte Unternehmermacht wäre diesen Kritikern willkommener als moderate, da sie kaum eine Gelegenheit verpassen, dieser die Maske abzureißen, um jene dahinter zu entdecken. Was spricht ernstlich gegen Arbeit, in der man seine Kenntnisse und Fähigkeiten in einem Klima guten Einvernehmens unter Beweis stellen kann, bei der das eigene Urteil gefragt, das Einkommen mehr als nur auskömmlich ist? Die Antwort lautet: nichts, und: mehr Erwerbsarbeit von dieser Sorte.
Die heutige Arbeitswelt zu idealisieren, besteht kein Anlass. Es gibt elende Arbeit, von der man kaum leben kann, obwohl sie das Leben verzehrt, und die Zahl dieser Stellen schnellte infolge neoliberaler Arbeitsmarkt-‚Reformen‘ jäh nach oben.24 Hier darf man getrost von schamloser Ausbeutung sprechen. Selbst an attraktiver Arbeit haften nach wie vor Entfremdungsphänomene. Sie wahrzunehmen, erschwert der verinnerlichte Imperativ, das Fremde zum Eigenen zu machen. Man schaut nicht oder allenfalls verstohlen auf die Uhr, verweilt länger im Betrieb als kontraktlich vorgeschrieben; sechzig Arbeitsstunden in der Woche, ja und? Die Work-Life-Balance gleich im Unternehmen herzustellen – Fitnesshalle, Schwimmbad, Kinoraum liegen auf dem Campus – ist bequem, aber auch Bestandteil des Komments. Wieder gut bei Kräften kehrt man, gleich seinen Kollegen, schnurstracks ins Büro zurück und verbleibt dort, bis die Letzten gehen. Man regeneriert teils beiläufig, isst, trinkt, entspannt den Körper, während man Probleme wälzt, teils grüblerisch und schuldbewusst, mit Arbeitsbedacht. Sich ernähren, ja, nur was genau, was lädt den Akku auf für länger? Sport, Geselligkeit, gewiss, nur welcher Art, mit wem, Leute mit Prestige, Kontakten wären günstig. Empfänglichkeit für kulturelle Angebote bildet die Sinne und schafft zugleich eine eiserne Reserve für das nächste, womöglich stockende Gespräch mit Vorgesetzten oder Kunden, also doch besser ins Musical als in die Oper?
Angestellte neuen Typs arbeiten, während sie ihr Leistungsvermögen reproduzieren, zugleich an ihrer personality, die sie dem Unternehmen zur Verfügung stellen.25 Sie regenerieren unter dem Leitgesichtspunkt ihrer Beschäftigungsfähigkeit, berechnend, rechenhaft. Die dem ‚Auftanken‘ zugebilligte Zeit soll, muss sich in personalem Mehrwert niederschlagen, so wie die Werkstunden in pekuniärem. Zeit, die sich nicht rentiert, ist tote Zeit. Schriftsteller, Künstler, Philosophen, Städtebauer, Architekten und andere „Kreative“ durchleben (leidvoll) Phasen, in denen nichts sich fügt, und schöpfen daraus, außer Demut vor dem Eigensinn des Materials, ein waches Gespür für die Gunst der Stunde. Die Arbeitspatrioten unserer Tage sind nicht willens hinzunehmen, was jeder Kraftanspannung spottet, begehren dagegen bis zu dem Tag auf, an dem der Stecker aus der Dose fliegt. Ihr Selbst ist weder nach innen abgeriegelt noch auf zwei disparate Welten aufgeteilt, sondern porös, angreifbar, besetzbar.
Vor intellektueller Überhebung sei gewarnt. Beruf als Berufung, Einheit von Leben und Werk: Die geistig Tätigen stehen den ‚ordinären‘ Workaholics innerlich viel zu nahe, um sie von oben herab kritisieren zu können.
4. Verstelltes Dasein, richtiggestellt
Die Verwandlung sozialer Zwänge in Selbstzwänge des Verhaltens bedeutet an sich keine Vergewaltigung der menschlichen Natur. Menschen wollen aus sich heraus, mit ihresgleichen wirken, ringen, fechten und setzen sich dergestalt dem Ehrgeiz und, wer weiß, dem Übelwollen anderer aus. Damit möglichst schadlos klarzukommen, bedarf es einer Rüstung. Der Mensch in der Rüstung ist nicht mehr derselbe wie zuvor. Er moderiert sein Innerstes, gerade wenn er freundlich lächelt, womöglich ist er in Wahrheit übler Laune, hält andere auf Abstand. Kann er in dieser sozialen Aufmachung noch der sein, der er „wirklich“ ist? Durchaus, denn Zurüstung für den gesellschaftlichen Auftritt bildet einen