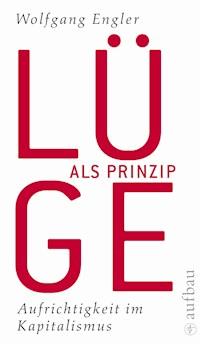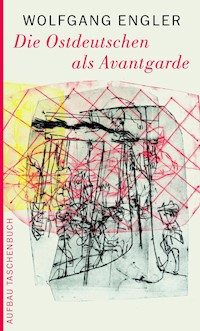9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine kühne soziale Utopie! Wolfgang Engler führt erstmals die Debatten über ein bedingungsloses Grundeinkommen und über Sinn und Zukunft der Bildung zusammen. Seine These: Ohne ernsthafte Bildungsbemühungen kein Grundeinkommen, kein ungeschmälertes Recht auf Leben ohne Arbeit. Mit provokanten Thesen greift Wolfgang Engler in die aktuelle Debatte über Sinn und Zukunft des Sozialstaates ein. Im Gegensatz zu den Befürwortern eines bedingungslosen Grundeinkommens für alle erklärt er: Die Menschen müssen erst lernen, sich selbst zu motivieren und zu regieren, und die Gesellschaft muss ihnen die Möglichkeit dazu bieten. Durch Bildung kann es gelingen, dem Dasein Sinn und Halt zu geben, wenn der Lebensrhythmus nicht mehr von der Lohnarbeit bestimmt wird. Nur dann bleiben die Risiken der Freiheit für den Einzelnen wie für die Gesellschaft kalkulierbar, Menschenwürde und Bürgerrechte gewahrt. Engler "lädt ein, gemeinsam neu zu überlegen, wie wir morgen leben und arbeiten wollen". DIE ZEIT.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Wolfgang Engler
Unerhörte Freiheit
Arbeit und Bildung in Zukunft
Impressum
ISBN 978-3-8412-0047-1
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, BerlinDie Erstausgabe erschien 2007 bei Aufbau
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung gold, Fesel/Dieterich
Einbandgestaltung gold, Fesel/DieterichE-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Impressum
Inhaltsübersicht
Mich nur zu wiederholen
1. Was nicht zur Wahl steht
2. Einleitende Bestimmungen
3. Grundeinkommen: Stand der Debatte
4. Eine unerhörte Freiheit
5. Eine »heillose« Freiheit
6. Eine schwierige Freiheit
7. Eine anstrengende Freiheit
8. GRUNDSATZ eines Gesellschaftsvertrags
9. Eine(r) genügt
10. »Gute« Arbeit
11. Das Gespenst der Faulheit
12. Ausgrenzung in anderer Gestalt?
13. Freigänger, Mitläufer
14. Kollaps der Wirtschaft?
15. Konsumgeld oder Bürgergeld?
16. Kunde, Bürger, Mensch
17. Die demokratische Frage
18. Über Steuern etc
19. Grundeinkommen als unternehmerischer Ansporn
20. Gewissenhaft arbeiten
21. Entspannter miteinander leben
22. Skeptiker und Propheten
23. Freiheitsbeweise
24. Wegweisungen
25. Startkapital ins Leben
26. Gebildete Freiheit
27. Bildung als Rechtsgrund
28. Womit anfangen?
29. Jeder sein eigener Fall
30. Der »persönliche« Staat
31. Das nützliche Individuum
32. Recht und Würde der Person
33. Die Stärken stärken
34. Wahnsinn als Methode
35. Sozialstaat, »tiefer gelegt«
36. Liberales Freiheitsverständnis? Was sonst?
37. Nomade und Igel
38. Letzte Ausfahrt: Utopie
39. Am eigenen Leib
40. Korrekturen
41. Offene Enden
42. Geld und Seele
43. Postskriptum
Calvin und wir
Mich nur zu wiederholen
Mich nur in populärer Form zu wiederholen nicht gewillt, wartete ich doch auf die Gelegenheit, die in »Bürger, ohne Arbeit« entwickelten Gedanken bestimmter auszudrücken.
Menschen ohne feste Stelle im Erwerbssystem ein Leben als Bürger unter Bürgern einzuräumen, frei von beschämender Diskriminierung – diese Vorstellung ist gleichbedeutend mit der Forderung nach einem allgemeinen Recht auf Leben, auf Lebensunterhalt. Das hatten bereits andere gefordert, und so blieb mir in der Hinsicht nur die Aufgabe, diese Utopie allen Beiwerks zu entkleiden, sie rein als solche darzustellen. Dabei stieß ich auf eine Lücke in der Argumentation, die mir, je länger ich darüber nachdachte, nur desto klaffender erschien.
Wäre die Würde von Menschen ohne Arbeit ebenso wiederhergestellt wie ihre gesellschaftliche Verkehrsfähigkeit, läge der schwierigste Teil der Aufgabe – ihr Leben wirklich zu ergreifen –, noch immer vor ihnen. Die einfache Wahrheit, der zufolge Menschen ihr Dasein schon zu führen wüssten, erlöste man sie nur von materiellen Kümmernissen, genügt nicht. Beides, existenzielle Garantien und die beharrliche Sorge um sich, gehört zusammen; die soziale Frage erweitert sich zur kulturellen.
So weit war ich gekommen; was ausstand, war die letzte Konsequenz aus dieser Einsicht. Wenn das Grundeinkommen die Person sozial in Szene setzt, Bildung die Persönlichkeit entfaltet, die Sinne und Vermögen, ohne die es kein erfülltes Leben gibt, warum dann nicht einen Schritt weitergehen und ernsthafte Bildungsbemühungen zur Voraussetzung für das allgemein gewährte Recht auf Lebensunterhalt erklären? – Das Interesse, die gesamte Thematik noch einmal aufzugreifen, war geweckt.
Ob es mir gelungen ist, Bildungsproblematik und Grundeinkommensdebatte schlüssig miteinander zu verknüpfen – ich hoffe es. Ob sich die Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens zu meiner Überzeugung überreden lassen, wird sich erweisen; da zweifle ich einstweilen.
Bildung als Rechtsgrund, das klingt abgehoben, elitär.
Folgt man dieser Spur vorurteilsfrei, behutsam, Schritt für Schritt, führt sie einen zwingend zum Verständnis wahrhaft demokratischer Gepflogenheiten.
Noch ein Wort zur Darstellungsweise. Sie ergab sich aus dem Gedankengang selbst, den ich am ehesten eine »Betrachtung« nennen würde. Gleich dem Besucher einer Gemäldegalerie, der sich in ein Bild vertieft, tritt sie mal näher an ihren Gegenstand heran, um alsbald auf Distanz zu gehen, den Abstand wieder zu verkürzen, einzelne schon aufgefasste Elemente aufs Neue und schärfer zu fixieren.
Mancher Leser wird hier Redundanzen wittern. Ich kann ihm da nicht widersprechen. Die Redundanzen sind gewollt, weil unvermeidlich, sofern es darum ging, möglichst keine Einzelheit zu übersehen, die dem Gesamtbild, das ich zu entwerfen suche, widersprechen könnte.
1.
Was nicht zur Wahl steht
Das Leben in Gesellschaften der uns vertrauten Art vollzieht sich als eine schier endlose Kette von Entscheidungen, von Wahlen, die wir treffen, treffen müssen, und zwar auch dann, wenn wir dabei im Dunkeln tappen, nur ungefähr wissen, warum wir uns so und nicht anders entscheiden und wohin uns das führt. Wir wählen, aus Gewohnheit oder Überzeugung, diese oder jene Partei, oder wir bleiben, ohne der Entscheidung dadurch auszuweichen, der Wahlurne fern – auch die Nichthandlung ist eine Handlung. Wir schließen Versicherungen ab, pflichtgemäß sowie aus freien Stücken, und bewegen uns dabei in der Regel in einem weiten Feld von Angeboten. Wir wählen die Schule, auf die wir unsere Kinder schicken, und wenn sie älter werden, entscheiden sie sich, genügend Ausbildungs- und Studienplätze vorausgesetzt, für gerade diese Lehre oder jenes Studium. Wir wählen unsere Lebenspartner, die wir heiraten oder nicht heiraten, und bestimmen gemeinsam, ob wir Kinder bekommen und, falls ja, wie viele. Oder wir bleiben allein und geben das, jedenfalls nach außen, als unseren Willen kund. Wir konsumieren dieses oder jenes, verreisen hierhin oder dorthin, umgeben uns mit einem größeren oder kleineren Freundeskreis, entwickeln, mit anderen Worten, einen uns gemäßen Lebensstil – geboren aus abertausenden Entscheidungen, intuitiv gefällten wie bewusst getroffenen.
Bei alldem unterliegen wir zahllosen äußeren Einflüssen, die unseren Handlungsspielraum einengen, sozialen Zwängen, die unsere Entscheidungen oftmals wie Marionetten eines schon geschriebenen Dramas aussehen lassen, folgen wir Vorbildern, deren Prägekraft wir gern herunterspielen. So will es die soziale Konvention, die uns zu den maßgeblichen Autoren unseres Lebenslaufs ernennt, und so wollen wir es. Selbstwertgefühl und soziales Ansehen von Menschen bemessen sich heutzutage nach der Vielfalt und der Anzahl der Angebote, die zu ihrer persönlichen Disposition stehen. Der aus Vielem besonnen Auswählende ist der Prototyp des freien Individuums.
Nur eine Wahl bleibt uns versagt: zu arbeiten oder nicht zu arbeiten; hier zeigt sich die »Multioptionsgesellschaft« ausgesprochen spröde, zugeknöpft. Alle Freiheiten, die sie offeriert, alle Rechte, die sie zu vergeben hat, beruhen, Reiche sowie Menschen mit schwerwiegenden körperlichen oder geistigen Handicaps ausgenommen, auf der faktischen Pflicht zur Arbeit. Ein Recht auf Arbeit gibt es nicht, was wiederum zu denken gibt.
Rechte ohne korrespondierende Pflichten, das passt zu reifen demokratischen Gesellschaften. Verhaltensweisen, die den Bestand des Ganzen nicht tangieren, werden freigegeben, ins Belieben der Einzelnen, ihrer Urteilsfähigkeit, gestellt. So fand, seit jeder und jede Erwachsene eine Ehe schließen, es aber auch bleiben lassen konnte, die Jahrhunderte währende Diskriminierung lediger, obzwar heiratsfähiger Frauen ein von diesen lange herbeigesehntes Ende. Das Recht junger Männer, den Wehrdienst aus Gewissensgründen zu verweigern, gibt ein weiteres Beispiel dieser Entwicklung aus jüngerer Zeit.
Pflichten ohne dazugehörige Rechte verletzen dagegen die demokratischen Sitten, schaffen soziale Verhaltenszwänge ohne persönlichen Ausweg, suspendieren das Urteil der Einzelnen, ihren Willen. Nichts demonstriert die Sittenwidrigkeit des Arbeitszwangs auffälliger als der Umstand seiner offiziellen Leugnung. Verfassungen, Gesetze schweigen sich darüber aus; amtlich davon zu reden wäre peinlich, heikel für einen Repräsentanten des Gemeinwesens mit politischem Taktgefühl.
Diese Heimlichkeiten aufzustöbern ist der erste Zweck der Forderung nach Arbeit als Option, als persönlich (ab)wählbarer Zumutung. Diese Forderung überzeugt zwingend nur im Zusammenhang mit einer zweiten, die das Recht auf Leben, auf Lebensunterhalt auch ohne Arbeit proklamiert. Und umgekehrt: Wer für ein von Arbeit abgelöstes Recht auf Leben streitet, gelangt, sofern er alle Konsequenzen zieht, die darin liegen, zur Ablehnung jeglicher Arbeitspflicht, zu »Arbeit als Option«. Das erst verleiht dem Ansinnen eines bedingungslosen Grundeinkommens seine ganze Schärfe, seinen radikalen Witz: Wer nicht arbeitet, soll trotzdem essen und auch ansonsten leben wie irgendeine(r) aus der Mitte der Gesellschaft: sotzial unangefochten, erhobenen Hauptes.
2.
Einleitende Bestimmungen
»Arbeit« – dieser Ausdruck dient hier und im Folgenden als Kürzel für »Berufsarbeit«, für betriebsmäßig organisierte, mit dem Anspruch auf Entgelt verbundene »Erwerbsarbeit«.
Ob das, was Menschen jenseits der Berufsarbeit für sich sowie mit anderen unternehmen, wiederum als »Arbeit« gelten kann, ist im Rahmen dieser Betrachtungen ohne Belang, eine Sache der persönlichen Auslegung. Wer, von Erwerbsarbeit befreit, seinen Lebensvollzug weiterhin als »Arbeit« deutet, mag daraus dieselbe Genugtuung schöpfen wie jemand, der sich hinfort primär als handelnder, als tätiger Mensch begreift. Jeder sein eigener Epikureer!
Aufgrund ihrer unauflöslichen Zusammengehörigkeit können sich die Ausdrücke »Arbeit als Option« und »(bedingungsloses) Grundeinkommen« wechselseitig vertreten. Je nach dem leitenden Akzent steht mal dieser, mal jener Terminus für das von ihm Mitgemeinte.
Für die öffentliche Wahrnehmung bildete das Thema »Grundeinkommen« das eigentliche Reizthema und übertönte die darin enthaltene Forderung nach (ab)wählbarer Arbeit. Das dürfte der zeitgenössischen Fixierung auf unmittelbar materielle Fragen zuzuschreiben sein. Kein Umsturz der kulturellen Selbstverständlichkeiten ohne vorherige Konsultation des Kassenwarts: Wer soll das bezahlen?
»Heimat ist, / Wo die Rechungen ankommen«, schreibt Heiner Müller in einem seiner späten Gedichte …
3.
Grundeinkommen: Stand der Debatte
Noch vor wenigen Jahren stritten nur ein paar Außenseiter für ein Grundeinkommen, sicher und auskömmlich genug, um den Menschen und den Bürger vom Arbeiter zu emanzipieren. In der breiteren Öffentlichkeit fanden sie kaum Gehör. Journalisten, erst recht leitende Redakteure in den Massenmedien weigerten sich zumeist standhaft, die Diskussion zu führen. Hier und da dennoch in Angriff genommene Recherchen scheiterten an der Publikationsschwelle; das Thema war weithin tabu.
Heute wird es allenthalben diskutiert, in den Massenmedien, den Parteien, unter Wissenschaftlern und Publizisten, sogar Ministerpräsidenten und Unternehmer äußern sich zustimmend oder erwecken immerhin den Anschein geistiger Aufgeschlossenheit. Öffentliche Veranstaltungen zu dieser Frage finden regen Zuspruch, und wer bei solchen Gelegenheiten gegen das Grundeinkommen opponiert, gerät schnell ins Abseits. Binnen kurzer Zeit hat sich der Wind gedreht und das Tabu hinweggefegt.
Wie weit die Debatte unterdessen fortgeschritten ist, zeigen die erörterten Probleme. Es geht nicht länger um das Ob, sondern nur mehr um das Wie und
Wer.
Wie hoch muss das Grundeinkommen ausfallen, um ein menschenwürdiges Leben nach unserem kulturellen Standard zu ermöglichen? Wie großzügig darf es, unter Rücksichtnahme auf die ökonomischen Kapazitäten des Gemeinwesens, bemessen sein? Wer gelangt in den Genuss desselben, alle auf einem bestimmten Hoheitsgebiet Lebenden oder nur die mit eingetragener Staatsbürgerschaft? Ab welchem Alter können Menschen frei darüber verfügen? Erst mit vollendeter Volljährigkeit? Wie verhält es sich dann mit dem Rechtsanspruch von Kindern und Jugendlichen? Wie wird das Grundeinkommen finanziert, welche Steuern, direkte wie indirekte, und welche sonstigen Erwerbsarten und -quellen gelangen dabei in welchem Verhältnis zum Einsatz?
Der unvollständige Fragenkatalog beweist: Die öffentliche Meinungsbildung, spät in Gang gekommen, ist in ihre zweite, pragmatische Phase eingetreten, und gemessen an der skizzierten Ausgangslage ist das eine erstaunliche Entwicklung.
Nimmt man an derlei Verhandlungen teil, entsteht leicht der Eindruck, als sei das Grundeinkommen eine bereits beschlossene Sache, als ginge es einzig um Details. Das hieße, bei allem verständlichen Elan, gefährliche Täuschungen zu nähren und die Diskussion zu überstürzen. Beschlossen ist hier gar nichts, abzuwägen und zu bereden noch immer viel. Wer die Grundfragen als im Wesentlichen geklärt ansieht und nun Gesetze schreiben möchte, irrt nicht nur faktisch – die Gegner werden sich erneut zu fassen und zu wehren wissen –: Er erstickt die Fanfare einer kühnen sozialen Utopie im Handgemenge ihrer voreiligen Verwirklichung.
4.
Eine unerhörte Freiheit
Arbeiten oder nicht arbeiten – diese Alternative existierte niemals in der bisherigen Menschheitsgeschichte. Zwar: die einen arbeiteten und die anderen nicht, doch weder für diese noch für jene verband sich damit eine Wahl. Wer arbeitete, war dazu bestimmt, verurteilt durch soziales Schicksal, durch das Hineingeborensein in den beklagenswerten Stand der Arbeitsleute. Wer die Früchte der Arbeit nur genoss, ohne selbst zu säen und zu ernten, lebte aus demselben Grund im Stand der Muße.
Das einzige Problem, das er (oder, sofern zur »guten« Gesellschaft zugelassen, sie) zu lösen hatte, bestand darin, der Freiheit Form zu geben, die Zeit zu binden und zu füllen, die unweigerlich verstrich. Leben aus innerem Antrieb oder im Laufrad nichtiger Vergnügungen, tätige Muße oder Müßiggang, dem Gespenst der Freiheit – der Langeweile – untertan, so lautete die Schicksalsfrage privilegierten Daseins.
Wird Arbeit zur Option, verblassen diese Kontraste – im Prinzip.
Die Arbeit verliert ihr Stigma, ihren Zwangscharakter, der ihr selbst dann anhaftet, wenn sie sachlich anspruchsvoll, subjektiv befriedigend vonstattengeht. Die Muße löst sich vom sozialen Vorrecht, steht jeder und jedem zu Gebote, die sich ihr gewachsen fühlen. Verbindliche, gar einklagbare Glücksversprechen gehen damit nicht einher. Niemand ist davor gefeit, bei dem Versuch, die Freiheit zu ergreifen, sie tätig anzueignen, Schiffbruch zu erleiden, dem eigenen Versagen ausgeliefert.
Um zu verhindern, dass sich die neue Freiheit, ehe ihre Zeit gekommen ist, blamiert, ist eines unbedingt vonnöten: praktische Ermutigung zur Freiheit, Schulung, Förderung von Freiheitsfähigkeit. Ein Gemeinwesen, das mehr Freiheit für alle wagen will, es aber gleichzeitig versäumt, die Leidenschaften und Motivationen zu wecken, die das Wagnis kalkulierbar halten, erwiese der guten Sache einen schlechten Dienst und verdiente Spott und Häme.
Die inneren Freiheitsschranken fallen nicht von einem Tag zum anderen, und daher ist für eine hoffentlich nicht allzu lange Zeit des Übergangs von dem ausgeprägten Unbehagen zumindest eines Teils derer, die Arbeit leisten, auszugehen. Solange sie auf dem Gegenpol, dem der freiwilligen Nichtarbeit, Menschen vorfinden, die sich in ihrer Freiheit nicht zu raten wissen, die das kostbare Geschenk, frei verfügbare Zeit, wie Tand verschleudern, ist das nur zu verständlich. Wozu materielle Opfer leisten, auf Dauer, ein ganzes Arbeitsleben lang, wenn sie bei denen, die sie empfangen, so wenig fruchten?
Um das unerhörte Freiheitsversprechen, das (ab)wählbarer Arbeit innewohnt, hören zu können, gelassen, ohne Vorurteile und Affekte, bedarf es sozial entspannter, gelassener Menschen – auf beiden Seiten des Arbeitsgeschehens.
5.
Eine »heillose« Freiheit
Wer sich, auf eine Grundsicherung gestützt, aus der Arbeitswelt zurückzieht oder von vornherein für ein Leben ohne Arbeit ausspricht, verändert unbesehen und ungewollt auch die Maßstäbe jener, die ihre Existenz weiterhin an Arbeit binden. Das Recht auszusteigen »gehört« den nun nicht mehr Arbeitenden ebenso wie den unbeirrt Arbeit Leistenden, was diese aber insofern doch beirren dürfte, als sie das, was sie tun, nun nicht mehr tun müssten. Selbst wenn sie nie daran dachten, ihre Arbeit aufzugeben, arbeiten sie unter den gewandelten Verhältnissen objektiv als sozial »Freischaffende«. Ihre Arbeit verliert ihren fraglosen Charakter, ihren Notwendigkeitsbezug, wird, um es ungeschminkt zu sagen, zur fakultativen Veranstaltung – eine herbe Zumutung für alle, die sich in einer langen Generationsfolge daran gewöhnten, Arbeit aufgrund ihrer Himmelfahrt zum Kosmos der ewigen Werte hoch zu schätzen. Die (Ab-)Wählbarkeit von Arbeit zersetzt diesen semi-religiösen Anstrich des Erwerbs, die Ineinssetzung von Menschsein und Stelle, von Bürgerrolle und Beruf, und bürdet dem Arbeitsgläubigen die ganze Begründungslast für sein Verbleiben im Erwerbsgeschehen auf. Selbst wenn er oder sie gute Gründe dafür finden – ordentlichen Lohn, verträgliche Kollegen, verständnisvolle Vorgesetze –, ihr Groll auf die »Aussteiger«, auf die »Deserteure«, die sie ungefragt in die Freiheit vertrieben, dürfte nicht sogleich verfliegen.
Wähler wider Willen und ohne je gewählt zu haben, werden sie nicht umständlich nach Argumenten gegen die Entweihung ihrer Lebensweise suchen müssen.
Mag der Entschluss, die Arbeit abzuwählen, auch legal sein, so ist er deshalb längst nicht legitim. Entschieden sich alle für den Arbeitsverzicht, gäbe es bald niemanden mehr, der sich um das materielle Fundament der Freiheit mühte. Eine Freiheit, die sich im selben Zuge auflöst, in dem sie sich verallgemeinert, ist ein Widerspruch in sich.
Solange dieser Einwand nicht auf derselben prinzipiellen Ebene, auf der er sich bemerkbar macht, entkräftet wird, ist das »Recht auf Leben ohne Arbeit« nur eine kecke Redensart.
6.
Eine schwierige Freiheit
Arbeiten oder nicht arbeiten – auch wer leidenschaftlich für diese Alternative streitet, wird bei ruhiger Überlegung sehen, dass sie tiefer und folgenreicher in das Gesellschaftsgefüge eingreift als sämtliche ihr vorausgegangenen Wahlfreiheiten.
Kleiderordnungen, Heiratszwänge, Bildungsprivilegien, an Herkunft, Hautfarbe oder Geschlecht gebundene Wahlrechte aktiver wie passiver Art: derartige Verhaltensvorschriften aufzuheben, bedurfte es langer, oft genug erbittert geführter Auseinandersetzungen zwischen bevorrechteten und benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen. Meist fielen die Schranken erst im Gefolge revolutionärer gesellschaftlicher Umbrüche. Die faktische Pflicht zur Arbeit, der insbesondere die zum »Volk« zählenden Klassen unterlagen, blieb davon unberührt. Die am weitesten gehenden Forderungen auf diesem Gebiet zielten auf die konstitutionelle Verankerung eines Rechts auf Arbeit. Außer in den kommunistischen Staaten kam es nirgendwo zum Zuge und dort auf eine rüde Weise. Das Recht zu arbeiten stand im Schatten eiserner Arbeitspflicht; wer der nicht genügte, galt als asozial – ein potenzieller Fall für die Gerichte.