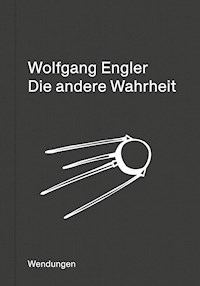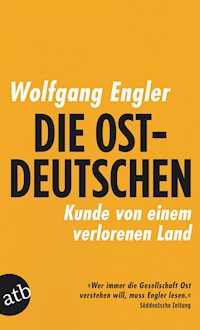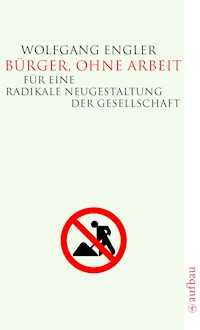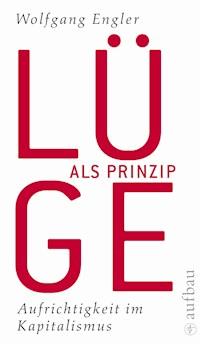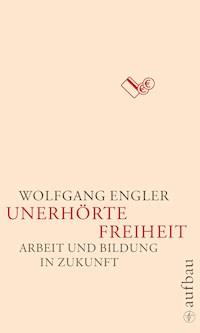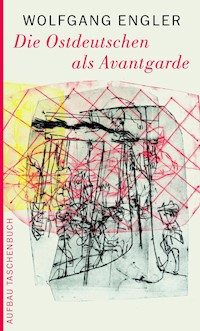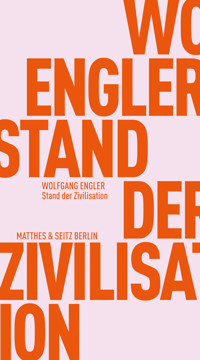
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Überzeugung, die Demokratie mitsamt ihren Gesetzen und Vorschriften biete den besten Weg, friedlich und gedeihlich miteinander zu leben, scheint in Teilen der Bevölkerung zu schwinden. Übergriffe gegenüber Beschäftigten des öffentlichen Diensts, Angriffe auf Migranten und Flüchtlinge nehmen seit Jahren zu. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht in Ämtern, gegen Rettungsdienste oder Kulturinstitutionen gepöbelt, gespuckt und auch geschlagen wird. Zivile Verhaltensstandards und Verbindlichkeiten werden inmitten der Normalität des sozialen Verkehrs aufgekündigt, ohne dass Elend, massenhafte Armut, Verwüstung durch Kriege oder staatliche Gewaltexzesse dafür verantwortlich gemacht werden könnten. Vielmehr sind es molekulare Aggressionen, die sich in den noch weitgehend intakten und geschäftigen Alltag einnisten und durch ihre Ausbreitung und ihren Gewöhnungseffekt ansteckend wirken. Ihnen geht Wolfgang Engler anhand persönlicher Erfahrungen und mit dem Blick des scharfsinnigen Soziologen nach, begibt sich in die Kampfzone, in der das Faustrecht wieder gilt, und stellt Überlegungen an, wie und ob man diese zivilisatorische Gefährdung befrieden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Stand der Zivilisation
Fröhliche Wissenschaft 259
Wolfgang Engler
Stand der Zivilisation
Inhalt
Einleitung
I. Molekulare Aggressionen
II. Das zivilisatorische Kalkül
III. Enthemmung
IV. Streit um die wahre Zivilisation
V. Umkämpfter Fortschritt
VI. Die Krise der hegemonialen Kultur
VII. Bildung als zivilisatorisches Projekt
VIII. Kampf um die Zukunft
IX. Zivilisation und moralische Indifferenz
X. Individualismus und Gemeinwohl
XI. Ausblick
Anmerkungen
Einleitung
»Die Zivilisation ist niemals vollendet und immer gefährdet« – Worte von Norbert Elias, Quintessenz seiner bahnbrechenden Untersuchungen zur Sozio- und Psychogenese von Zivilisationsprozessen und zugleich Leitmotiv dieses Essays.1 Mit seinen Schriften kam ich noch in der DDR Mitte der 1980er-Jahre in Berührung, las, von der Klarheit und sprachlichen Eleganz seiner Gedankenführung gleichermaßen beeindruckt, was ich mir über die Mauer hinweg besorgen konnte. Meine eigene Erfahrung, die soziale Formung und Konditionierung des Selbst in einer Gesellschaft wie der ostdeutschen, floss in die Lektüre ein, und so stieß ich bei allen Gemeinsamkeiten mit dem westlichen Zivilisationstyp auf eine ganze Reihe gravierender Unterschiede. Auch die DDR war eine moderne Industriegesellschaft, aber das funktionale Zusammenwirken vollzog sich unter andersartigen ökonomischen, politischen, rechtlichen, kulturellen Rahmenbedingungen, die den Modus von Selbstkontrolle und Affektmodellierung nachhaltig beeinflussten. Ein industriegesellschaftlicher Zivilisationstyp, aber zwei soziokulturelle Zivilisationsmuster – das war der Ertrag meiner Überlegungen, die ich schließlich in einem Essay ausformulierte (Die zivilisatorische Lücke. Versuche über den Staatssozialismus, edition suhrkamp, 1992). An der – Überlegungen des späten Elias fortführenden – Unterscheidung zwischen einem fremdzwang- und einem selbststeuerungsdominierten Affektregime halte ich fest. Sie erscheint mir fruchtbar, um die Gründe für den heutigen »Streit der Zivilisationen« auch in der deutschen Gesellschaft unaufgeregt in den Blick zu nehmen und nach Möglichkeit zu entschärfen. Es ist schon einiges erreicht, wenn Menschen sich von der Vorstellung lösen, sie selber seien zivilisiert, die anderen aber nicht.
Die Zivilisation – nie vollendet, immer gefährdet. Wer so denkt, ist von geschichtlichem Optimismus wie Pessimismus gleich weit entfernt. Als deutscher Jude, der den Nazis entkommen war, aber alle seine Angehörigen im Holocaust verloren hatte, lag für Elias ein erneuter Zusammenbruch der Zivilisation im Bereich des Möglichen. Aber er verlor nie die Hoffnung, dass die Menschen das Äußerste abwenden, dass sie, mehr noch, Wege finden können, friedfertig und gedeihlich miteinander umzugehen – über Generationen hinweg und ohne Rückfälle in die Barbarei. Für ihn boten die westlichen Demokratien am ehesten die Gewähr, dass das gelingen könnte. In ihnen gründet der zivilisierte Umgang der Bürger miteinander nicht allein auf dem staatlichen Gewaltmonopol, das Hoheitsgebiete nach innen befriedet und die Einzelnen daran hindert, ihre Konflikte handgreiflich auszutragen. Unerlässlich, um zivile Verkehrsformen auf Dauer in den Gewohnheiten des Alltags zu verankern, ist die Demokratisierung dieses Monopols, die Mitbestimmung und Mitwirkung der Bürger an der Gestaltung ihres gemeinschaftlichen Lebensprozesses. Parteien, Parlamente, Vereine, Organisationen, zivilgesellschaftliche Initiativen, staatsferne Medien und eine unabhängige Rechtsprechung vermitteln diese Teilhabe und überzeugen die Einzelnen von den Vorteilen jener Triebkontrolle, die unverzichtbar ist, um in großer Zahl gewaltfrei und halbwegs ersprießlich miteinander auszukommen.
Nun scheint genau diese Überzeugung in Teilen der Bevölkerung zu bröckeln, ohne dass staatliche Gewaltexzesse, Elend, massenhafte Armut, Verwüstungen durch Kriege oder Bürgerkriege dafür verantwortlich gemacht werden könnten. Die Aufkündigung ziviler Verhaltensstandards und Verbindlichkeiten beginnt inmitten der Normalität des sozialen Verkehrs, gleichsam aus dem Nichts. Ein Rückblick auf solche scheinbar unvermittelten Ausbrüche soll dies veranschaulichen und zugleich erste Spuren für eine Diagnose legen.
I. Molekulare Aggressionen
Kürzlich beim Arzt. Ich habe einen Termin und bin pünktlich vor Ort. Die Praxis ist gut organisiert, das weiß ich aus Erfahrung. Kaum längere Wartezeiten, selten mehr als ein, zwei Patienten gleichzeitig im Wartezimmer. Diesmal ist es beinahe voll und ich ahne: Das könnte dauern. Es dauert. Auch nach einer Stunde bin ich noch nicht an der Reihe. Die Stimmung um mich herum verfinstert sich zusehends. »Unverschämtheit«, platzt es aus einem mittelalten Mann heraus. »Man sitzt sich wund und bekommt keinerlei Information.« Andere pflichten ihm bei. Einer geht zur Arzthelferin und kläfft sie an: »Sagen Sie mir jetzt endlich, wie lange ich noch warten muss, langsam reicht's.« »Nur mit uns Kassenpatienten kann man so umspringen«, empört sich eine Frau. »Bei Privatpatienten hätte sich Frau Doktor schon dreimal entschuldigt. Aber wir haben ja keine Wahl.« In diesem Moment werde ich aufgerufen. »Der ist doch viel später gekommen als ich, das geht doch nicht«, ruft mir einer beim Betreten des Behandlungsraums in den Rücken.
Wir kennen uns seit vielen Jahren, und während sie mich abhört, klärt mich die Ärztin über die Situation auf. Gleich zu Beginn der Sprechstunde zwei Patienten mit ernsten Erkrankungen, was gründliche Abklärung und längere Gespräche nach sich zog. Dann noch Probleme mit dem Computer, daher der Stau. Sie verstehe den Ärger der Wartenden. Aber mitunter genügten geringfügige Störungen im Ablauf, um Patienten in Rage zu bringen. Manche protestierten unflätig, weil sie nicht die Medikamente bekämen, die sie verlangt hätten. Vor einigen Wochen sei ein Mann in ihre Praxis gestürmt, der kein Patient war, und habe gefordert, umgehend behandelt zu werden. Sie habe sich geweigert, er sei laut geworden, schließlich habe sie mit der Polizei gedroht. Dann sei er fluchend gegangen. Ähnliches höre sie von Kollegen und Kolleginnen, einige hätten sogar von Tätlichkeiten berichtet. Sie praktiziere seit drei Jahrzehnten, und die meiste Zeit ohne Probleme. Aber in den letzten Jahren haben sich die Ärgernisse gemehrt. Leute rasteten jetzt sehr viel schneller aus als früher. Sie bringen ihre Wut schon mit.
Wie aussagekräftig sind solche Äußerungen für die allgemeine Situation in Arztpraxen hier und heute? Eine Netzrecherche stützt die Sorgen meiner Ärztin. Im Januar 2024 veröffentlichte Der Spiegel die Ergebnisse einer Anfrage bei allen sechzehn Landeskriminalämtern. Bundesweit ist demnach die Zahl der sogenannten Rohheitsdelikte in medizinischen Einrichtungen seit 2019 stark angestiegen, in manchen Bundesländern, Saarland, Bremen, Niedersachsen, hat sie sich verdoppelt. Bei den Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder und Berufsverbände, die im direkten Kontakt mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten stehen, häufen sich die Berichte von »genervten« Medizinern. Ein Allgemeinmediziner in Leipzig beobachtet seit Jahren einen Aufwuchs von verbalen und sogar körperlichen Angriffen durch Patientinnen und Patienten. Die Arzthelferin einer Augenarztpraxis in Rheine in Nordrhein-Westfalen erzählt, dass Patienten bereits handgreiflich geworden sind. Die Praxis hat inzwischen ein Schild mit der Aufschrift »Null Toleranz« aufgestellt: »Aggressives, beleidigendes und gewalttätiges Verhalten« werde nicht toleriert und »konsequent zur Anzeige gebracht«.
Der Spiegel zitiert in seiner Ausgabe vom 13. August 2024 den Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen: »Offene Aggression und ein extrem forderndes Verhalten haben deutlich zugenommen. Nicht nur in Notaufnahmen, auch bei den Niedergelassenen eskaliert die Lage immer öfter.« Dabei gehe es sowohl um Beleidigungen als auch um körperliche Gewalt: »Ich hatte selbst schon einen Patienten, der eine Tür kaputt getreten hat.« Die Probleme gingen auf eine »kleine, leider aber größer werdende Klientel« zurück: »Dass sich Patienten nicht benehmen können und eine schräge Einschätzung der eigenen Behandlungsdringlichkeit haben, ist ein nationenübergreifendes Phänomen. Was sich allerdings auch häuft: Da ist einer krank, und sechs Leute kommen als Begleitung mit in die Praxis oder die Notaufnahme und machen Radau. Das ist bemerkenswert und extrem unangenehm.«
Wie unangenehm das sein kann, zeigte ein Vorfall im Essener Elisabeth-Krankenhaus Mitte September 2024. Dort griffen Besucher eines Patienten die Pflegekräfte derart heftig an, dass sechs von ihnen verletzt wurden, eine 23-Jährige schwer und fünf weitere Mitarbeiter leicht. Ein 41-jähriger Tatverdächtiger türkisch-libanesischer Herkunft wurde festgenommen und am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt. Nahezu zeitgleich kam es zu einem unvermittelten Angriff auf das Reanimationsteam und weiteres Personal des Elisabeth-Krankenhauses. Die Klinikleitung sah in dem Vorfall eine Zäsur – »hier hat eine bisher noch nie dagewesene Aggressivität und Gewalt gegenüber Mitarbeitenden unseres Hauses stattgefunden« – und führte Zugangskontrollen ein.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert mehr Schutz für Ärzte und Pflegepersonal vor zunehmender Gewalt. Fast jede zweite Klinik beschäftigt inzwischen Sicherheitsdienste. Der Kaufmännische Vorstand des Uniklinikums Dresden, Frank Ohi, berichtet, seine Sicherheitsleute müssten pro Monat zu vierzig bis fünfzig Einsätzen, »die sich aus auffälligen Situationen ergeben«. Ein Patient habe »ein ganzes Zimmer kurz und klein geschlagen«, ein anderer habe in seinem Gepäck für den stationären Aufenthalt eine Machete mitgebracht. »Das Aggressionspotenzial ist heute wesentlich höher als noch vor 25 Jahren.«
Die Studie »Gewalt in der Notfallmedizin – gegenwärtiger Stand in Deutschland«, die im Georg Thieme Verlag erschienen ist, ermittelte bei 90 Prozent der befragten Rettungsdienstmitarbeiter sowie 75 Prozent der Mitarbeiter in Notaufnahmen Erfahrungen mit verbaler und physischer Gewalt. Die Taten ereigneten sich überwiegend nachts, wobei vielfach Alkohol und Drogen die Affektkontrolle außer Kraft setzten. Eine steigende Zahl von Übergriffen entfiele auf »Patienten mit vermutetem Migrationshintergrund«.
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und der Deutsche Feuerwehrverband publizierten im Dezember 2023 eine »Befragung zu Gewalt gegen Einsatzkräfte«. Es gab 6500 Rückmeldungen, in denen die Befragten über ihre Erfahrungen während der vergangenen zwei Jahre berichteten. Viele erlebten Beschimpfungen, Beleidigungen, Einschüchterungen und Drohungen, sahen sich in ihrem Dienst mit Verweigerung, Widerstand, fehlender Kooperation konfrontiert, gaben an, mit Feuerwerkskörpern beworfen worden zu sein, meldeten Gewalt bei technischen Hilfeleistungen und im Rettungsdienst. Einige wurden bei der Kontrolle von Fahrzeugen mit Anfahren bedroht.
*
Wahlplakate des politischen Gegners zu übermalen oder abzureißen ist kein Novum. Bis in die jüngste Vergangenheit geschah das zumeist in den frühen Morgenstunden oder im Schutz der Dunkelheit; schließlich handelt es sich hier um Straftaten. Inzwischen scheut man keine Zeugen mehr, passt Wahlhelfer beziehungsweise Kandidaten beim Anbringen der Plakate ab, attackiert sie verbal, in manchen Fällen auch physisch.
Unmittelbare Gewalt widerfuhr im jüngsten Europawahlkampf im Juni 2024 dem SPD-Politiker Matthias Ecke im Dresdener Stadtteil Striesen. Vier Personen beschimpften ihn als »scheiß Grünen«, dann schlugen und traten sie ihn und verletzten ihn so schwer, dass er später im Krankenhaus operiert werden musste. Handgemein wurde es auch an Wahlkampfständen. In Nordhorn in Niedersachsen bewarf ein Mann einen AfD-Landtagsabgeordneten mit einem Ei und schlug ihm ins Gesicht. Solche Vorkommnisse, die alle Parteien betreffen, obschon nicht alle gleichermaßen, häufen sich seit einigen Jahren.
Die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD, wie viele Angriffe auf allen politischen Ebenen registriert wurden, vermittelt einen ungefähren Überblick über das Tatgeschehen sowie die Hauptbetroffenen. Waren 2019 vor allem Vertreter der AfD Ziel von Anfeindungen, verlagerte sich der Hass 2023 verstärkt auf die Grünen. Insgesamt stiegen die registrierten Straftaten von 2019 bis 2023 gegen alle Parteien, die meisten Delikte im Gesamtzeitraum richteten sich gegen die AfD.
Im vorgezogenen Bundestagswahlkampf geriet die CDU ins Zentrum der Attacken. Nachdem Ende Januar 2025 die Konservativen gemeinsam mit der AfD für eine Verschärfung der Migrationspolitik gestimmt hatten, wurden landesweit Plakate beschmiert, heruntergerissen, Wahlstände demoliert, Wahlkämpfer beleidigt, bespuckt, körperlich angegriffen. In weiten Teilen Berlins war Wahlwerbung für diese Partei aus dem öffentlichen Raum nahezu verschwunden.