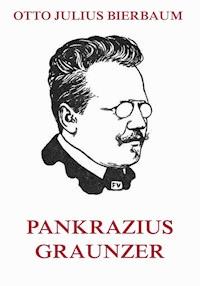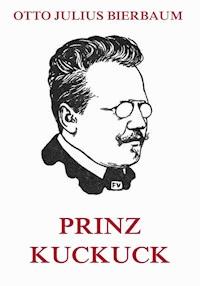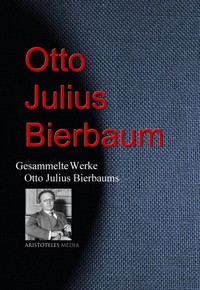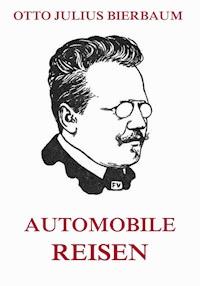
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bierbaums 1903 erschienenes Reisebuch "Eine empfindsame Reise im Automobil" schildert eine Fahrt, die das Ehepaar Bierbaum 1902 mit einem Cabrio der Marke Adler von Deutschland über Prag und Wien nach Italien (und auf der Rückreise via die Schweiz) unternahm. Eine weitere, hier enthaltene Fahrt, führte ihn von münchen über Innsbruck nach Südtirol.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Automobile Reisen
Otto Julius Bierbaum
Inhalt:
Otto Julius Bierbaum – Biografie und Bibliografie
Eine empfindsame Reise im Automobil
Vorwort
I. Von Berlin nach Wien
II. Von Wien nach München
III. Von München nach Eppan
IV. Von Eppan nach Venedig
V. Von Venedig nach Rimini
VI. Von Rimini nach San Marino und zurück
VII. Von San Marino bis Florenz
VIII. Von Florenz bis Siena
IX. Von Siena bis Perugia
X. Von Perugia bis Terni
XI. Von Terni bis Frascati
XII. Von Frascati bis Neapel
XIII. Aus Neapel
XIV. Ausflüge von Neapel (Solfatara, Pompeji, Vesuv) und Fahrt nach Sorrent
XV. Cocumella und Ausflüge von dort (Amalfi, Capri)
XVI. Von Sorrent bis Rom
XVII. Von Rom bis Mailand.
XVIII. Von Mailand bis Stein am Rhein
Eine kleine Herbstreise im Automobil
I. München –Innsbruck.
II. Innsbruck– Bozen – Eppan.
III.
Automobile Reisen, O. J. Bierbaum
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849627218
www.jazzybee-verlag.de
Otto Julius Bierbaum – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 28. Juni 1865 zu Grünberg in Schlesien, verstorben am 1. Februar 1910 in Dresden. Studierte in Zürich, Leipzig, München und Berlin, widmete sich jedoch bald der literarischen Tätigkeit. Der modernen Kunsttheorie huldigend, übernahm er 1892 in Berlin die Redaktion der »Freien Bühne«, der er den Namen »Neue deutsche Rundschau« gab, gründete hierauf mit Julius Meier-Graefe die Kunstzeitschrift »Pan«, die er bis 1895 leitete, und lebt jetzt als Mitherausgeber der »Insel« in Berlin. Vorübergehend gehörte er der Überbrettlbewegung an. Außer den Monographien »Detlev von Liliencron« (Leipz. 1892), »Fritz von Uhde« (Münch. 1893), »F. Stuck« (das. 1893, Text zu Reproduktionen Stuckscher Werke) und dem Band »Stuck« in Knackfuß' Künstler-Monographien (Bielef. 1899) u. a. veröffentlichte er »Erlebte Gedichte« (Berl. 1892) und einen zweiten Band Lyrik: »Nemt, Frouwe, disen Kranz« (1894); ferner die Novellen: »Studentenbeichten« (1893, 4. Aufl. 1899; 2. Reihe 1897), »Die Schlangendame« (2. Aufl. 1897), »Kaktus und andre Künstlergeschichten« (3. Aufl. 1898); die Romane: »Die Freiersfahrten und Freiersmeinungen des weiberfeindlichen Herrn Pankrazius Graunzer« (1896 u. ö.), »Stilpe« (2. Aufl. 1897), »Das schöne Mädchen von Pao« (1899); gesammelte Essays, Gedichte, Sprüche, u. d. T.: »Der bunte Vogel von 1897, ein Kalenderbuch« (1896) und »von 1899« (1898); Dramatisches: »Lobetanz, ein Singspiel« (1895), »Gugeline, ein Bühnenspiel« (1899), »Pan im Busch«, Tanzspiel (mit Musik von F. Mottl, 1900), sämtlich in Berlin erschienen, und »Irrgarten der Liebe«, Lieder, Gedichte und Sprüche aus den Jahren 1885–1900 (Leipz. 1901). Auch gab B. den »Modernen Musenalmanach« (Münch. 1891, 1893, 1894) und »Deutsche Chansons (Brettl-Lieder)« (Berl. 1901) heraus.
Eine empfindsame Reise im Automobil
von Berlin nach Sorrent und zurück an den Rhein
Vorwort
Wenn jemand eine Reise tut, So kann er was erzählen
sagt Herr Urian, und ich füge hinzu: er kann's nicht bloß, er will's meist auch. Das Erzählen in langen und breiten Briefen aber, wie und es hier verübt habe, ist im allgemeinen aus der Mode gekommen. Erstens wohl, weil das Reisen nichts weiter besonderes mehr ist, dann, weil man heute überhaupt nicht mehr gerne lange Briefe schreibt, und schließlich, weil es überall Ansichtspostkarten gibt. Wenn ich trotzdem diese Briefe geschrieben und mich sozusagen in einen gewissen Gegensatz zu meinen Zeitgenossen gebracht habe, so ist dies nicht lediglich aus der bösen Lust am Andersmachen zu erklären, sondern, vielleicht, zu entschuldigen durch folgende drei Umstände. Erstens: Meine Reise war etwas besonderes. Zweitens: Ich schreibe gerne lange Briefe. Drittens: Auf den Ansichtspostkarten ist so schrecklich wenig Platz, daß sie meinem Mitteilungsbedürfnis nicht genügen.
Der Hauptgrund ist natürlich der erste. Es wird zwar, wie ich glaube, nicht mehr lange dauern, und das Reisen im Automobil ist etwas gewöhnliches; vor der Hand aber gehören längere Reisen dieser Art noch zu den Seltenheiten. Die vorliegende Schilderung eines solchen Unternehmens ist, soviel ich weiß, die erste, die in Deutschland als Buch veröffentlicht wird. Nur in Sportszeitungen bin ich kürzeren Beschreibungen längerer Touren begegnet, und bei ihnen handelte es sich fast ausschließlich um Äußerungen rein sportlichen Interesses. Meine Reise aber hat mit dem Automobil sport als solchem nicht viel zu tun, – sonst hätte ich sie nicht als eine empfindsame Reise bezeichnen können, denn was ein richtiger »Automobilist« ist, der kennt die Empfindsamkeit nicht. Ich meine das Wort natürlich in seiner alten Bedeutung und nicht in dem Sinne von Sentimentalität, den es jetzt angenommen hat. Empfindsamkeit heißt mit der Zustand und die Gabe stets bereiter Empfänglichkeit für alles, was auf die Empfindung wirkt, die Fähigkeit und Bereitschaft, neue Eindrücke frisch und stark aufzunehmen. Mit offenen, wachen, allen Erscheinungen des Lebens, der Natur zugewandten Sinnen reisen nenne ich empfindsam reisen, und dieses Reisen allein erscheint mir als das wirkliche Reisen, wert und dazu angetan, zur Kunst erhoben zu werden. Doch darüber wird man in diesen Briefen meine Meinung öfter vernehmen, und ich hoffe, daß dieses Buch meine Leser davon überzeugen wird, daß wir jetzt im Automobil das Mittel an der Hand haben, die Kunst des Reisens aufs neue zu pflegen und noch weiter zu führen, als es ihr in der Zeit der Reisekutschen beschieden gewesen ist, denen unsre Vorfahren Genüssen zu verdanken gehabt haben, wie sie der Eisenbahnreisende nicht einmal ahnt. Der gewöhnliche »Automobilist« allerdings auch nicht; der ist dazu zu sehr Sportsman. Erst, wenn der Automobilismus aufhört, ausschließlich ein Sport zu sein, wird er für die Kunst des Reisens das bedeuten, was seine eigentliche Bestimmung ist.
Ich möchte nicht mißverstanden werden: Ich unterschätze die Bedeutung des Automobilsports für die Entwickelung der Sache keineswegs, schlage sie vielmehr hoch an und lasse mich darin auch durch die Auswüchse des Rennwagenwesens nicht irre machen. Dieses wird für die Motorwagenindustrie immer die Bedeutung haben, die der Rennpferdesport für die Pferdezucht hat. Aber das Eigentliche dieser großen neuen Erscheinung, die den Rang eines starken Kulturfaktors hat, liegt nicht im Sport. Der hat nur Experimentalwert. In der Ausnutzung seiner Resultate für das allgemeine, in seiner Übersetzung ins praktische Leben liegt die Zukunft des Automobilismus.
Meine Reise war der Versuch einer praktischen Probe auf das Exempel des Sports, und ich bringe ihre Schilderung vor die Öffentlichkeit, weil sie gelungen ist, und zwar gelungen nicht mit einem der Millionärsvehikel, die nur Portemonnaiegranden erschwinglich sind, sondern mit einem leichten, billigen Wagen. – Für mich wäre er freilich immer noch zu teuer gewesen, und so will ich, um mich keiner Vorspiegelung falscher Tatsachen schuldig zu machen, und um gleichzeitig gebührenden Dank auszusprechen, zum Schlusse nicht verhehlen, daß ich die Möglichkeit, diesen angenehmen Versuch zu machen, nicht meinen Einkünften als deutscher Dichter, sondern der Freundlichkeit des Verlags August Scherl G. m. b. H. verdanke, der mir den Wagen für die Dauer der Reise zur Verfügung gestellt hat.
Nymphenburg, im November 1903.
Otto Julius Bierbaum.
I. Von Berlin nach Wien
An Herrn Alf Bachmann in München
Berlin, am 1. April 1902.
Sie erinnern sich wohl noch, lieber Bachmann, unserer Spaziergänge im winterlichen Nymphenburger Park, wie wir uns da, wenn wir nicht von Mathias Kneißl sprachen, der sich damals gerade in der Gegend herumtrieb, eine Reise ausmalten, die uns im Automobil nach Spanien führen sollte. Sie heuchelten (mit Erfolg, weil ich nicht die nötigen geographischen Kenntnisse besaß, Sie zu kontrollieren) eine intime Vertrautheit mit der Reiseroute, die wir einzuschlagen hätten, und entwarfen mir die üppigsten Bilder von all den Herrlichkeiten, die wir bei dieser Gelegenheit kennen lernen würden; ich aber leistete nicht weniger Phantastisches in der Schilderung des Wagens, der uns bald mit der Geschwindigkeit eines Expreßzuges, bald im Postwagentempo von Thurn und Taxis, vorwärts bringen sollte. Eigentlich war es ein ganzes Gebäude auf Pneumatics, das ich mir vorstellte, mit allem Komfort eines Pullman-Car oder der berühmten »Wurst« Friedrichs von Gentz ausgestattet, nur noch viel bequemer und geräumiger, – kurz: ein Ideal mit achtundvierzig Pferdekräften. Sie, mit ihrer heimtückisch witzigen Nase, thaten so, als glaubten Sie an all das, ja Sie fügten noch allerhand Fabelhaftigkeiten hinzu, so daß wir schließlich auf unserer Reise nach Spanien auf ein Paar niedliche Kanonen und eine komplette Kücheneinrichtung mit uns führten. Unser erstaunliches Vehikel konnte als Badezimmer, Dunkelkammer, Schlafwagen, Billardsalon benutzt werden; es sprang über mittlere Abgründe, durchquerte Seen, watete durch Sümpfe; Berge, über die es nicht gekonnt hätte, gab es überhaupt nicht. Nur vor der Kombination mit dem lenkbaren Luftschiff schreckten wir einstweilen zurück.
Kein Wunder, daß wir dieses Universalfahrzeug nirgends auf Lager fanden und infolgedessen zu der Überzeugung kamen, die Welt sei für unsre Kulturbedürfnisse noch nicht reif. Also schoben wir unsere ideale Reise bis auf weiteres auf, indem wir sie gleichzeitig für schon genossen nahmen und uns sagten: so schön wäre sie doch nicht geworden, wie wir sie im Nymphenburger Park machten. Denn wo auf der Welt gäbe es etwas so Schönes wie Châteaux d'Espagne?
Damit war für Sie die Sache erledigt, mein teurer Herr von Planen auf Blitzblau; doch nicht so für mich. Mich juckte es zu sehr, einmal die Probe auf das Exempel meiner Fabuliersamkeit zu machen, und so habe ich nicht geruht, bis ein Automobil vor meiner Tür stand. Daß es alle die Eigenschaften hätte, die wir von unserm Reisewagen verlangt haben, läßt sich füglich nicht behaupten, – doch dieser Mangel wird dadurch wett gemacht, daß meine Frau mich auf der Reise begleiten wird, die nun in etwa vierzehn Tagen angetreten werden soll. Sie, lieber Bachmann, wären ja auch ein angenehmer Reisekamerad gewesen, aber ich finde doch, daß es besser ist, Sie bleiben zu Hause, und ich fahre mit meiner Frau. Das ist schon deshalb vorteilhafter, weil meine Frau zwar nicht so schön malen kann, wie Sie, aber so perfekt italienisch spricht, wie es Ihnen selbst nach vierwöchentlichem Studium des Polyglott Kuntze nicht möglich sein würde. Viel Chancen auf einmal: Erstens mit seiner Frau und zweitens mit einer Italienerin nach Italien zu fahren. Dafür kann man es schon mit hinnehmen, daß das Automobil statt achtundvierzig bloß acht Pferdekräfte hat. – Im übrigen sieht es sehr vertrauenerweckend aus, und Louis Riegel, der Fahrer, erklärt, jeden beliebigen Berg damit »nehmen« zu wollen. Acht Pferdekräfte, sagt er, sei eine ganze Menge. Und das finde ich auch, da ich bisher höchstens mit zwei Pferden gefahren bin.
Übrigens kommt es, wie ich erfahren habe, auch auf die Zahl der Zylinder an, und erfahrene Leute wollen mich bange machen, weil unser Wagen nur einen hat. Etwa mitgeführte Zylinderhüte, erklären diese Kenner, können als Ersatz nicht gelten. Schade, denke ich mir, es wäre so einfach, und da ich in Rom den Papst besuchen will, so hätte ich wohl einen Zylinderhut mitnehmen können. Indessen ficht es mich auch nicht weiter an. Ich sage mir dies: Wenn eine gute deutsche Firma, wie die Frankfurter Adlerfahrradwerke, von denen der Wagen stammt, mir garantiert, daß er eine Reise von Berlin nach Sorrent und zurück zu machen fähig ist, so wird es wohl auch so sein. Hat sie sich vergarantiert, so ist ausgemacht, daß ich das insuffiziente Fahrzeug auf Kosten und Gefahr des Empfängers mit der Bahn zurückschicke, und ich habe die ernstliche Drohung hinzugefügt, daß ich dieses blamable Ende einer Adlerwagen-Reise in Vers und Prosa vor die Öffentlichkeit bringen werde. Aber auch diese Drohung hat die Firma in ihrer Zuversicht nicht erschüttert. Sie bleibt dabei: es geht mit acht Pferdekräften und einem Zylinder. Glauben wir es also einstweilen.
Natürlich möchten Sie nun wissen, wie der Wagen aussieht. Rot, mein Herr, und zwar ist es ein Rot, wie ich es auf kolorierten Stichen aus der Biedermeierzeit an Reisekutschen gesehen habe. Ein braves, ungeniertes, ein ordentliches Rot. Gebe der Himmel, daß wir keinen Stieren und Truthähnen begegnen!
Die Form aber ist die des Phaëtons. Sie wissen: Phaëton, Sohn des Helios, Patron der antiken Kutscher. Eigentlich sind es zweirädrige Wagen, die den Namen von ihm haben, und da der unsre vier Räder hat, neige ich mich der Meinung zu, es sei ein Doppelphaëton. Aber das ist einerlei. Gewiß ist, daß die Urform dieses Wagens die Muschelform war. Von der Muschel zum Motor! Per aspera ad astra!
Spüren Sie den Hauch meiner erhobenen Stimmung? Reiselaune, lieber Freund! Sollte ich noch einmal in diesem Briefe Ausrufe von zweifelhafter Hergehörigkeit riskieren, so denken Sie daran, daß ich im Begriffe bin, mich drei Monate lang durch fortgesetzte Benzinexplosionen vorwärts bewegen zu lassen.
Doch es wird nun Zeit, Ihnen den Wagen selbst zu schildern. – Stellen Sie sich mit mir dorthin, wie die Pferde stehen würden, wenn es ein gemeiner Zieh- und kein Laufwagen wäre (auf dieses Wort habe ich den Markenschutz genommen), so werden Sie finden, daß das Dach sich sehr hübsch nach hinten aufbaut, in Form eines Keiles gewissermaßen. Die Spitze des Keiles bildet der Klappdeckel des Motors, dann kommt der Bock mit dem Lenkrad und den Einrichtungen zum Einstellen der drei Geschwindigkeiten und zum Bremsen, und schließlich, in gleicher Höhe mit dem Bock, aber die Lehne mit dem Verdeck etwas erhöht, der Doppelsitz für meine Frau und mich. Nun bitte ich Sie, mit nach hinten zu kommen. Was Sie da sehen, dieses Stahlgestänge mit Riemen, ist bestimmt, einen großen Koffer zu halten. Dafür war eigentlich nichts ordentliches da, denn das dafür bestimmte Brettchen hätte kaum genügt, den Hutschachteln meiner Frau zur Unterlage zu dienen. Man denkt eben im allgemeinen beim Bau der Laufwagen noch nicht an die Bedürfnisse größerer Reisen. So waren wir auch genötigt, den Sitz neben dem Führer zur Aufnahme weiterer Koffer adaptieren zu lassen. Das Verdeck ist, wie Sie sehen, auch nicht eigentlich reisemäßig. Es schützt zwar gegen Nässe von oben, von den Seiten und von hinten, – wenn aber der Regen rücksichtslos genug ist, von vorne zu kommen, (was bei der »dritten Geschwindigkeit« die Regel sein dürfte), so werden wir ihm auf Gnade und Ungnade ausgeliefert sein. – Werden wir? Nein, wir werden nicht! Denn, sehen Sie sich, bitte, dieses Lederpaket an! Es ist eine ingeniös erfundene Vorderplane mit zwei Guckfenstern. Diese werden wir uns vorknöpfen, wenn das Wetter grob wird. – Und wenns die Sonne zu gut meint? Dann, mein Herr, bleibt vom Regendach nur der obere Teil und das Gestänge übrig, während die andern Bestandteile hinauf gerollt werden. Sie sehen, wir Sybariten haben an alles gedacht. Nur ein Schutzglas gegen den Luftzug haben wir nicht, weil man uns gesagt hat, es habe allerlei Nachteile, klappere gerne und sei alle Augenblicke voll Staub. Meine Frau möchte aber auf der Reise nicht Staub wischen, und ich habe eine Aversion gegen klappernde Fenster.
Nun möchten Sie auch wissen, wie wir selber uns equipieren. – Das ist eine Sache, über die ich mit keinem geringeren als Herrn Hoffmann in der Friedrichstraße konferiert habe, demselben Kleiderkonstrukteur, der den Grafen Waldersee, als er gen China zog, mit Kaki versehen hat. Sie finden, das sei Größenwahn? Gewiß, unserer Expedition ist nicht so kriegerisch und überseeisch wie die des Weltmarschalls, aber ich habe immer bemerkt, daß, wenn einer Automobil fährt, beträchtliche Veränderungen in seiner Garderobe vor sich gehen. Er kleidet sich in Leder, wendet das Fell des Pelzes nach außen, setzt sich eine Maske und eine gigantische Mütze auf, – kurz, jedes Kleidungsstück ruft laut und vernehmlich: Töff! Töff! Auch Herr Hoffmann hatte mit mir weitgehende schneiderische Metamorphosen vor, aber er zeigte dabei zu sehr die Tendenz, mich gegen die Unbilden des sibirischen Wetters auszurüsten, als daß ich, der ich mehr nach Süden strebe, mich gänzlich hätte anschließen können. Zwar war es verlockend, die Haare einer glänzenden schwarzen Ziege oder junger Pferde nach außen zu tragen oder sich ganz in schwarzes Wichsleder zu hüllen, aber wir widerstanden dem Versucher. Wir beschränkten uns auf 1. ein Paar wasserdichte, aber sehr dünne Mäntel, die also gleichzeitig gegen Regen und Staub schützen sollen; 2. ein Sportkleid für meine Frau, kurzer Rockrand, Jacke, 3. einen Sportanzug für mich, Pumphosen und Joppe, 4. ein rohseidenes Kleid für meine Frau; 5. einen weißleinenen Anzug für mich; 6. zwei braunlederne Mützen; 7. ein Paar hohe Stiefel für meine Frau; 8. ein Paar hohe Stiefel für mich. Sie sehen, es ist Bedacht darauf genommen, daß wir es sowohl mit der Kälte vor, wie mit der Hitze nach dem Brenner aufnehmen können. Unsere gewöhnlichen Wintermäntel nehmen wir natürlich auch mit, und mein großer Koffer ist dazu bestimmt, Wäsche und Straßen- wie Gesellschaftskleider für drei Monate zu beherbergen. Außer ihm werden wir folgendes gen Süden schleppen: einen großen Handkoffer meiner Frau; einen großen Handkoffer für die »Effekten« bei kurzem Aufenthalt; einen Toilettenkoffer; einen Speisekorb mit Geschirr; eine Schirm- und Stocktasche; eine Gummibadewanne; drei Reisedecken. – Heiliger Himmel, – welch eine Bagage! Was hat man von seinem Kulturmenschentum? Eine Garnitur Koffer. Aber welche Wollust liegt in dem Gedanken: wir werden sie nie »aufzugeben« brauchen!
Überhaupt: eine wollüstige Perspektive! Wir werden nie von der Angst geplagt werden, daß wir einen Zug versäumen könnten. Wir werden nie nach dem Packträger schreien, nie nachzählen müssen: eins, zwei, drei, vier – hat er alles? Herrgott, die Hutschachtel! Sind auch die Schirme da? Wir werden nie Gefahr laufen, mit unausstehlichen Menschen in ein Kupee gesperrt zu werden, dessen Fenster auch bei drückender Hitze nicht geöffnet werden darf, wenn jemand mitfährt, der an Zug-Angst leidet. Wir werden keinen Ruß in die Lungen bekommen. (Aber Staub! Meinen Sie? Warten wir's ab!) Wir werden selber bestimmen, ob wir schnell oder langsam fahren, wo wir anhalten, wo wir ohne Aufenthalt durchfahren wollen. Wir werden ganze Tage lang in frischer, bewegter Luft sein. Wir werden nicht in gräulichen, furchtbaren Höhlen durch die Berge, sondern über die Berge wegfahren.
Kurz, mein Herr: Wir werden wirklich reisen und uns nicht transportieren lassen.
Reisensage ich, nicht rasen. Denn das soll schließlich, um es kurz zu sagen, der Zweck der Übung sein: Wir wollen mit dem modernsten aller Fahrzeuge auf altmodische Weise reisen, und eben das wird das Neue an unserer Reise sein. Denn bisher hat man das Automobil fast ausschließlich zum Rasen und so gut wie gar nicht zum Reisen benützt.
Das Wesentliche des Reisens ist aber keineswegs die Schnelligkeit, sondern die Freiheit der Bewegung. Reisen ist das Vergnügen, in Bewegung zu sein, sich vom Alltäglichen seiner Umgebung zu entfernen und neue Eindrücke mit Genuß aufzunehmen. Der Reisende im Eisenbahnwagen vertauscht aber nur sein eignes Zimmer, das er allein besitzt, mit einer Mietskabine, an der jeder Quidam teil haben kann, und er gibt, statt Freiheit zu gewinnen, Freiheit auf. Der kilometerfressende »Automobilist« ist aber auch kein Reisender, sondern ein Maschinist. Das mag Verlockendes haben, wie jeder mit Lebensgefahr verbundene Sport, und ich begreife es, daß gerade die Reichsten der Reichen sich die Sensation gerne verschaffen, auf bisher noch nicht dagewesene Manier das Genick zu brechen. Aber mit der Kunst des Reisens hat das soviel zu tun, wie die Schnellmalerei mit der Kunst Böcklins.
Lerne zu reisen ohne zu rasen!heißt mein Spruch, und auch darum nenne ich das Automobil gerne Laufwagen. Denn es soll nach meinem Sinne kein Rasewagen sein. Und nun wollen wir sehen, ob das geht!
Den nächsten Brief sollen Sie bereits von unserer ersten Station aus erhalten.
Großenhain in Sachsen, den 10. April 1902.
Lustig wird man durch das Reisen im Laufwagen, lieber Freund, aber nicht schreiblustig. Daher nur ganz kurz: Wir sind um 11 Uhr in Berlin abgefahren, durchs Tempelhofer Feld hinaus über Zossen, Baruth, Luckau, Elsterwerda hierher, wo wir gegen ½7 Uhr angekommen sind. Bald langsam, bald schnell, fast immer mit Gegenwind kämpfend und sehr oft behindert durch die Notwendigkeit, auf unruhige Pferde Rücksicht zu nehmen, die instinktiv eine Antipathie gegen den Laufwagen haben, der bestimmt ist, sie im Amte der Beförderung von Menschen und Lasten abzulösen. Man muß alles lernen, auch die Kunst, an Pferden vorbeizukommen, ohne daß sie scheuen. – Unser Hauptinteresse bei dieser ersten Fahrt galt dem Wagen. Wir sind erstaunt, auf was für schlechten Wegen er sicher zu fahren imstande ist. Bei glatter, freier Bahn ist es wie ein Fliegen, und man begreift, daß der Sportsautomobilist schließlich nur das eine Interesse hat: die Schnelligkeit zu steigern.
Wir, die wir keine Sportsleute, sondern einfache Reisende sind, die nicht fahren, um irgend einen Rekord zu schlagen, sondern um möglichst viel und intim zu sehen, werden uns kaum dazu verlocken lassen, andauernd ein Gewalttempo einzuhalten, wenngleich wir streckenweise recht gern den Reiz genießen wollen, den es hat, im offenen Wagen auf schnurgerader, glatter Chaussee hast du nicht gesehen dahinzurollen. Es ist ein ganz eigenartiges Gefühl, das fast etwas Berauschendes hat, nur daß auf diesen Rausch kein Katzenjammer, sondern eine gesteigerte Lebensfrische folgt. – Da unsere Augen an den verstärkten Luftzug noch nicht gewöhnt sind, haben wir die großen Schutzbrillen benützt und gefunden, daß sie nicht halb so lästig sind, wie wir gedacht hatten.
Dresden, den 11. April 1902.
Heute sind wir à la Postkutsche gereist. Um zehn Uhr in Großenhain aufgebrochen und erst um fünf in Dresden angelangt – jeder Anfänger im Radfahren muß uns deshalb verachten.
Dafür haben wir aber recht viele schöne Dinge mit ruhigem Behagen betrachten können: die herrliche Albrechtsburg Meißens und das königliche Moritzburg mit seinen Wäldern, Wildschweinen und Hirschen.
Der Besuch der Albrechtsburg war die erste Prüfung unseres Adlerwagens auf seine Fähigkeit, größere Steigungen zu nehmen. Er hat sie glänzend bestanden. Wir fuhren durch steilen und engen Gassen Meißens bis vor das Tor des wundervollen alten Doms hinauf, nicht ohne einige Bänglichkeit unserseits, da wir uns vorstellten, in welchem Tempo es rückwärts hinunter gehen würde, wenn es dem Motor mitten in der Steigung einfallen sollte, zu versagen. Unser Führer, von dessen Tüchtigkeit wir schon jetzt vollkommen überzeugt sind, bemerkte unsere ungewissen Mienen und benutzte die Gelegenheit, uns alle die Sicherungsmittel auseinander zu setzen, die den Wagen sofort zum stehen zu bringen vermögen, wenn er bei Gefälle oder Steigung nach vorn oder hinten ins Rollen kommen sollte. Abgesehen davon, daß der Motor sofort abgestellt werden kann, kann auf dreifache Weise augenblicklich und scharf gebremst werden, und beim aufwärtsfahren werden außerdem zwei Rücklaufstreber unterhalb des Wagenkastens herabgelassen, die, zwei starke und spitze Eisen, sich in das Erdreich bohren, sobald der Wagen abwärts nach hinten ins Laufen kommt.
Wir kamen uns fast wie Eindringlinge aus einer anderen Welt vor, als wir in den Domhof einfuhren, der von ehrwürdig schönen alten Bauten gebildet ist und um so ergreifender wirkt, wenn man, wie wir, ziemlich unvermittelt in ihn gestellt wird. Doch konnte unser Automobil verwandte Erscheinungen seiner Art begrüßen in Gestalt elektrischer Bogenlampen, die, Wahrzeichen unserer Zeit, an den alten Bauwerken angebracht sind. Sehr schön nehmen sie sich in dieser Nachbarschaft nicht aus, und wir schämten uns hier, angesichts dieser alten großen Kunst, ein wenig der ästhetischen Verarmung, in die wir geraten sind, wir Leute mit den Bogenlampen. Doch wäre es undankbar, unserer Zeit zu schmähen, wenn man eben im Automobil zur Albrechtsburg hinaufgefahren ist, und wir dürfen uns zum Glück, wenn wir auch bekennen müssen, daß wir auf dem Felde der Schönheit wie die arm gewordenen Enkel großer Herren der Vergangenheit sind, der Zuversicht getrösten, daß die reichen Aufsätze zu einem neuen Leben, die sich im Bezirke des Schönen zeigen, sicher bald Blüte und Frucht tragen werden. Wir haben jetzt, so gern wir auch in diesen Dingen das Wort »modern« gebrauchen, den Weg zu den großen Alten zurückgefunden, die wir nun aber nicht zu wiederholen, sondern von denen wir aufs neue auszugehen gedenken.
Ich mußte, aber ohne Spott, lächeln, als ich in einer Ecke des alten Domes das Linienwerk eines Türgeviertschmuckes bemerkte, das ganz wie ein in Stein übertragenes Büchertitelornament von unserem Peter Behrens aussieht. – Nach diesem Labsal an alter deutscher Kunst freuten wir uns der Meisterin aller Künste, die, unbesorgt um den Ruf der Originalität, sich immer wiederholt und dennoch immer auf neue wie eine Offenbarung wirkt, da sie in der Tat die ewig eine Offenbarung ist: der Natur.
Sie interessierte uns diesmal hauptsächlich in Gestalt des allerjüngsten Wildschweinnachwuchses von Moritzburg, allerliebster gescheckter Frischlinge, die gar nichts von der grimmigen Wüstheit ihrer borstigen Eltern haben. Diese könnten zum Fürchten sein (wie denn die alte deutsche Kunst dem Teufel gern einen Wildschweinskopf gab), wenn sie nicht wie hier, von dem ausschließlichen Interesse nach Atzung beseelt sind, und dies mit der Gewißheit, daß diesem Interesse zur bestimmten Stunde entgegengekommen wird. Sie übersahen uns durchaus und beschäftigten sich nur mit ihrer Mahlzeit, die aus rohen Kartoffeln mit Maiskörnern als Nachtisch bestand.
Den Wildschweinen des Königs von Sachsen geht nichts ab, und das macht sie so gemütlich und zahm, daß sie eigentlich gar keinen Anspruch mehr darauf haben, wilde Schweine zu heißen. Die großen schönen Hirsche, die um die gleiche Zeit gefüttert werden, ihr Traktement aber abseits und in Krippen, nicht auf dem bloßen Boden, erhalten, betrugen sich wie vornehme Pensionäre, die mit einem Air von Gelangweiltheit entgegennehmen, was ihnen von Rechts wegen durch die Organe des Staates serviert wird. Um uns kümmerten sie sich noch weniger, als die borstigen Grunzer. Trotzdem wären wir gern noch länger Zeugen dieses vergnügten Geschäfts sorgloser Ernährung gewesen, wenn nicht ein leiser Regen begonnen hätte. Wir schlugen die Wagendecke hoch, fanden, daß es sich auf diese Weise auch bei Regen angenehm im Laufwagen fahren läßt, und rollten bald über die Karolabrücke nach Dresden-Altstadt.
Teplitz in Böhmen, den 12. April 1902.
Wenn Sie glauben, daß ich Ihnen heute von Dresden erzählen werde, so irren Sie sich. Noch ist uns das Spielzeug zu neu, als daß wir es einen Tag ruhen lassen könnten. Wir sind, ohne das schöne Dresden eines Blickes zu würdigen, heute bereits weiter gefahren, doch haben wir uns ein hübsches Andenken mitgenommen, das wir überdies auf der Reise wohl brauchen können: ein meißner Tafelservice mit Biedermeier-Rosen. Wer, wie ich, als Alkoholabstinenter auf Tee angewiesen ist, will ihn auch hübsch serviert bekommen. Sofort nach unserer Ankunft, kaum, daß wir uns umgekleidet und gewaschen haben, dampft die Teemaschine; die sorgsam in Watte verpackten Kannen und Tassen werden mit unendlicher Bangigkeit (»Du, hat es nicht eben geklirrt? Sicher ist etwas kaputt«) ausgewickelt, die chinesische Teebüchse giebt das nötige, wohlbemessene Quantum des göttlichen Krautes von Ceylon her, und ich habe das Vergnügen, wie zu Hause zu schreiben: die Schale mit dem goldbraunen Nasse neben mir.
Wie das duftet! Wie das belebt! Eure Räusche, Knechte der gegohrenen Getränke, sind grobe Peitschenhiebe, die Striemen hinterlassen, während der Rausch aus dem Tee das Streicheln einer feinen, weichen, schönen Hand ist, die auch noch in der Erinnerung wohltut.
Aber wie? kommt dieses mein freudige Lebensgefühl jetzt von diesem einen Schluck Tee? Kommt es nicht viel mehr vom – Automobil? – Ja, wenn es ein Rausch ist, der mich jetzt so heiter macht, so ist es der Bewegungsrausch.
Nun werden Sie in Ihrem schnöden Herzen freilich denken: Eine recht bequeme Art, sich zu bewegen, wenn man für ein paar Stunden auf dem Polster eines Wagens Platz nimmt.
Sie irren sich.
Eine Bewegung wie Radfahren, eine Art Turnen ist es freilich nicht. Es ist vielmehr so wie bei den ingeniösen Apparaten des Schweden Zander, durch die man, wenn Sie die Güte haben, mir ein Wort zu gestatten, das wie ein Witz von Ihnen aussieht, geturnt wird. Was diese Erschütterungsmaschinen zu Wege bringen: diese gewisse innere Massage, das besorgt das Automobil mit seinem fortwährenden leisen Vibrieren. Es ist durchaus kein Stoßen, Rütteln, Schütteln, sondern ein sanftes fast unmerkbares Zittern. Steht der Wagen, so ist es am stärksten; je schneller er läuft, um so schwächer wird es. Die Wirkung auf den Körper ist bei mir durchaus angenehmer Natur; ich fühle mich nach einer etwa vier- bis fünfstündigen Fahrt im Laufwagen angenehm erfrischt, etwa so, wie ich mich fühle, wenn ich mich in einer Höhe von etwas mehr als 1000 Meter über Meer befinde.
Die passive Bewegung durch das Laufwagenfahren ist es allerdings gewiß nicht allein, die diesen angenehmen Effekt hat, sondern es kommt der stundenlange Aufenthalt in frischer Luft, dieses Luftwellenbad hinzu, das wohl mehr als eine bloße Hautwirkung hat. Und schließlich darf auch die heilsame Entlastung des Gemütes nicht vergessen werden, dieses Reisegefühl der Freiheit und fortwährenden Befruchtung mit neuen Eindrücken. Gebe ich jedem dieser frei Faktoren ein Drittel des Verdienstes an dieser Steigerung des Gesundheitsgefühls, so bleibt doch bestehen, daß keiner der drei Faktoren fehlen dürfte, – und sie alle drei finden sich nur bei der Reise im Laufwagen in so glücklicher Dosierung vereint. Ganz junge oder besonders kraftvolle Leute, wie Sie, mein Freund und Meister in allen schönen Künsten des Leibes, können es ja billiger haben: auf Schusters Rappen oder dem Rade. Für uns andre aber, die mit Bäuchen gesegnet und auch sonst nicht ganz auf der Höhe physischer Leistungsfähigkeit sind, erfordert andauerndes Laufen und Radeln über weite Strecken zuviel Muskelenergie, und statt Erfrischung pflegen wir Abspannung oder Überreiztheit zu gewinnen. Für uns ist also das Laufwagenreisen das Wahre. Crede experto!
Ich glaube, daß nicht einmal unbedingt schönes Wetter dazu nötig ist, doch ist das eine Zugabe, für die den Göttern Dank gebührt. Heute war sie uns in reichstem Maße zugemessen. Ein frischer sonniger Tag –:
Kein Wölkchen, das am Himmel stund, Sonne und Wind im schönsten Bund, Das war ein Tag voll Güte.
Wir fuhren erst ¾1 Uhr von Dresden ab, als Führer vor uns Herrn Weber, den Besitzer des bekannten Hôtels, der es sich nicht nehmen ließ, uns den schönsten Weg (durch den prächtigen »Großen Garten«) zu zeigen, indem er uns auf dem Rade voranfuhr – woraus zu entnehmen ist, daß die berühmte sächsische Höflichkeit zuweilen mehr kann, als süße Worte machen. Herrn Weber verdankten wir es auch, daß wir den Weg durch das anmutige Müglitztal nahmen, über Dohna, Weesenstein, Glashütte, Altenburg. Unserem Motor wurde dadurch keine kleine Aufgabe gestellt, denn es geht unausgesetzt bis über 700 Meter bergan. Dafür fällt dann der Weg von dem ersten böhmischen Orte Zinnwald an recht scharf, und zwar durch einen richtigen, alten Märchenwald, in dem noch viel Schnee lag. Die Fahrt durch diese grün-weiße Einsamkeit werden wir nie vergessen. Sie versetzte uns in eine Welt, die sonst fast überall bereits dem Untergange geweiht ist. Nur Großgrundherren vom Reichtume der böhmischen können sich noch solche Wälder leisten, in denen, so möchte man meinen, ein Rübezahl als Förster herrscht, dem jeder Baum heilig und jede Axt ein Greuel ist. – Im stärksten Gegensatze dazu beginnt bald hinter diesem königlichen Urwalde das Gebiet der Teplitzer Kohlenbergwerke, in dem der Natur alle ihre Schönheit brutal genommen ist, und wo auch die Menschen, die dies vollbracht haben, wahrhaftig nicht die Schönheit siegreicher Eroberer zeigen, sondern das Notmal schmutziger Mühsal an sich tragen. Wir waren froh, als wir diese Kohlenstaubhügel hinter uns hatten, und gegen ½5 Uhr in das noch fremdenlose Teplitz einfuhren.
Prag, den 13. April 1902.
Teplitz hat uns nicht eben besonders gefallen, – bis auf eine böhmische Mehlspeise und den Umstand, daß es eine ganz deutsche Stadt (mit stark sächsischer Klangfarbe) ist. Abends war es recht hübsch, sich in das Volksgewühl zu mengen.
Wirklich: Gewühl. Denn die engen Straßen sind auffällig belebt, ganz »Carmen«, erster Akt, erste Szene. – Das Hôtel erinnerte in seiner Weitläuftigkeit und der etwas abgenützten alten Pracht der Möbel an die Zeit, da Teplitz noch ein Weltbar war und Kaiser und Könige beherbergte. Die alten feierlichen Kanapees machten in ihrer Abgeschabtheit ganz den Eindruck, als fühlten sie ihre Deklassierung und schämten sich, daß es nicht einmal für einen neuen Überzug mehr langte. – Lobositz scheint auch noch deutsch zu sein, aber mit Theresienstadt beginnt schon die Tschechei. Von hier bis Prag haben wir kein deutsches Wort gehört, außer, wenn wir uns mit Fragen an ältere Personen wandten. Diese gaben bereitwillig deutsch Antwort. Außer an der Sprache merkt man es auch an dem Gehaben der Leute, daß sie einer anderen Nation angehören. Die Tschechen sind viel temperamentvoller als die Deutschen. Unser Adlerwagen mobilisierte jedes tschechische Dorf; von den jüngsten Jungtschechen bis zu den ältesten Matronen kam alles herbeigelaufen, gehatscht, gehumpelt, und wir hatten reichlich Gelegenheit, den Wohllaut der tschechischen Sprache zu genießen, da es bei diesen Volksansammlungen überaus laut herging, fast so laut, wie, in Farben, auf ihren Westen, Blusen, Schürzen, denn der Farbensinn der Tschechen ist lebhafter als der der Deutschen. Blau und rot scheinen sie am meisten zu bevorzugen. – Schöne Leute sind uns nicht begegnet bis auf einen sehr großen Zug Zigeuner, wohl an die zwanzig Wagen mit den jämmerlichsten Pferden, die ich je gesehen habe. Dafür waren die Burschen sowohl wie die Mädchen um so schöner, wahre Prachtexemplare von Menschen an Gestalt und Antlitz. Herrliche Augen des Orients, prachtvolle braune Haut, edelster Gesichtsschnitt, wunderbar fein gegliederte Hände. Schade, daß sie, mit Verlaub zu sagen, so dreckig sind. – Übrigens, Freund Maler, eine Frage, über die ich mir Gedanken mache: Woher bekommen die Zigeuner alle ihre blinden und lahmen Pferde? Sie werden sagen: Sie stehlen sie. Aber das kann nicht stimmen, denn die Zigeuner gelten nicht als dumm, und dumm wäre es doch, immer und ausschließlich Ausschußgäule zu stehlen. Ich meinesteils wenigstens würde, wenn ich schon einmal Pferdedieb wäre, Wert darauf legen, besonders junge, gesunde, schöne Exemplare an mich zu bringen. Zudem müßten sich diese auch leichter stehlen lassen, weil sie schneller zu laufen und den Dieb gleichzeitig mitzutragen imstande sind. Man wird also doch wohl zu der Annahme gelangen, daß die Zigeuner dieses Krupzeug kaufen. Nun aber, ich bitte Sie, lieber Freund, was werden die armen Zigeuner machen, wenn es einmal keine Pferde, sondern nur noch Automobile giebt? Blinde und taube Laufwagen werden selten sein, und mit den lahmen allein werden die unseligen »Rom's« nicht auskommen. Wir werden die Lösung dieser bangen Frage wie so vieler anderer wohl der Zukunft überlassen müssen. – Heute hätten wir übrigens unser Ideal-Automobil aus dem Nymphenburger Park brauchen können, denn zweimal führte uns der Weg an einen Fluß, doch an keine Brücke. Wir mußten uns bei Dozan über die Eger, bei Weltrus über die Moldau setzen lassen, Begebenheiten, die zu photographieren wir nicht ermangelt haben.
Nach der Überfahrt über die Moldau
Je näher wir auf unserer Fahrt, die fortwährend durch eine Landschaft vom Anscheine reichster Fruchtbarkeit führte, am Prag herankamen, umsomehr fiel uns Eines auf: welchen Kultus das tschechische Volk mit seiner Sprache treibt. Sie ist ihm so teuer, daß es ihm offenbar sündhaft erschiene, ihre Worte bei öffentlichen Aufschriften anders als in Buchstaben von mindestens einem Viertel Meter Höhe malen zu lassen, – und alles in Versalien. Dieser Überschwang in Anfangsbuchstaben, die alle in frischer Ölfarbe glänzen, also offenbar häufig erneuert werden, ruft, schreit, kräht: Schaut her, wir haben eine Schriftsprache! Wir brauchen das Deutsche nicht mehr! Nix Daitsch! Nix Daitsch! Nix Daitsch! – Das Nationalgefühl in Plakatformat.
Prag, den 14. April 1902.
Der Blaue Stern, in dem wir wohnen, ist leider modernisiert und dadurch um seine alte Behaglichkeit gekommen. Es scheint, daß ich doch kein moderner Mensch bin. Nicht einmal der Jugendstil ersetzt mir die Gemütlichkeit. Diese fanden wir dafür im Hause von Hugo Salus und überhaupt bei allen Deutschen, die uns begrüßten. Ach, die Deutschen Prags begrüßen so gerne Deutsche »aus dem Reiche«. Sie sitzen hier auf einer kleinen Insel in einem wilden Meere, und dieses Meer frißt ihnen ihr Inselchen immer kleiner. Bald wird es nur noch ein deutsches Helgoländchen in der tschechischen Mordsee sein. Dabei repräsentiert das deutsche Prag die reifere Bildung, den festeren Reichtum. Aber – das Volk fehlt. Es ist schon fast wie das »englische Viertel« in Dresden, – eine dauernde Ansiedelung von Ausländern. Die gesamte Arbeiterbevölkerung und die dienenden Klassen, – lauter Tschechen. Die Geschäftsinhaber und Handwerksmeister sind wohl noch zum Teil deutsch, arbeiten aber mit tschechischen Kräften. Das Bollwerk der deutschen Universität steht zwar noch fest, wird aber grimmig berannt; doch ist es in tapferen Händen. Die deutschen Studenten sind natürlich treu und fest national gesinnt, desgleichen die deutsche Presse. Auch pflegt man in Prag die deutsche Literatur mit größerer Hingabe, als es sonst unter Deutschen die Regel ist, und die deutsche Literatur Prags weist ein paar Talente von hoher Begabung auf. Salus ist ein Poet, den jeder Deutsche lieben muß, der in der Lyrik nicht bloß auf Virtuosenspezialität erpicht ist, und Rilke ist vielleicht das größte lyrische Formtalent, das wir heute überhaupt besitzen.
Im Hofe des blauen Sterns in Prag(links Hugo Salus und Frau)
Entschuldigen Sie diese literarischen Bemerkungen. Ich wills nicht wieder tun.
Daß Prag eine der schönsten Städte, und nicht bloß Österreichs, ist, wissen Sie wohl schon. Eine seltsame Stimmung ist hier: deutsche Vergangenheit und tschechische Gegenwart und dann etwas wunderlich orientalisches, das von den vielen Juden herkommen mag. Das alte Ghetto mit dem Judenfriedhof und der uralten, halb unterirdischen Synagoge, – ein Viertel voll Schmutz, Armut und malerischen Reizes. Da gibt es Häuser, die nicht nebeneinander sondern ineinander gebaut zu sein scheinen, ein unsagbares Gewinkel. In der alten Synagoge, diesem ehrwürdigen Kellerloch der Jehowahverehrung, kann man das Gruseln lernen, und ich für mein Teil wurde den Gedanken nicht los: ein Stückchen dieser Düsterheit steckt auch in jeder christlichen Kirche. Oh Zeus von Otriculi!
Beneschau, den 15. April 1902.
Wenn Sie auf der Karte nachsehen wollen, werden Sie finden, daß Beneschau nicht gar weit von Prag entfernt liegt, und Sie werden sich wundern, daß wir heute nur einen so kleinen Weg gemacht haben. Daran ist die Zündung schuld, das einzige an unserem vortrefflichen Motor, das uns zuweilen einen kleinen Ärger bereitet.
Heute war es sogar ein großer. Der Wagen wollte durchaus nicht »angehn«, so sehr sich unser Fahrer im Hof des Blauen Sterns abmühte. Schließlich wurden wir es müde, der Quälerei beizuwohnen, und gingen hinüber in den Zirkus Schumann, wo der Herr Direktor gerade ein neues Pferd in der hohen Schule übte. Das ist eigentlich auch keine kleine Quälerei, aber als Schauspiel war es für uns doch angenehmer, als das erfolglose Bemühen, Benzinexplosionen durch Zündung zu erzeugen, die Gottweiß aus welchen Tücken keine Lust hatten. Erst Nachmittags um zwei Uhr ließ sie sich herbei, zu funktionieren, und so haben wir also nicht, wie wir wollten, Wittingau, sondern nur Beneschau erreicht.
Von diesem Orte weiß ich Ihnen nichts zu berichten, als daß es vor 30 Jahren noch deutsch gewesen sein soll, jetzt aber, bis auf einige jüdische Firmen, ganz tschechisch ist.
Außer den Firmen Cohn und Katzenstein erinnert uns noch ein schönes Stück Gotik in Gestalt eines hohen Spitzbogenfensters, das allein von einer alten Kirche übrig geblieben ist, an die deutsche Vergangenheit des Städtchens.
Dafür lebt sich auch hier in allen seinen Prächten der tschechische Jugendstil üppig aus. Das Zimmer, das wir angewiesen erhalten haben (Laufwagenreisende bekommen in kleinen Städtchen stets die Staatszimmer), ist giftgrün-rosa bemalt mit unerhörten Blumen der tschechischen Botanik, halb Lilien, halb Klatschrosen; sämtliche Möbel sind aus moosgrün lackiertem Eisenblech mit ziegelroten Kaldaunenornamenten. Die Biedermeier-Rosen unseres Teeservices erblassen schier vor diesem tumultuarischen Farbengeheul, und ich habe dem Wirt ernstlich ans Herz gelegt, hier nie eine Dame in gesegneten Umständen einzuquartieren, weil eine Frühgeburt die unausbleibliche Folge sein müßte.
Wittingau, den 16. April 1902.
Diese Stadt heißt eigentlich ganz anders, aber ich kann mir den tschechischen Namen durchaus nicht merken. Wittingau hat sie früher geheißen, als sie noch deutsch war. Heute kommt der Name nur noch auf den Plakaten der fürstlich-schwarzenbergischen hiesigen Brauerei vor.
Überhaupt ist die ganze Stadt und alles drum herum fürstlich-schwarzenbergisch. Man kann sagen: es ist eigentlich gar keine Stadt, sondern hundert und ein paar Häuser, die dem schwarzenbergischen Schlosse zur Folie dienen.
Da ist z. B. eine Straße, die vom Schloß zur Kirche führt. Aber die Kirche ist die Schloßkapelle, und die eine Seite der Straße ein verdeckter Gang, der Schloß und Kapelle verbindet.
Das Schloß selber ist ein sehr weitläuftiges Gebäude oder besser: ein Komplex mehrerer ausgedehnter Baulichkeiten, und man müßte taub sein, wollte man nicht hören, was diese Mauern (tschechisch natürlich) laut und vernehmlich predigen. Ich habe es vernommen, lieber Bachmann, und habe es, obwohl es tschechisch war, wohl verstanden. Soll ich es Ihnen aus dem Tschechischen der Schwarzenberger (Sie wissen doch daß die Schwarzenberger Tschechen sind?) übersetzen? Ins Deutsche? Nein: ins Französische. Es ist eine ganz kleine Redensart und heißt: Je m'en fiche!
Diese böhmischen Magnaten, von denen die Schwarzenbergs noch nicht einmal die größten sind, dürften sich diesen Spruch wirklich ins Wappen setzen lassen. Dem Rang und Titel nach sind sie zwar keine Souveräne (obwohl die Schwarzenbergs in ihrer eigentlichen Residenz, denn das hier ist bloß ein pied-à-terre, sogar ein kleines Privatarmeechen haben), aber in Wahrheit sind sie viel souveränere Herren, als irgend ein regierender Fürst. Ein moderner König kann wahrhaftig keine großen Sprünge machen, – die Schleppkugel des Parlaments hängt ihm am Fuß. Kaum daß er noch große Reden im Munde führen darf, und auch das will ihm die Volksstimme schon nicht mehr erlauben. Sein Leben spielt sich noch viel mehr als das gewöhnlicher Menschen zwischen lauter Rücksichten ab, und er ist in der Hauptsache nur durch den Schein einer Machtvollkommenheit ausgezeichnet, deren sich heute in Wirklichkeit nur die wirklich Herrschenden erfreuen, die großen Besitzer, die keine nominellen Potentaten sind. Ein heutiger Souverän ist auf Popularität angewiesen; nur ein Genie dürfte es wagen, Potentat und unpopulär zu sein. Ein gewöhnlicher Souverän, der es riskieren wollte, nach dem Spruch je m'en fiche zu »regieren«, würde bald die Bruchstücke seiner Krone und seines Thrones auf der Straße zusammenlesen können.
Einen Schwarzenberg dagegen, wie etwa einen Vanderbilt, hindert eigentlich nichts daran, durchaus und immer zu tun, was ihm beliebt. Er hat Macht schlechthin im Umkreise seines Besitzes. Z. B.: Es beliebt den Fürsten Schwarzenberg, daß sich in oder um Wittingau keine Industrie bilde, denn sie wünschen nicht, daß auf ihrem Gebiete der Arbeiter die Wahl habe, seine Kraft dem Fürsten oder einem anderen zu verkaufen, – also bildet sich keine Industrie, denn alles Land hier, meilen-meilenweit ist Schwarzenbergisch – bis zur Grenze von Nieder-Österreich.
Selbständige Bauern gibt es nicht, – nur schwarzenbergische Untertanen, und die im verwegensten Sinne des Wortes. Leibeigen sind sie ja nicht, aber das Land, das sie bebauen, das Gerät, mit dem sie es tun, die Hütte, in der sie wohnen, gehört dem Fürsten. Er hat die Entscheidung über alle Weg- und Kommunikationsfragen, – in seiner Hand liegt es, welcher Art die Kultur sein soll, die sich hier entwickelt.
Schrecklich, lieber Bachmann, nicht wahr? – Ich weiß nicht recht. Nach dem Prinzip der Liberté, Fraternité, Egalité angesehen ist es ja gräulich, und ich für mein Teil würde, ehe ich so hörig wäre, lieber wundfüßig bis ans Ende der Welt laufen, aber es scheint doch, daß es für viele ein ganz erträglicher Zustand ist, wenn es der Herr Fürst nur ein bißchen gnädig treibt. Also wird es fürs Erste wohl noch eine gute Weile so gehen.
Für die Ästhetik der Landschaft ist das feudale Regime sicher günstig. Unter ihm gedeiht die große Linie: Wald, Wiese, Feld. Alles dehnt sich weit, mächtig, schön. Nirgends Fabrikschlöte, überall reine Natur. Und die Hütten der Bauern so schön verfallen malerisch, moosbewachsen, nieder; die Menschen selber ditto malerisch, nämlich zerlumpt. Ein Unterrock und ein zerrissen Hemd: und das Bauernmädl ist fertig angezogen. Sieht hübsch aus, Bachmann, wenn so ein Stück nackter Rücken durchleuchtet. Sehr unsozial gedacht, – ja; aber, wenn's die Fürsten Schwarzenberg nicht geniert, daß ihre Hütten vor lauter malerischer Romantik schier umfallen, was soll ich tun? Mir ist es genug, daß es Stimmung hat. Auch muß ich sagen, daß die Leute ganz vergnügt aussehen. – Übrigens wird die tschechische Sozialdemokratie den Leuten das Vergnügen an ihrem malerischen Elend schon austreiben. Lassen wir die Mächte sich untereinander abraufen! Einstweilen bin ich den Fürsten Schwarzenberg dankbar dafür, daß auf ihren Gebieten die Natur in allen ihren Prächten erhalten bleibt.
Doch ich sage zuviel: Auch die Feudalen bändigen die Natur, damit sie ergiebiger werde. So haben sie aus den Sümpfen dieses Landes Teiche gemacht, in denen Fische gedeihen, die bis Berlin und Hamburg versandt werden: die berühmten Karpfen von Wittingau.