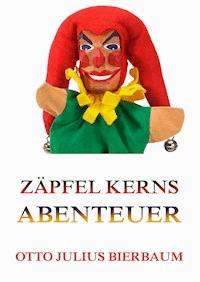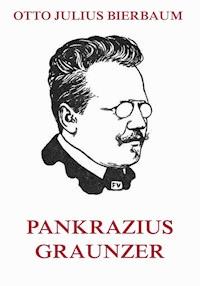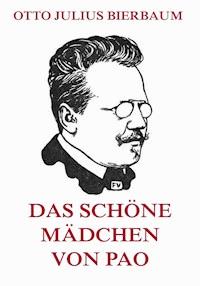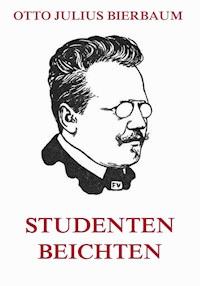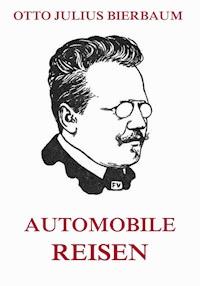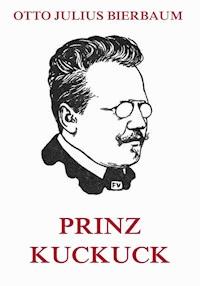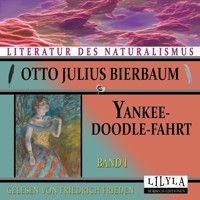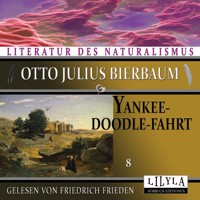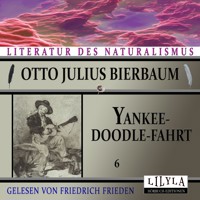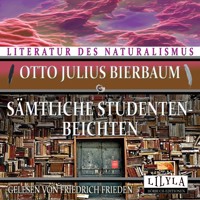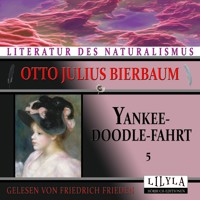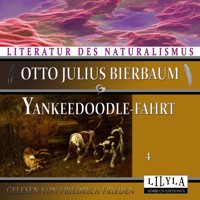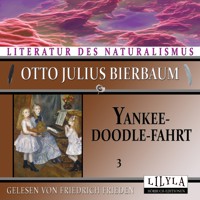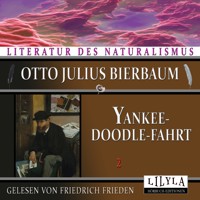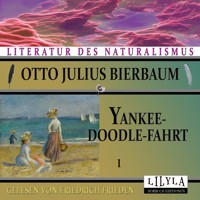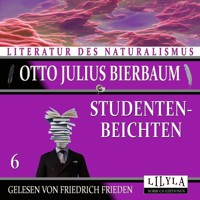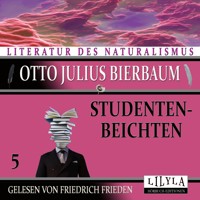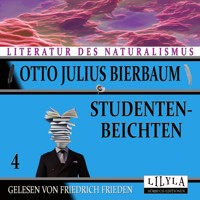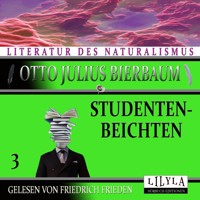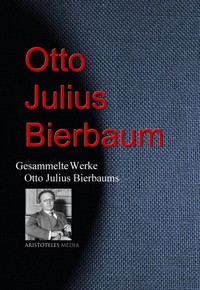
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: aristoteles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Sammlung der Werke von Otto Julius Bierbaum (Pseudonym: Martin Möbius und Simplicissimus), des berühmten deutschen Journalisten, Redakteurs, Schriftstellers und Librettisten enthält u.a.: Die Schlangendame Humoreske Stilpe - Ein Roman aus der Froschperspektive Der Knabe Willibald Das Jünglinglein VIR IVVENIS DOMINVS STILPE Ecce poeta Eine empfindsame Reise im Automobil von Berlin nach Sorrent und zurück an den Rhein Prinz Kuckuck In fremden Nestern Hohe Schulen Zu Pferde und zu Hause Der geborene Reiter Felix Die erste Etappe Das Tee-Thema Selma mit dem Brustpanzer Im Sattel Der Stern der rechten Bahn Hamburger Reflexbewegungen Der gräfliche Kommentar Die Farbe des Lebens 'Süße Rache, o süße Rache!' Der Große Vogel Der knochige Zeigefinger des alten Herrn Jonathan David Das Schicksal dementiert sich Der Sieger Am häuslichen Herde Beklemmender Auftakt Sinfonia erotica Intermezzo alla danza macabra Tenor-Soli Duetto dramatico Quartetto con finale furioso Duetto misterioso Tremoloso Ballo in maschera Nachbericht Der Büßer Der unheilige Sebastian Regina spinosa Gottes Wollust Pater Cassians Sattelpferd Die Heimat mit der habsburgischen Enklave Zum Ziele Rutschbahn Rasebahn Yankeedoodle-Fahrt Studenten-Beichten Pankrazius Graunzer der Schönen Wissenschaften Doktor .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 3058
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Otto Julius Bierbaum
Gesammelte WerkeOtto Julius Bierbaums
Die Schlangendame
Humoreske
1. Kapitel
Er hatte nie den Ehrgeiz besessen ein Gelehrter zu sein
Als Herr Ewald Brock eben sein zweiundzwanzigstes Lebensjahr erfüllt hatte, gelang es ihm, zu seinem eigenen und aller seiner Bekannten Erstaunen, die Abiturientenprüfung zu bestehen. Es geschah an einem Gymnasium des äußersten Pommern und nicht mit Auszeichnung, sondern mit Ach und Krach und Note 3. Indessen, er hatte nie den Ehrgeiz besessen, ein Gelehrter zu werden, sondern es kam ihm fürs Erste nur darauf an, daß man ihm von Staatswegen die Erlaubnis zur Führung des Prädikates Student erteilte. Dieses Ziel hatte den dunklen Mühsäligkeiten seiner an zahlreichen humanistischen Bildungsanstalten des Vaterlandes durchmessenen Gymnasiastenlaufbahn den einzigen Glanz verliehen, und wenn ihn Horaz und Homer mit allen Ödigkeiten der lateinischen und griechischen Syntax drangsalten, wenn die üble Einrichtung der Mathematikstunden sein Dasein belästigte, so fühlte er sich in dem Gedanken aufgerichtet, daß eine Zeit kommen werde, bestimmt, allen diesen überflüssigen Molestierungen ein Ende zu bereiten, eine Zeit, in der Homer, Horaz und die Logarithmentafeln zu lächerlichen Schemen für ihn werden würden, auf dessen Visitenkarte die Abbreviaturenstud. med.und ein kunstreich verschlungener Zirkel stehen sollte, wie er den Korpsstudenten aus der miserablen Masse der unbemützten Streber emporhebt.
Als ihm daher aus dem Munde des Examenkommissars die Kunde geworden war, daß er mit Note 3 die Reifeprüfung bestanden habe, eilte er, noch in Prüfungsfrack und weißer Binde, auf das Telegraphenamt und sandte seinem Vater, dem würdigen Professor der Weltgeschichte an der Universität Halle, ein Telegramm, das kein anderes Wort enthielt als: Durch! Dann ging er ruhigen aber heiteren Geistes in das Gasthaus zum Schwarzen Adler, wo ein Mädchen namens Camilla das Amt einer Kellnerin bekleidete. Dieses Mädchen war groß, blond, nett, von ausgiebiger Busenfülle und zutraulichem Gemüte. Deshalb liebte es Herr Ewald Brock.
Für Gymnasiasten war Camilla verboten, weil es der Schwarze Adler auch war, und Herr Ewald Brock hatte es deshalb bisher nur wagen dürfen, spät abends und durch eine Hintertür den Ort seiner liebsten Zerstreuungen zu besuchen. Heute ging er ostentativ am hellen Tage durch das Vorderthor ein, begab sich auch nicht in die Kutscherstube, die er aus Gründen scheuer Vorsicht sonst zu frequentieren pflegte, sondern er setzte sich mit kühner Gelassenheit in die offizielle Gaststube zu den Honoratioren der Ackerbürgerschaft und nahm dort in aller Öffentlichkeit die Glückwünsche Camillas entgegen, die ihn heute mit einem Beitone von zärtlichem Stolze Mei gescheides Luderchen nannte. Denn sie war aus Sachsen.
Ich erachte es für unnötig, zu betonen, daß sich Herr Ewald Brock an diesem Abend nicht wie ein Wüstenheiliger benahm und Abscheu gegen spirituose Getränke an den Tag legte. Er betrank sich vielmehr mit einer gewissen planmäßigen und unerschrockenen Zielsicherheit. Erwähnt zu werden verdient aber, weil es einen schätzbaren Einblick ins Herrn Brocks Psyche gewährt, daß er dies, der Feier des Tages zu Ehren, nicht in Bier, sondern in einer absonderlichen Sorte Rotwein that, die sich von gewöhnlichen Rotweinmarken außer durch einen gewissen vitriolischen Geschmack darin unterschied, daß sie von Aussehen eher blau als rot zu nennen war. Diese koloristische Eigentümlichkeit vermochte es indessen nicht, Herrn Ewald Brock auch nur leise zu irritieren. Ihm war jeder Rausch gleich willkommen, ob es nun ein blauer oder ein roter war. Er hätte selbst gesprenkelte Räusche mit heiterm Gleichmut, ja mit Wohlgefallen und Dankbarkeit, hingenommen.
Als er nach Hause kam, hochgemut und trällernd, fand er auf seinem Tische ein Telegramm aus Halle vor. Der Alte ist doch ein braver Knabe, dachte er sich gerührt. Siehe, schon drahtet er Draht!
Als er aber das Telegramm aufgemacht hatte, las er die Worte: »Was soll das heißen. Bist du wieder durchgefallen oder endlich durchgekommen? Sofort Drahtantwort.« Dieser Mangel an Vertrauen kränkte Herrn Ewald Brock sehr. Er schritt ärgerlich in seinem Zimmer auf und ab und meditierte: Da hat man dem Alten nun den Gefallen gethan, hat sich, weiß Gott, geschunden wie ein Ochs, gebüffelt wie ein Pferd, und was thut er? Er macht Einem telegraphische Grobheiten dafür. Hätte mich schön gehütet, zu telegraphieren, wenn ich durchgefallen wäre. So was!
Auf einmal verwirrte sich was in seinem Gehirn. Es war ihm, als wenn sich eine molkige Masse zusammenballte, etwas ganz unbeschreiblich Scheußliches. Himmel! Am Ende bin ich wirklich durchgefallen und hab mir in der Besäuftheit das andre bloß eingebildet? Herrgottsdonner . . . aber ja, natürlich! Es kann ja gar nicht anders . . . .
Der Angstschweiß trat ihm auf die Stirn, seine Augen glotzten ratlos durch die Fenster in die Nacht, und es kam ihm der Gedanke, daß er morgen die Schule verschlafen würde.
Aber wie er voll grimmiger Verzweiflung seine Hände in die Hosentaschen bohrte, da fühlte er in der rechten etwas knisterndes, und sogleich hellte sich sein Gesicht stupide fröhlich auf. Er ergriff das Knisternde und zog es heraus. Na ja, da stand sie schwarz auf weiß und ganz nüchtern, die staatliche Bestätigung seiner wissenschaftlichen Reife. Über alle Zweifel erhaben und unter Ausschluß jedes Betrunkenheitsverdachtes stand es kalligraphisch da, und Herr Ewald Brock las es mit kosenden Augen. Donnerwetter ja, er fühlte sich in diesem Augenblicke sogar von einem gewissen Hochgefühle offizieller Gelehrsamkeit erfüllt, und er fand, daß er in der That nicht unbeträchtliche Schätze seltenen Wissens in sich aufgespeichert trage. Massen einfach, Säcke, zum Bersten voll, geschwollene Schläuche voll edeln Weines. Das Entzücken überwältigte ihn und gab seiner Phantasie eine gewisse breit ausladende Kraft. Wie ein Magazin kam er sich vor, oder wie ein schwerer, schwankender Heuwagen. Aus diesem Grunde empörte es ihn etwas, daß er das wichtige Dokument, das alles dies bescheinigte, so respektlos zerknittert und mit blauroten Flecken unanmutig verziert in der Hosentasche herumgetragen hatte, und er nahm sich vor, mit derlei feierlichen und bedeutsamen Schriftstücken künftig pietätvoller umzugehen.
Im übrigen war er sehr müde. Donnerwetter: schon halb zwölf Uhr! Ganz Pommern schlief, und er durchgrübelte die Nacht! Also denn ins Bett gethan den gelehrten Leib! Oh Camilla! Puah! Was das Mädchen für Beine hat! Beine! Zumal oben 'rum.
Herr Ewald Brock hatte schon seinen rechten Stiefel ausgezogen und mit einem kraftvollen Schwunge, der Übung verriet, von der Spitze der Zehen gegen die Kleiderschrankthüre geschleudert, da überfiel ihn weiß Gott schon wieder ein Gedanke: Der Alte will ja Drahtantwort!
Es blieb Herrn Ewald Brock nichts anderes übrig, er mußte wiederum meditieren. Welch ein unglaublichere Tag!Dies nefastus cerebralis. Und dabei dieser Schädel! Ihm schien, er müsse birnenförmig sein und oben einen Stiel haben. Oh Camilla!
Ein alter Weltweiser aber hat gesagt, daß die Biene selbst aus bitteren Pflanzen Honig sauge. Herr Ewald Brock, obschon er keine Biene war, bewährte die Wahrheit dieser Sentenz. Er saugte aus der bitteren Notwendigkeit, morgen sehr früh aufstehen zu müssen, die erleuchtete und kandierte Idee, daß es das Beste sei, wenn er sich nicht hier, in seiner menschenleeren Wohnung, sondern drüben im Schwarzen Adler zu Bette legte. Denn dort war er sicher, früh geweckt zu werden, maßen Camilla pünktlich um sieben Uhr aufstehen mußte.
Trällernd, wie er in sie eingetreten war, verließ Herr Ewald Brock seine Wohnung.
2. Kapitel
Haben Sie schon einmal junge Stiere gesehen?
Es wäre mir ein schmerzlicher Gedanke, wenn ich annehmen müßte, daß im fröhlichen Gewimmel meiner Leserschaft irgendwelche Voreingenommenheit gegen Herrn Ewald Brock bestünde. Oh ja: Er könnte strengeren Anschauungen in allerlei Punkten huldigen. Er könnte mehr Gesetztheit zeigen und standhafter gegen die Lockungen der Welt sein. Er könnte mehr Prinzipien haben. Kurz: Er könnte Ihnen, verehrter Leser, und Ihnen, teure Leserin, ähnlicher sein.
Aber: Haben Sie schon einmal junge Stiere gesehen, die nach überstandenem Winter aus dem Stall auf die Weide gelassen werden? Himmel, was für einen hufschlenkernden Galopp vollführen diese Burschen! Wie heben und senken sie die Hörner! Mit was für herausfordernden, tumultuarischen Augen sehen sie den blauen Himmel und die grüne Wiese und die roten Kühe an! Und ihr Gebrüll gar! Sie können's zwar noch nicht so donnertönig voll wie die alten schnauzwütigen Stiersenioren, aber sie thun es mit viel mehr Schwung, Hingabe und Leidenschaft.
Nun wohl: In ähnlicher Lage benahm sich Herr Ewald Brock ähnlich.
Einstweilen, im väterlichen Halle, mußte er seinen Freiheitsgefühlen freilich noch einigen Zwang anthun. Da war der salbungsvolle Herr Vater mit ernsten Reden, da war die gelindere Frau Mama mit sänftlich guten Lehren, da waren die sittigen Schwestern mit still eckigen Geberden. Wehe, wenn er hier losgaloppiert wäre!
Also benahm er sich nach Kräften wohlanständig, trug einen langen schwarzen Rock, ein kleines schwarzes Hütchen, bescheidene Klappkragen, ein dünnes kümmerliches Shlipslein, hatte sein Haupthaar rechts gescheitelt, seine Augen bescheidentlich gesenkt und seine Zunge in gutem Zaume. Trank auch nicht zuviel Berauschendes und mied bedenkliche Lokale. Dafür zeigte er sich ernsten Antlitzes allen Ermahnungen recht zugänglich, kaufte sich viele medizinische Bücher und ein Mikroskop, ging sogar einmal in ein Kirchenkonzert. Kurz, er benahm sich so brav, daß es den guten Eltern kein Wagnis schien, ihn aus der häuslichen Hut nach Würzburg zu entlassen, wo auch Brock senior einsten studiert hatte.
3. Kapitel
Ein aufdringliches thörichtes infames, ein überflüssiges Fremdwort.
In Würzburg sehen wir Herrn Ewald Brock in veränderter Gestalt.
Er hat eine rote Mütze und einen goldenen Zwicker auf; er trägt einen verwegen gelben Anzug mit einem verschmitzt kurzen Jackett, und seine Cravatte ist eine Fanfare aus grüner, gesprenkelter Seide. Sein Haar ist mit kernhaft ausgeprägtem Sinne für Konsequenz von der Stirn zum Nackenknochen wie nach der Schnur geteilt, und so glänzend ist es pomadisiert, daß man sich darin spiegeln könnte. In seinen Händen aber, dunkelrot in das geschmeidige Leder des Mopshundes gehüllt, dreht sich ein Spazierstock von erstaunlicher Dicke.
Es ist kein Wunder, daß ein Fuchs, der sich so vorzüglich anläßt, ein hervorragender Korpsbursche wird.
Herr Ewald Brock wird der Stolz seines Korps. Seine Gestalt gewinnt sichtlich an Embonpoint, sein Gesicht nimmt zu an Quarten und Terzen, sein Gang wird wuchtig und selbstbewußt. Wenn er einen Salamander kommandiert, so werden die Füchse wie mit Begeisterung geladen, wenn er auf der Mensur steht, so wissen die Paukärzte, daß es einen Knochensplitterregen geben wird, wenn er als Chargierter in der Equipage fährt, so ist es den Mädeln, sie wissen nicht wie, aber unangenehm ist es ihnen nicht.
Die Mädel! Das ist nun eigentlich ein wunder Punkt in Herrn Ewald Brocks Korpskarriere. Ein richtiger Korpsstudent, wie man weiß, sollte das weibliche Geschlecht der Öffentlichkeit gegenüber alsquantité négligeablebehandeln und sich hierin, wie auch sonst, deutlich und mit Würde vom Geschlechte der Lyriker unterscheiden. Aber das Herz des Herrn Brock, obwohl er lyrischer Fehltritte ganz unverdächtig ist, geht, ach, mit jeder Schürze bockssprüngig durch, und von einem Unterrocke gar braucht es nur den untersten Saum zu ahnen, um zu schlagen wie ein Lämmerschwänzchen. Daher fehlt es nicht an ärgerlichen Affairen; Herr Ewald Brock wird sogar einmal aus dem Korps gehängt deswegen. Aber die Erfahrenheit der älteren Semester sah ein, daß es in diesem Falle gut sei, die Augen des moralhütendenC. C.zuzudrücken, und Herr Ewald Brock ist in der That eine viel zu unersetzliche Kraft, als daß sich nicht alles immer wohlgefüglich einrenken sollte.
Herr Ewald Brock fühlte sich über die Maßen wohl in diesen Verhältnissen, die den Leib durch ritterliche Übungen und Alkohol stärkten und doch das Herz nicht verkümmern ließen.
Sechs Semester hat er untadelig in Würzburg verbracht. Ich schätze, er wäre heute noch dort, wenn nicht eines Tages ein unangenehm energischer Brief des alten Herrn aus Halle eingetroffen wäre. Dieser Brief handelte vomtentamen physicum. Ob das nun eigentlich endlich erledigt sei? Er hoffe: Ja! Wenn aber nein, so sei es mit der Würzburgs Herrlichkeit endgiltig aus, und Herr Ewald möge die Güte haben, den Schauplatz seiner Thätigkeit sofort nach Halle zu verlegen.
Dieser Brief ist Herrn Brock junior eine schmerzliche Botschaft.
Das Wortphysicumallein geht ihm schon auf die Nerven. Ein aufdringliches, thörichtes, infames, ein überflüssiges Fremdwort! Und nun gar Halle! Halle! An der Saale! Ein ganz unmöglicher Ort! Denn sein Corps hat mit dem dortigenS. C.nicht die entfernteste Cartellbeziehung.
Ob er die Sache nicht in München erledigen könne? Die dortige Fakultät sei auch sehr tüchtig. Desgleichen das Klima.
Aber der alte Herr ist von einer ganz ungewohnten, geradezu beleidigenden Entschiedenheit. Es ist, juristisch gesprochen, eine reine Bedrohung: Entweder Halle oder kein Monatswechsel.
Brutaler Gewalt muß kluge Überlegung weichen. Kein Ausweg mehr. Der schnöde Trumpf liegt auf dem Tisch. Herr Ewald Brock muß sich und seinem Korps und all den süßen Favoritinnen den Schmerz des Abschieds anthun. Er wird mit dem Band als inaktiv entlassen, richtet noch eine große Feuchtigkeit auf der Kneipe und bei einigen untröstlichen Töchtern der Eingeborenen an und fährt mit zerknirschter Seele nach der Stadt seiner Väter.
4. Kapitel
Das grenzt schon an Pommern!
Wieder geht eine sichtliche Veränderung mit Herrn Ewald Brock vor.
Sein Habitus bekommt etwas Niedergeschlagenes, Beklommenes, Verwaistes. Da er Mütze und Korpsband nicht mehr tragen kann, legt er auch die heiter hellen Anzüge und schmetternden Cravatten ab, und der gewaltige Spazierstock, zu Würzburg genannt Christoph der Bedrohliche, steht, wie ein abgelohnter Hausknecht ohne Condition, neben dem ganz verstaubten Paradeschläger im Schirmständer.
»Nie warf sich schwarze Gallsucht so mit Wucht Auf eine heitre Seele . . .«
Die Frau Mama kriegt's schier mit der Angst und meint, man hätte den armen Jungen auch nicht gleich so derb anfassen sollen. Wie leicht könnte er dauernden Schaden an seinem Gemüte nehmen. Aber der Vater Professor, unerbittlich, grausam, ein Tyrann, läßt nicht ab von grimmiger Strenge und erklärt mit gräßlichen Beteuerungen, daß Halle nicht eher verlassen wird, ehe denn das Physikum bestanden ist.
Oh dreimal scheußliche Notwendigkeit! Es geht ans Studieren.
Herr Ewald Brock, der ehedem mit so viel Meisterschaft und Finesse die jungen Füchse für die Mensur einpaukte, muß es über sich ergehen lassen, daß ihm jetzt Physik, Chemie, Anatomie, und was dergleichen unerquickliche Gehirnbelastungen mehr sind, eingepaukt werden. Er kommt sich wie entthront vor. Behandelt man ihn nicht impertinent? Wie einen Schuljungen? Sogar das versetzte Mikroskop und die medizinische Bibliothek, die so ungebührlich teuer ist, hat er sich wieder anschaffen müssen, und ohne Zuschuß! Er ist über alle Begriffe unglücklich. So fürchterlich hätte er sichs nicht vorgestellt. Das grenzt schon an Pommern!
Aber nach drei Semestern meldet er sich wirklich zum Physikum, und nach abermals dreien besteht er's mit Note 3.
5. Kapitel
Ein solcher Stier geht ruhig fürbaß.
Der unpsychologische Leser, der sich, wie ich hoffen will, in seiner guten Meinung von Herrn Ewald Brock durch die Unglücksschläge, die dieser gemarterte Mann im vorigen Kapitel zu überstehen hatte, nicht hat erschüttern lassen, wird nun flugs glauben, daß mein Held in heftig schöner Gemütsaufwallung sogleich nach Würzburg fährt, um den sechs mageren Semestern weitere sechs korpulente folgen zu lassen.
Oh über den unpsychologischen Leser! Ich beklage ihn. Wie wenig, wie schlecht kennt er Herrn Ewald Brock!
Wie? Hat er jemals gesehen, daß ein Stier, der bereits in der Deichsel gestanden, herumhoppste und brüllte wie ein junger Galoppant, wenn man ihn auf die Weide gelassen? Nein! Ein solcher Stier geht ruhig fürbaß, rupft sich sinnend das Maul voll Klee und legt sich langsam wiederkäuend ins dichte Gras.
Nun wohl: In ähnlicher Lage benahm sich Herr Ewald Brock ähnlich.
Es war ihm ganz und gar nicht galoppierend zu Mute. Salamander kommandieren, Füchse einpauken, die Backen hinhalten für andrer Leute lange Messer schien ihm eine zwar nicht unlöbliche aber doch mehr für das Jünglingsalter passende Beschäftigung. Er seinerseits, so fühlte er, gehörte nicht mehr zu jener heiteren, aber unerfahrenen Jugend, der dichtes Lockenhaar den Scheitel kränzt. Er hatte eine Platte. Er hatte einen Spitzbauch. Niemals mehr würde er den Schläger steif hoch halten können, wie es die Pflicht der Deckung gegen die Hochquart erfordert. Es lagerte zuviel anstudiertes Fett vor. Gelehrsamkeit ist ritterlichen Künsten undienlich. Wo sie nicht entnervt, verfettet sie. Es ist schon tragisch.
Also: Kein Gedanke an Würzburg! Aber, beim hohen Himmel, auch kein Gedanke an Halle! Der alte Herr in seiner Verstocktheit hätte es freilich am liebsten gesehen, wenn sich Herr Ewald in dieser unerfreulichen Stadt bis ins Endlose hätte fortnudeln lassen mit allen Disziplinen der Heilkunde. Aber nein! Diesmal liegen bindende Zusicherungen vor. Ein jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, sagt schon Moses oder Lassalle. Der ausbedungene LohnseinerArbeit aber war die Befreiung aus Halle.
Er für seine Person war mit lebhafter Entschiedenheit für Berlin. Das sei die Stadt für ein gereiftes Studium! Die klassische Stadt der älteren Semester! Die Reichshauptstadt! Die Hauptstadt der deutschen Wissenschaft! Virchow! Koch! Und wie sie alle heißen! Dutzendweise glänzen dort am Himmel der Medizin die Kapazitäten! Und Klinken giebt es soviele wie Kasernen!
Aber der alte Herr war kürzlich zum Historikertage dort gewesen und hatte, wie er des Nachts mit jungen Kollegen die Stadt besah, Beobachtungen gemacht, die es ihm geraten erscheinen ließen, sein Veto gegen Herrn Ewalds Übersiedelung an die Spree einzulegen. Gewiß, es müsse eine der großen Universitäten mit reichen klinischen Einrichtungen und ersten Koryphäen der Wissenschaft sein. Aber nicht Berlin. Nein, nicht Berlin. Sondern Leipzig etwa.
Also gut! In Gottesnamen: Leipzig. Es war wenigstens nicht Halle.
Herr Ewald Brock packte seine medizinische Bibliothek, seine Instrumente, sein Mikroskop zusammen und fuhr mit einem nachdenklichen Gesichte ins Sächsische.
Es ging ihm allerlei durch den Kopf während der Eisenbahnfahrt.
Was sollte er nun eigentlich in dieser Handels- und Universitätsstadt?
Studieren vermutlich?
Ganz wohl! Studieren! Gewiß! Das stand wohl unumgänglich fest. Denn, irrte er nicht, so wollte er Arzt werden.
Wollte? Doch wohl eigentlich mehr: Sollte! Aber gleich viel! Auf den Arzt lief es hinaus. Da war das Zeugnis des bestandenen Physikums. Dieser Obstkuchen war nun mal angeschnitten. Auch mußte die ärztliche Praxis nicht ohne Annehmlichkeiten sein. Und die medizinische Wissenschaft, so viele Schattenseiten sie ohne Zweifel hat, ist doch wenigstens nicht so zwecklos wie die andern. Sie bringt mit dem Leben in Berührung! Na, und das Leben ist doch noch immer das Amüsanteste auf der Welt. Wenn er z. B. Frauenarzt würde? Wie, Ewald?
Dabei fiel ihm die Frage aufs Herz, wie es denn wohl inpuncto punctistünde zu Leipzig der Stadt? Ob sie wohl annehmbar wären, die Töchter der Eingeborenen?
Doch vermutlich! Und es rührte sich ein Stückchen historisches Erbteil vom Vater her in Herrn Ewald Brock, indem er sich sagte: Es ist eine alte Universitätsstadt, die schon Generationen von Studenten in ihren Mauern sah. Da muß sich wohl ein guter Stamm Weiblichkeit gebildet haben. Überdies ist es immerhin ein ziemlich großer Marktflecken. Und richtig! Hat es Schiller nicht mit Paris verglichen?
Herr Ewald Brock fühlte sich beruhigt, und als er schließlich bedachte, daß sein Korps mit einem Leipziger in Vorstellungsverhältnis stand, daß er also als mitkneipender Korpsbursch eines standesgemäßen Unterkommens in entsprechender Gesellschaft sicher war, da dünkte es ihm eine ganz erfreuliche Schickung zu sein, daß er sich gerade in Leipzig studierenshalber aufhalten sollte.
6. Kapitel
Er war nicht happig.
Wenn mein verehrter Leser zur Zeit, da diese wahre Geschichte spielt, mittags zwischen elf und zwölf Uhr auf der Grimmaischen Straße in Leipzig spazieren gegangen wäre, so würde er regelmäßig einem angenehm beleibten, doch nicht geradezu fetten Herrn begegnet sein, der mit der Miene eines erfahrenen, aber die Welt noch immer mit herzlichem Interesse betrachtenden Mannes und in der Kleidung eines von einem guten englischen Schneider bedienten Repräsentanten der wohlbegüterten Volksschicht einherwandelte, freundlich gemessen die steifen Mützenschwünge der Corpsstudenten mit einem leichten Heben seines glänzenden grauen Cylinderhutes erwiderte und nicht gar selten hübschen jungen Mädchen von confektionösischem Aussehen, wie sie um diese Zeit in dieser Straße immer in mehreren guten Exemplaren zu treffen sind, mit der hell behandschuhten Rechten kordiale Grüße zuwinkte, auch wohl ab und an mit einer dieser netten Personen in eine Nebenstraße einbog, um dort ungestörter freundliche Worte gefälligen Scherzes mit ihr zu tauschen.
Dieser liebenswürdige, joviale Herr, der Anfang der dreißiger stehen mag und in nichts an das Normalbild der Leipziger Studenten erinnert, ist Herr Ewald Brock.
Sieht man ihn so in seiner lebemännischen Haltung, der es aber nicht an einem Beitone von gemütlicher Leutseligkeit fehlt, so würde man einen Herren vor sich zu haben meinen, der die Klippen akademischer Prüfungen längst mit Gewandtheit umschifft oder überhaupt nicht den Ehrgeiz nach einem gelehrten Grade hat. Die unerbittliche Wahrheit erfordert es indessen, zu konstatieren, daß der imposant schäkernde Herr sich noch inmitten der strudelnden Fluten des Universitätslebens befindet. Wir haben Herrn Ewald Brock in seinem vierten Leipziger Semester vor uns, und es wäre unbillig, zu verlangen, daß er jetzt schon am Ende seiner Studien angelangt sein sollte. Wir wissen, es lag nicht in seinem Wesen, zu rennen, unanständige Eile war ihm fremd, seine Korpulenz verbot ihm geradezu, Sprünge zu machen.
Die Zeit dagegen, diese klapperdürre Geschwindspinne, raste in einem unangenehmen Tempo. Semester tobten förmlich an ihm vorüber. Es wurde ihm manchmal fast ängstlich, wenn er sie so jagen sah, die Generationen der akademischen Bürger. Jetzt waren schon die Bürschchen auf dem Plan, die zu seiner Zeit Quintaner gewesen waren.
Höchst überflüssig daher, daß der alte Herr unausgesetzt ans Studieren mahnte. Natürlich studierte Herr Ewald Brock. Man konnte sagen: Täglich. Nur übernahm er sich nicht. Er war nicht happig. Das unterschied ihn von den gewissenlosen Strebern, die, selbst erst Skizzen von Menschen, sich getrauten, praktische Ärzte zu werden, ehe sie praktische Menschen wurden. Welch' ein Fürwitz! Er seinerseits nahm es genauer, gewissenhafter. Erst galt es, das Leben zu ergründen, sich selbst in runder Fülle zu einem fertigen Menschen zu gestalten. Meint man, das gehe schnell? Ist das Leben nicht das schwerste Studium nach der übereinstimmenden Meinung aller Weltweisen? Man müßte ein Genie sein, um das im Husch zu erfassen. Hatte er sich aber je für ein Genie ausgegeben? Man weise ihm das nach! Ein Idiot war er ja gewiß nicht, aber sein Gehirn verdaute langsam. Das war Schickung wie ein schlechter Magen. Konnte er für sein Gehirn? Hatte er sich's gemacht? Und: Wenn er gesunde Instinkte für die Weiblichkeit hatte, war das etwa seine Schuld, sein boshafter Vorsatz? Daß er nicht wüßte! Er war nicht befragt worden, was für Instinkte er sich wünschte. Möglich, daß er sich die Instinkte eines Wander-Quäkers gewünscht hätte. Es istallesmöglich.
Immerhin genierten ihn ziemlich häufig Anwandlungen solcher Art, und er war in solchen Augenblicken nicht glücklich zu preisen. Ich fürchte, er wäre sogar schließlich einer schleichenden Übernachdenklichkeit mit melancholischen Momenten verfallen, wenn nicht ein glücklicher Umstand rettend eingetreten wäre.
Herr Ewald Brock lernte Fräulein Mathilde Holunder kennen
Mir ist, als ob ich jemand lachen hörte. Ach, Freund Leser, Sie finden den Namen Holunder zu lyrisch für Herrn Ewald Brock? Sie denken sich: Wie kann man einen so unpassenden Namen erfinden?
Lachen Sie immerhin! Aber reden Sie mir nicht von Erfinden, wenn Ihnen meine Freundschaft wert ist. Diese Geschichte ist so wenig erfunden wie der König David. Ich kann nichts dafür, daß der rettende Engel meines Helden Holunder hieß. Das Schicksal macht oft sonderbare Nomenclaturen. Es bringt es fertig, einen Dichter Klopstock und einen Händler mit alten Hosen Veilchenblüh zu nennen. Warum also sollte es eine Schlangendame nicht Holunder heißen?
Eine Schlangendame,eccoló! Endlich haben wir sie!
7. Kapitel
Ist sie nicht wie die Morgenröte lieblich?
Herr Ewald Brock lernte den Engel, der ihn retten sollte, kennen, als er eines Abends mit seinem Freunde Stilpe, dessen Bekanntschaft die Kenner der besseren modernen Litteratur in meiner anderen wahren Geschichte, der vom Negerkomiker, gemacht haben, die Vorstellung im Stadtgarten besuchte. Stilpe war eigentlich kein ganz passender Umgang für Herrn Ewald Brock, da er einmal einen Fehltritt begangen hatte. Er gehörte, wie meine Freunde wissen, zu jenen gefallenen Jünglingen, die, statt in ein Korps, in eine der vielen und mannigfach benannten anderen Verbindungen getreten sind, die der Korpsstudent kurz und schnöde allesamt mit dem Zweisilber Blase bezeichnet. Dieser Makel wog schwer für Herrn Brock, aber es war in dem Mirkokosmus Stilpe so vieles, das seinem Wesen ähnlich war, soviel Wahlverwandtes zumal, daß er mit Aufbietung einiger Seelengröße über die geringere soziale Stellung des Mannes hinwegsah und sich ihn, wenigstens für den circensischen Teil seiner Neigungen, zum Freunde erkor. Stilpe war, wie er, Mediziner in vorgerückten Semestern; gleich ihm übte er sich mit Ausdauer und Hingebung in den schwierigen Künsten des Lebens; gleich ihm betonte er bei diesen Studien den Umgang mit dem zarten und gemütvollen Geschlechte, das von der Weltordnung zur Ergänzung der rauhen Männlichkeit bestimmt ist; gleich ihm auch liebte er das Geistige in den Getränken. Unähnlich waren sich die beiden insofern, als Stilpes Wesen von größerer Agilität, so leiblich als geistig, war, wie sich das schon in seiner weitaus knochigeren, schmäleren Statur ausdrückte. Auch besaß er im Zusammenhange damit eine geläufigere Zunge, er war, in der reichen Tropik seiner Sprache zu reden, auf dem Klappenwerke protuberant gut beschlagen.
Diese beiden also, der tunfischdicke Herr Ewald Brock, und der heringschlanke Stilpe (dieser nicht völlig mit der sicheren Eleganz jenes, aber immerhin nicht ohne Sinn für modernen Schnitt gekleidet) betraten an einem Winterabend den Zuschauerraum des Stadtgartentheaters, wo sie sich mit der Miene der anerkannten Habitués nahe dem Klavier niederließen.
Sie waren gerade in ein Couplet hineingeraten, in dem ein hübsches dickes junges Mädchen behauptete, sie habe viel Courage, wohne Bel-Etage, ihre hohe Gage, die erlaube es ihr.
»Ein liebes kleines Ferkelchen,« sagte Stilpe, »aber wie kann man bloß Zickert heißen, wenn man so nette dicke Beinchen hat. Zickert kommt her von Zicke, das ist: Ziege. Ziegen aber haben keine Waden, wie schon der alte Buffon so richtig bemerkt hat. Mädchen, nenne dich künftighin Schinkel! Das schlägt in die Kunst und hat den Vorzug einer gewissen Suggestionskraft.«
»Ruhe!« rief das Publikum.
»Der Mob hat kein Interesse für Etymologie,« meinte Stilpe, »und da reden die Leute von gehobener Volksbildung. Kommt Zickert etwanichtvon Zicke, meine Herren?«
»Ruhe!« rief das Publikum.
»Ist Zicke etwanichteine korrumpierte Form von Ziege?« schrie Stilpe.
»Ruhe!« rief das Publikum.
»Lesen Sie im Buffon nach, verehrte Anwesende!« schrie Stilpe.
»Schmeißt den Kerl doch raus!« rief das Publikum.
»Schinkel ist das einzig Wahre!« donnerte Stilpe. »Wer für Stilpe ist, bekenne es laut und freudig mit einem deutlichen Ja!«
In diesem Augenblicke, als das Publikum Miene machte, aggresiv gegen Stilpe vorzugehen, kam eine weibliche Person, in einen dicken Theatermantel gehüllt, durch die Bühnenthüre in den Zuschauerraum, ging auf Stilpe zu und sagte sehr ruhig: »Du bist also noch immer der alte Esel! Willst du gleich stille sein?«
»Oh!« rief Stilpe erst laut, dann aber dämpfte er seine Stimme und sagte mit leiser Rührung: »Du bist es, Woglinde, meine süße Windung? Komm, rhythmisches Mädchen, lagere Dich an meinen Busen!«
»Das werd ich bleiben lassen. Aber ich will mich her zu Dir setzen, damit ich Dir den Mund zuhalten kann.«
»Unnötig, Du glättendes Öl meiner gelehrten Leidenschaft! WoDeineWonne bebt, schweigt meine Tuba.«
Während sich das Publikum langsam beruhigte, da es den wilden Hering gebändigt sah, stellte dieser das Mädchen seinem Freunde vor:
»Dieses aber, mein teurer Ewald, ist das Mädchen, von welchem schon die Alten sagten: ›Seht, welche ein netter Käfer!‹ Zücke Dein Monocle, Mann, und betrachte sie! Ist sie nicht wie die Morgenröte lieblich? Hat sie nicht unter blonden Haaren braune Augen? Rehe, lagernd unter Weizengarben, würde Salomo sagen, dieser begabte König, der das Hohelied gemacht hat. Sind ihre Backen nicht rot und rund und ihre Lippen desgleichen? Aber du mußt sie in Trikots sehen, die von der Farbe blonden Fleisches sind! Diese Beine . ! . Meine Harfe schweigt.«
Beine, – das Wort zündete bei Herrn Ewald Brock, der ohnehin mit Interesse in diese braunen Augen sah, die zu Stilpes Redeschwung belustigt lachten. Er sprach: »Hä, werden wir sie heute noch zu sehen kriegen, die p. p. Beine?«
Das Mädchen sprach: »Nein, Herr Doktor! Ich bin fertig da oben, und ich wollte schon nach Hause gehn, wie ich das Klappenwerk da erkannte. Ich hätt' es ja ruhig mit ansehen können, daß sie ihn an die Luft setzten, aber ich dachte mir: Er hat zwar eine entsetzliche Manier am Leibe, die Leute kaputt zu reden, aber schließlich ist er doch 'n ganz passabler Kerl, dem man einen Knochenbruch ersparen kann.«
Stilpe that beleidigt: »Redet sie nicht Pamphlete? Ach du Wabernde, warum beschimpfst Du mich? Hast Du mich nicht einsten geliebt, wie nur ein Mädchen mit Deinen Muskeln lieben kann? Trag ich nicht heute noch blaue Flecke von Deiner Liebe?«
Das Mädchen sprach: »Sie sind sein Freund, Herr Doktor? Na, dann wissen Sie, daß er mehr lügt, als nötig ist. Nee, Stilpeken, wenn ich nicht Deine schnodderige Seele verehrte, in Deine Knochen würd' ich mich nicht verlieben.«
Stilpe: »Ewald, das geht auf Dich! Pauline macht Dir Avancen!«
Herr Ewald Brock war nicht abgeneigt, dies zu glauben, denn dieses Mädchen that ihm wohl, obwohl er bei Tingeltangeldamen eigentlich eine robustere Umgangssprache vorzog und es stilwidrig fand, daß dieser Theatermantel so gewissermaßen hochdeutsch redete. Er sprach und legte Schmelz in seine Stimme: »Paula heißen Sie? Hä, ein schöner, wohlbeleibter Mädchenname. So . . . rund. Hä, mollig!«
Das Mädchen: »Na, eigentlich heiß ich Mathilde. Aber, sehen Sie, das ist kein Name für so einen Theaterzettel.«
Jetzt mußte Stilpe, wollte er nicht platzen, in das Gespräch eingreifen: »Paula Morlow. Man beachte, wie dumpf das dahin rollt. Schlangendame und Serpentine-Cancanöse. Letzteres Eigenbau, persönlich erfundene Spezialität. Auch Woglinde genannt, aber nur von mir. Im Zivilverhältnis Mathilde Hol . . . hol mich der Teufel, ich bring's nicht heraus, das Wort, es stinkt nach Fliederthee, . . . Hol . . . Hol . . . Mädchen, thu das Mündchen auf und sag's selber! Es ist unaussprechlich!«
Das Mädchen: »Kindskopf! Ich heiße nämlich Holunder mit meinem Familiennamen.«
Herr Ewald Brock gings wie dem verehrten Leser, der vorhin lachte. Es kam ihm unwahrscheinlich vor. So ein nettes, rundes Ding und: Holunder! Er faßte sich aber und sprach: »Hä, ein wirklich einigermaßen erstaunlicher Familienname. Aber, hä, nett, muß ich finden. Ja, sehr nett, hä. So 'ndichterischerName!«
Stilpe war empört. »Ein ganzinfamerName. Paula, ich sage Dir, Du mußt heiraten, heiraten mußte, daß Du 'n los wirst. Du könntest geradesogut mit einer Crinoline herumlaufen wie mitdemNamen. Wennichnu' Aprikose hieße!«
8. Kapitel
Ich denke: die Situation ist klar.
Herr Ewald Brock hatte sich durch den Namen Holunder nicht abhalten lassen, das mit ihm behaftete Mädchen lieb zu gewinnen.
Es war verwunderlich, was ihm da geschah. Es entwickelte sich hier ein Verhältnis, das gar nicht mehr ein Verhältnis in dem bewußten Sinne dieses Wortes war. Gott, seine »Verhältnisse« sonst! Intermezzi wie im Cirkus, wenn es heißt: Die Pausen werden von den Clowns ausgefüllt. Alle die kleinen Mädchen, mit denen er es zu thun gehabt hatte, waren ihm ja gewiß angenehme Objekte gewesen, eine Art von Kleiderständern, an denen er seine Gefühle aufhing, um sie auf eine Weile los zu werden. Aber wenn ihm die Objekte mitsamt den Gefühlen durchbrannten, so ward er keineswegs in Trübsal getaucht. Man konnte eher sagen, daß er derlei Geschehnisse mit einer Fassung ertrug, die von Schnuppigkeit nicht weit entfernt war. Das kam daher, weil er selbst nie daran gedacht hatte, der oder jener Ständer sei der ewig einzige Haken für seine Gefühle. Laß fahren dahin! sang er mit seinem berühmten Landsmann Luther.
Aber hier, diesmal, war es ganz anders. Kein Kleiderständer! Und viel mehr Gefühle, als auf ein solches Möbel gegangen wären. Vielleicht ein Schrank? Ein ganzer großer Kleiderschrank für Gefühle? Noch nicht geräumig genug! Einen größeren Begriff her! Ich hab's: Eine ganze Kleiderstube, eine ganze Garderobe mit unzähligen Haken und Häkchen für unzählige Gefühle!
So war es! Herr Brock hatte sehr bald die Empfindung, daß dieses gesunde, frische, wohlgebaute Mädchen mit den großen braunen Augen, die so eigen still lebendig waren, und mit der lieben weichen Art, leise zu lachen; mit diesen runden, lustigen, aber nicht zu schnellen Bewegungen; mit dieser eher tiefen als hohen Stimme, die den Worten etwas wie einen warmen linden Flaum gab; mit diesem anschmiegenden, aber nie lästigen, vielmehr im Grunde ganz merkwürdig selbstbewußten Wesen, – er hatte die Empfindung, daß diese still resolute, aber durchaus feine weibliche Natur etwas Wohnliches, Heimliches in sein Leben brachte, etwas, darin man sich strecken und dehnen und wohl sein lassen könnte eine lange, lange Weile hin, sorglos, angenehm behütet und doch in keinem Zwange.
Wie sich diese Empfindung zur sanftlebenden Gewohnheit in ihm auswuchs, daß er sich sagen mußte, es würde recht fatal sein, wenn diese angenehme Situation plötzlich einmal aus wäre, zog er die logische und praktische Konsequenz daraus und begründete mit Fräulein Mathilde Holunder einen gemeinsamen Haushalt. Er hätte dies in ehrlicher Deutschheit gerne ohne alle Heimlichkeit und Hinterlist offen und unverhohlen gethan, aber die antiquierte Art, mit der die Leipziger Polizei ihres Amtes als staatlich bestellte Hüterin der bürgersittlichen Überlieferungen waltete, zwang ihn, da er mit einem Verehelichungszeugnisse nicht dienen konnte, zu einem verschmitzten und leider kostspieligen Manöver. Er kaufte gegen schweres Geld eine volle Wohnungseinrichtung mittlerer Güte und überließ diese als eine Art Wilden-Hochzeits-Geschenks der Schlangendame seines Herzens. Diese möblierte damit eine kleine Wohnung aus, und an dieser nahm nun Herr Ewald Brock vor den Augen der mißgünstigen Welt und Polizei als möblierter Herr teil. So war den sittlichen Anforderungen unsres untadeligen Jahrhunderts wieder einmal löblich Genüge geschehen.
Wehe dem, der hierzu frivole Bemerkungen macht! Ich müßte ihn zurechtweisen. Möge er lieber sozial denken und erkennen, wie günstig hier die Moral auf den Möbelhandel gewirkt hat. Zwei kinderreiche Tischlerfamilien hätten vielleicht nicht gewußt, wohin sie ihr Haupt legen sollten, wenn nicht die Sittlichkeit des Staates Herrn Ewald Brock gezwungen hätte, drei Zimmer und eine Küche einzurichten.
Das Geld für diese soziale und moralische That kam übrigens erst auf Umwegen aus Herrn Brocks Tasche. Er war genötigt, es sich auf dem Wege des Kredits zu verschaffen.
Eine Preisfrage an Leser und Leserin: Von wem pumpte sich Herr Ewald Brock das Geld?
Wie meinen? Von einem Wucherer?
Das war gewiß eine Dame, die so riet. Nein, meine Gnädige, so dumm sind die Leipziger Wucherer nicht.
Was sagen Sie? Von Stilpe?
Himmlische Gerechtigkeit, kennen Sie Stilpen schlecht! Wahrlich, wahrlich, ich sage Ihnen, Sie fänden eher im Neste einer Nebelkrähe gemünztes Metall als bei diesem braven aber unvermögenden Manne.
Es errät's also keiner? Keine?
Nun denn: Von Fräulein Holunder lieh sich Herr Ewald Brock das Geld.
Ah, wie ich mich an Ihrem Erstaunen weide. Aber verderben Sie mir, bitte, dieses unschuldige Vergnügen nicht mit dem entrüsteten Zurufe: »Das ist unanständig!« Ich müßte Ihnen dann folgende Auseinandersetzung anthun: Nicht wahr, wenn ein armer Jüngling ein reiches Mädchen heiratet, und er kriegt Geld von ihr in die Ehe, das schickt sich? Und: Er ist nicht einmal verpflichtet, es ihr wieder zu geben? Und: Liebe braucht auch nicht immer nachgewiesen zu werden? Ist das nicht so?
Nun gut, meine Herrschaften!: Der ganze Unterschied zwischen diesem legalen und Herrn Brocks illegalem Falle ist bloß der, daß Herr Brock verpflichtet ist, das Geld, sei es mit oder ohne Zinsen, seinerzeit zurückzuerstatten, und daß er das Mädchen wirklich lieb haben muß. Denn: Ein Mädchen mit Geld ohne Liebe legal zu heiraten ist zwar anständig, aber niederträchtig und gemein ist es allerdings, ein Mädchen mit Geld ohne Liebe illegal zu heiraten.
Man sieht: Das Gesetz macht's billiger, als die Ungesetzlichkeit. Daher ist das Gesetz, Gottlob, so beliebt.
Paragraphieren wir aber doch der Sicherheit halber noch einmal den ungesetzlichen Kontrakt zwischen Herrn Ewald Brock und Fräulein Mathilde Holunder:
§ 1.
Die beiden Kontrahenten lieben einander.
§ 2.
Aus diesem Grunde heiraten sie einander, wenn auch nur im Sinne eines Privatabkommens ohne Hinzuziehung des staatlichen Apparates.
§ 3.
Herr Brock begiebt sich zu seiner Frau in das Verhältnis eines Darlehenempfängers.
§ 4.
Herr Brock ist ein miserables Subjekt, wenn er seiner Frau, sobald sie nicht mehr seine Frau ist, die entliehene Summe nicht voll zurückerstattet.
*
Ich denke: Die Situation ist klar.
Anmerkung:Das Buch auf der rechten Wagschale ist das Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich.
9. Kapitel
Unglaublich, wohin überall sie ihren Kopf stecken konnte.
Herr Ewald Brock fühlte sich als inoffizieller Ehemann so wohl, wie sich offizielle Ehemänner nach den übereinstimmenden Aussagen Sachverständiger selten fühlen. Paul, so nannte er seine Frau, wenn niemand, außer etwa Stilpe, zugegen war, entwickelte, so anmaßend dies von einer derartigen Person sein mag, alle Tugenden einer deutschen Hausfrau. Man hätte sie eineteutscheHausfrau nennen können, so tüchtig war sie. Sie hielt die Wirtschaft zusammen und kochte, als wäre sie nie eine Schlangendame, geschweige denn eine Serpentinecancanöse, gewesen.
Gewesen! Denn, wie es von den Damen der höheren Bühne so schön in den Zeitungen heißt, wenn sie geheiratet haben, auch sie hatte »der Kunst den Rücken gekehrt.« Sie schlangendamte und serpentinecancanierte nur noch in Separatvorstellungen vor ihrem süßen und kunstverständigen Ewald.
Ah, es waren begnadete Stunden reinsten Kunstgenusses, wenn er in der guten Stube auf dem brav breiten Divan lag, das lange Nargileh im Munde, lässig schön nur mit einer blauseidenen türkischen Pumphose und einem allerliebsten, schnürenverbrämten Smoking aus hellbrauner Kamelhaarwolle bekleidet, und sie sprang durch die schwere Portière ihres Schlafzimmers herein, im Trikot von der Farbe blonden Fleisches, oder auch ohne Trikot, bloß blond, und hob an, auf dem weichen Brüsseler Teppich ihre geschmeidigen Künste zu zeigen.
Der Teppich war blaß apfelgrün, anemonenblau und pfirsischblütenrot gemustert. Hände und Füße des kunstreichen Paul versanken linde darin, während Unter- und Oberkörper in den anmutigsten Windungen voll Ausdruck und Kraft rhythmisch auf- und niedergingen in einem sanft roten Lichte, das von einer japanischen Ampel herunterfiel, um die aus roter Seide ein feiner Schleier war. Unglaublich, wohin überall sie ihren Kopf stecken konnte mit den langen, weichen, blonden Haaren. Es sah manchmal ganz buddhistisch aus, feierlich schön verrenkt, andachtheischend. Man hörte nichts, als ihre tiefen Atemzüge, die wie eine heiße Begleitung ihrer Bewegungen waren. Manchmal knackte, wie verstohlen, ein Knöchel. Das gab etwas Ängstliches in diese breite Stille. Und dazu einodeur de femmeim Zimmer, gemischt mit dem süß vollen Geruche des schwer parfümierten türkischen Tabaks, ein Parfüm, das auch wie in Wellen ging, überall hinzog, alles durchtastete, um alles sich hing, so voll geladen mit allerlei drängenden Zuflüsterungen, so schwer und üppig, daß Herr Brock wohl zuweilen tief Atem holen mußte, wie wenn es ihm eine schmerzliche Wollust wäre, stöhnend auch etwas hineinzusagen in dieses warme Wellenspiel von Weib und Duft. Beim Schlußtric wirkte er sogar persönlich mit. Er ließ sich rücklings langsam auf den Teppich nieder und richtete seine entzückten Augen schwärmerisch gen oben, wo Paul mit gespreizten Beinen, lieblich anzusehen, über ihm stand. Dann schloß er wie ein verzückter Fakir seine Augen, indessen Paul langsam, ganz, ganz ängstlich langsam Kopf und Oberkörper hinten über tief zu ihm hinab bog, bis ihre heißen Lippen die seinen berührten. Sie nannten das gar gruselig den Schlangenkuß. Es war aber sehr angenehm. Dann machte Paul einen schwierig schönen Schwung, auf die Hände gestützt, Beine hoch, genau über Herrn Ewalds ängstlich verklärtem Gesicht, und, hopp, war sie hinaus durch die Portière.
Herr Ewald erhob sich mühsam, rollte den Teppich zusammen und stellte ihn in die Ecke. Hinter der Portière aber raschelte Seide, krachten Corsettspangen, pochten Tritte von Hackenschuhen. Dann die Portière auf, und es begann Pauls denkwürdige Glanznummer:Cancan serpentant.
Daß ich ein Tanzmeister oder Frank Wedekind wäre, Ihnen mit allen Finessen der Technik klar zu machen, wie Paul den braven Pariser Schüttelbein- und Schwenkebauchtanz, den unsre Vorfahren Cancan nannten, und den ätherischen Londoner Serpentinetanz in einander schmolz. Es war ihre eigenste Erfindung. Ein bißchen kühn und im Grunde stilwidrig, aber von einer anbetungswürdigen Tollheit.
Unten schwarzseidenes Cancan-Costüm, schwarz bis auf die gestickten Unterhöschen mit vielen, vielen Rüschen, zitternd wie Espenlaub, oben der breitfaltige himmelblauseidene Tanztalar von Miß Loë Fuller, die gepriesen sei in alle Zeiten für das, was sie unsern Augen Gutes gethan hat.
Der leise Armflügeltanz mit den blauen Seidenwellen weht durch die rote Luft, – ach du unschuldiger Schmetterling! Bisch – bisch flattert er rundum, scheu, keusch. Steht im Beben still. Hebt und senkt die Schillerflügel, als warte er. Dreht sich in seiner wellenden Schönheit. Jetzt wächst er über sich hinaus. Jetzt ist er groß wie eine blaue Flügelsonne. Das ist den schwarzen Höschen unten zu viel. Sie knistern vor Ungeduld, dieser englischen Ästhetik cancanierend durch die Parade zu fahren. Sie können's und können's nimmer aushalten. Hup, saust eines der roten Stiefelchen hervor, schmeißt den blauen Talar hoch auf und winkt der japanischen Lampe einen Trällergruß. Doch die Arme lassen nicht ab von englischer Feierlichkeit. Sie runden die Seide zu blauen, drehenden Muscheln, sie predigen seidene Predigten. Aber die französischen Beine lassen sich nicht imponieren. Wie ein Gassenhauer trällert eine Pirouette dazwischen, jup, mitten in das blaue Hallelujah. Und jetzt wird der Kopf angesteckt. Jach wirft er sich nach hinten, daß die blonden Haare wie ein goldener Strahlenkranz aufstehen. Und wie im Taumel wieder nach vorn, daß sie hinunterstrudeln, und nun im Kreise rundum wie Sonnenfackeln, indessen die Beine toll auf- und niedergehen und der Unterleib sich allbereits nach vorwärts wagt. Fort mit dem blauen brittischen Flügelschlag! Die Arme müssen auch mit hinein in den Trubel der cancanischen Beine! Weg den weiten Talar! Paul wirft ihn hinter sich. Und nun im gelben Mieder auf dem schwarzen Hemd, im kurzen schwarzseidenen Röckchen los, furioso, cancanoso, als wollte sie alle Glieder von sich werfen und oben an der Decke tanzen.
»Toller Balg!« weiter wußte Herr Ewald Brock nichts zu sagen, wenn dann Paul, mit Decken sorgsam eingehüllt, auf dem Divan lag und stammelte: »Ah, das thut gut, so mit Kopf, Arm, Bein und Leib zu tanzen!«
10. Kapitel
Mädchen, Mädchen, studiere die Architektonik moderner Gelehrsamkeitstempel!
Herrn Ewald Brocks Beschäftigung war leider um ebensoviel unerfreulicher wie sie unästhetischer als die Pauls war. Daß er ein Tänzer wäre statt eines Medizinbeflissenen! Resigniert blickte er, so weit es ging, an seinem Bauch hinab. Himmlische Güte, was für ein Stück Fleisch wird man mit der Zeit! Das kommt von diesem vielen Sitzen hinter den Büchern.
Es kann nicht verschwiegen werden, daß Herr Ewald Brock zu Beginn seiner Garçon-Ehe die Tendenz zu einer gewissen beschaulichen Passivität hatte. Wozu studieren, wenns einem auch ohne dies so gut geht? Aber in dieser Hinsicht huldigte Paul ganz anderen Ansichten. Sie entwickelte Grundsätze von einer erstaunlichen Neigung fürs akademisch Löbliche. Als ob sie eine Gouvernante wäre, dazu bestellt, Herrn Ewald Brock zum Fleiße anzuhalten, ward sie nicht müde, immer und immer wieder an die Kollegs, an die Kliniken zu erinnern, ja, sie scheute sich gar nicht, selbst von den Stationen des Staatsexamens zu reden. Zwei hatte Herr Brock thatsächlich hinter sich. »Nu, hopla, die andern!« meinte Paul in ihrem weiblichen Eigensinn. »Weißt du, mein Dickes, in zwei Jahren allerspätestens muß die Geschichte geschehen sein. Du siehst, ich drängele nicht, aber länger darfst Du Deinen guten Alten wirklich nicht kränken. Schließlich wird er wild und heimst Dich ein. Na, und dann?«
Verflucht ja, und dann!
»Kind, Du mußt nicht an die Zukunft denken. Es ist, hä, es ist dumm, an die Zukunft zu denken. Man verekelt sich bloß die Gegenwart damit. Hakschebaksche, wie die weisen Greise in der Türkei voll Tiefsinn sagen. Lasset uns tanzen und fröhlich sein, denn es wäre möglich, daß wir morgen die Gicht hätten.«
Aber das Kind machte seine braunen Augen weit auf, so weit wie das Mädchen auf demPear-Soap-Plakat, und sprach:
»Laß Du die türkischen Greise sagen, was sie mögen, Dickes. Wir kriegen die Gicht noch lange nicht. Aber wer in Leipzig faul ist, muß in Halle streben. Daher ist es besser, in Leipzig nicht faul zu sein und an morgen zu denken. ThustDu'snicht, thu'ich's.«
Und, beim Himmel, sie that's recht ausgiebig und ermangelte nicht, auch Herrn Ewald Brock daran zu erinnern. Sie massierte ihn förmlich mit Ermahnungen. Wenn er das Mädchen nicht wirklich lieb gehabt hätte, wär er ihr längst durchgegangen.
So in der Fuchtel war er weiß Gott nicht einmal in Halle gewesen. Zu nachtschlafender Zeit bereits, früh um neune, holte Paul sein müdes Fleisch aus den Federn. Er wehrte sich mannhaft, wurde groß sogar, und die Not erleuchtete seine Phantasie zu kühn erfundenen Ausflüchten: Daß er Influenza habe, daß er nervös werde durch ungebührlich frühes Aufstehen, daß das lange Schlafen erblich sei bei den Brocks . . . Nichts half. Seine Lebensweise wurde umgekrempelt wie ein paar Hosen beim Ausklopfen. Es war keine Möglichkeit mehr, bis um elf zu schlafen, dann auf den Grimmschen Bummel, dann zum Frühschoppen ins Korpsstübchen und abends um sechs Uhr zum Mittagstisch zu gehn, um sich stark und tüchtig zu machen für lehrreiche Nachtwandelungen mit Stilpe. Stilpe war überhaupt abgeschafft.
»Das ist kein Umgang für Dich,« sagte Paul. »Stilpe soll alleine versumpfen, bis er's selber dicke kriegt. Der frißt sich schließlich auch ohne Staatsexamen durch. Ein Klappenwerk wie seins kommt nie aufs Trockene. Paß auf, er wird mal Journalist oder sonst was Gemeinnütziges und verdienst sich ganze Hüte voll Geld. Aber Du, mein Dickes, was willst denn Du machen, wenn Du kein Staatsexamen machst?«
»Paul, Du mußt mich nicht für ein Nilpferd halten; das ist beleidigend.«
»Na, so mach Dein Staatsexamen, daß ich sehe, wie gescheit Du bist!«
»Werd' ich machen, Paul, werd' ich! Verlaß Dich, hä, verlaß Dich darauf. Aber ich bitte Dich: Nicht drängeln! Ich bin das nicht gewöhnt. Es macht mich, hä, nervös macht mich's. Du siehst ja, wie ich in den Kliniken herumstrebe. Seit drei Wochen stirbt hier kein klinischer Fall, den ich nicht Dir zu Liebe studiert hätte!«
»Ja, weil ich Dich hinführe, Dickes. Alleine gingst Du nie!«
Herr Ewald Brock lächelte bei diesen Worten.
»Was giebt's denn da zu feixen, Dickes?«
»Ich lächle Dir Dank, mein unentwegtes Mädchen. Komm, führ Dein Lamm auch heute zur Schlachtbank!«
Dieses Fragment aus einem Frühstückstischgespräch im Brock-Holunderschen Hause möge einen Begriff von den erzieherischen Praktiken geben, mit denen die merkwürdige Schlangendame das schwache Fleisch ihres möblierten Herrn höheren Zielen zuzuführen bestrebt war.
Schon bei der Wahl der Wohnung hatte sie das Studium Herrn Ewalds im Auge gehabt. Ihm wäre es angenehm gewesen, mitten im Weichbilde der Stadt, der Grimmaischen Straße nicht allzufern, am liebsten im Hause der Friedrich Wilhelm Krausischen Weinstube zu wohnen, deren kalte Küche ihm als der Ausbund alles pikant Nahrhaften erschien. Aber Paul bestand auf dem öd unerfreulichen Mediziner-Viertel, wo in aufdringlicher Protzigkeit immer ein Hörsaal neben einer Klinik steht.
»Siehst Du,« sagte sie, »hier hab ich's gerade so nahe zur Markthalle, wie Du zu Deinen Professoren.«
Und richtig, Tag für Tag, wenn sie ihren Marktkorb nahm, mußte er seine Instrumententasche nehmen und sich von ihr, ob sich sein Stolz auch bäumte, zu seinen Instituten führen lassen.
»Was müssen die jungen Semester denken!« mahnte er. »Du sollst kein Ärgernis geben, Paul, steht in der Bibel!«
»Sag ihnen lieber, daß sie mich nicht so jugendlich angrinsen sollen. Es ist wahrhaftig kein Vergnügen, sich von diesen Jünglingen anstarren zu lassen. Sei froh, daß ich Dir das Opfer bringe. Wär's nicht nötig, thät ich's nicht.«
Es war in der That keine Annehmlichkeit für Paul, ihren dicken Knaben zur Schule zu bringen, und sie lief immer sehr schnell ihres Weges, wenn sie ihn glücklich abgeladen hatte.
Eines Tages begegnete sie, wie sie von der Markthalle kam, Stilpen. Der hatte keinen geringen Ärger auf sie, denn er wußte, daß sie es gewesen war, die ihm den grauen Cylinder abspenstig gemacht hatte.
»Mädchen,« sprach er, »Deine Tugenden stinken zum Himmel. Ich erlebe es noch, daß Du Präsidentin des Vereins zur Rettung gefallener Mediziner wirst. Pfui, welch ein niedriger Ehrgeiz! Und das nennst Du Liebe, Woglinde! Ach, wüßtest Du, wie's wohlig ist dem Fischlein in der Flut! Ach, könntest Du sehen, mit was für sorgensauerem Gesichte der gute Ewald jetzt zum Frühschoppen schleicht!«
»Er schleicht mit gar keinem Gesichte zum Frühschoppen, mein Lieber! Ich wollte, Du gingest auch dahin, wohin ich ihn führe.«
Das kann ich nicht, Woglinde, maßen ich nicht die Ehre und das Vergnügen habe, ein I. A. C. B. zu heißen, was auf deutsch ein inaktiver Korpsbursche heißt ich nicht etwa von der Vokalmusik der Esel herzuleiten ist.«
»Red keine Rätsel!«
»Rätsel? Wie, Du bist die Vertraute eines Korpsburschen und weißt nicht, daß nur Korpsstudenten des Eintrittes ins Korpsstübchen gewürdigt werden?«
»Dummes Zeug! Ewald geht nicht mehr ins Korpsstübchen.«
»Oh Du ländliche Unschuld! Oh du armes, schnöde betrogenes Geschöpf! Sie schwebt auf reinen Sohlen durch die Gemüsestände und kauft naiven Herzens Sellerie, indes der gewissenlose Heuchler lichtenhainert, daß die Korpsfüchse vor Bewunderung epileptisch werden!«
»Ist das wahr, Stilpe?«
»So wahr als dies hier ein Selleriekopf ist.«
»Aber wie ist denn das möglich!«
»Mädchen! Mädchen! Studiere die Architektonik moderner Gelehrsamkeitstempel!«
»So red mal deutsch!«
»Wenn aber meine Worte dann Keulen sind, die Dein Vertrauen zu Blei zermalmen?«
Er meinte: Brei.
»Herrgott, die Klappe! Willst Du vernünftig reden oder nicht?«
»Auf Deine Rechnung und Gefahr, unbegreifliche Vestalin! Ich halte Dich nicht, wenn Du in Ohnmacht fällst! Also kurz und infam: Die medizinischen Institute dieser berühmten Stadt erfreuen sich nicht nur einer Eingangspforte, die vorne, sondern auch eines Ausfallsthores, das hinten ist. So sind sie für Herrn Ewald Brock recht wohl geeignet, als Durchgänge zum Thüringer Hof benutzt zu werden.«
»Ich danke Dir, Stilpe. Du bist doch ein guter Kerl. So einen Gefallen kannst Du mir wieder mal thun. Willst Du Sonntag bei uns zu Mittag essen? Es giebt Schöpsenbraten mit Wickelklösen.«
»Ist das Deine Ohnmacht, abgebrühte Schlange? Aber frage nicht, ob ich will! Ah, was muß eine Schlangendame für Wickelklöse machen! Denn der Wickelklos war, wie schon Winkelmann und nach ihm der große Roscher in Wurzen nachgewiesen, bereits zu den Zeiten der olympischen Spiele das Wappentier der Schlangendamen. Aber könntest Du statt Schöpsenbraten nicht ein weniger anzügliches Gericht dazu geben?«
»Du sollst extra Schnepfendreck dazu kriegen, Du Rüpel! Aber ein guter Kerl bist Du doch!«
11. Kapitel
Ich bin doch nicht Dein Alter!
Paul ließ sich gar nichts merken. Sei fragte an jenem Tage der Enthüllung Herrn Ewald Brock, wie er zu Tische kam, harmlos und wie voll Mitgefühl: »Na, wieder was dazugelernt, mein Dickes?«
Und Herr Ewald Brock hatte wirklich die Frechheit, mit der Miene eines auf dem Roste gebratenen Heiligen zu antworten: »Den Kopf wird mir's zersprengen nächstens.«
Und Paul, ganz Mitleid und güteheißes Erbarmen: »Armes, geplagtes Dickes! Zur Belohnung sollst Du auch Stilpen wieder sehn. Ich hab ihn für Sonntag zum Mittag eingeladen. Siehst Du, wenn Du brav bist, giebt's auch immer was Extra's.«
Herr Brock gab ein Gemurmel von sich.
Am nächsten Tage aber, als Paulchen Herrn Ewald vor dem Institut für Geburtshilfe abgeladen hatte, ging sie nicht in die Markthalle, sondern lief, was sie konnte, um den Garten des Institutes herum und stellte sich hinter eine Anschlagsäule, die dem hinteren Ausweg des Gebäudes gegenüber steht. Und es dauerte nicht lange, siehe, da schritt aus dem offenen Portale mit fröhlichen Schritten Herr Ewald Brock. Das Monstrum war so fröhlich, daß es vor sich hin pfiff. Auch schlug er mit seinem Spazierstock eine steile Terz in die Luft. »So ein Aas!« dachte sich Paulchen und trat ihm in den Weg.
Sie sagte weiter nichts als »Na?«, aber es war ein »Na?«, das Herrn Ewald in die Gedärme fuhr.
»Paulchen!« sagte er, »Du hier?«
»Ja, ich hier. Aber Du? Wo bist denn Du?«
»Ich? Ja, weißt Du, hä, ich war bloß mal . . .«