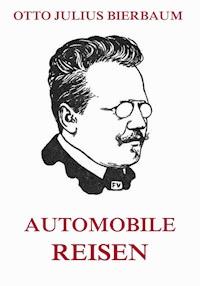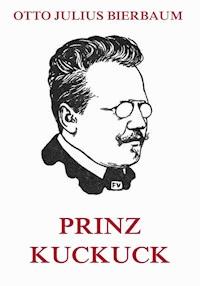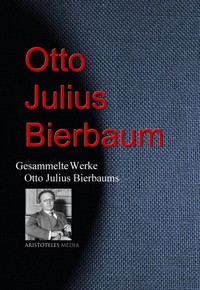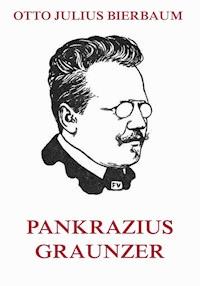
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Buch (im Original) "Die Freiersfahrten Und Freiersmeinungen Des Weiberfeindlichen Herrn Pankrazius Graunzer" trägt stark autobiographische Züge. Der Stoff leitet sich ab von den Erlebnissen des Autors während seiner Liebschaft und späteren Hochzeit mit Auguste Rathgeber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pankrazius Graunzer
Otto Julius Bierbaum
Inhalt:
Otto Julius Bierbaum – Biografie und Bibliografie
Pankrazius Graunzer
I. Kurzer Vorbericht über Herrn Pankrazius Graunzers Leibes- und Seelenzustände, sowie Einiges aus seinem früheren Leben.
II. Ein Brief des Herrn Pankrazius Graunzer an seinen Freund den Gymnasiallehrer Peter Kahle. Handelt von einer verstorbenen Tante.
III. Ein zweiter Brief des Herrn Pankrazius Graunzer an seinen selben Freund Peter Kahle. Handelt von allerlei ländlichen und seelischen Dingen.
IV. Ein Kapitel, das einige Tagebuchblätter enthält, die Herr Pankrazius Graunzer im Februar des Jahres geschrieben hat, in dem diese Geschichte spielt.
V. Eine parlamentarische Standrede des Herrn Pankrazius Graunzer an sich selber. Handelt von einem sehr wichtigen Entschluß und darf durchaus nicht überschlagen werden.
VI. Ein Brief des Herrn Pankrazius Graunzer an seinen Freund den mehrfach genannten Gymnasiallehrer Peter Kahle. Giebt einen Kommentar zu der eben vernommenen Standrede, den ich jungen Mädchen nicht zu lesen rathe.
VII. Ein ganz kurzer Brief des Herrn Pankrazius Graunzer an dieselbe Adresse. Handelt von dem vorigen Brief.
VIII. Aus einem Briefe des Amtsgerichtsrathes Kropfer an seinen Corpsbruder Herrn Peter Kahle. Handelt von Herrn Pankrazius Graunzer.
IX. Ein Brief des Herrn Pankrazius Graunzer an seinen Freund Peter Kahle. Handelt von einer decidiv modernen Dame.
X. Herr Pankrazius Graunzer faßt Reisepläne und berichtet darüber seinem Freunde Peter Kahle.
XI. Einiges aus Herrn Pankrazius Graunzers Reisetagebuche. Handelt von einer Karoline, von einem Schwimmmädchen und von Dresden.
XII. Bei Mutter Schützen. Von Pankrazius Graunzer selber aufgezeichnet.
XIII. Ein Brief des Herrn Pankrazius Graunzer an seinen Freund den Gymnasiallehrer Peter Kahle. Handelt, wie der geneigte Leser schon zu errathen die Güte hatte, von Schmidts Mariechen.
XIV. Herr Pankrazius Graunzer fährt von Dresden nach Leipzig, steigt in Wurzen aus und berichtet ausführlich in seinem Reisetagebuche.
XV. Ein Brief des Herrn Pankrazius Graunzer an seinen Freund Peter Kahle. Handelt vom Stammtisch zum Ring in der Westentasche.
XVI. Herr Pankrazius Graunzer macht eine Reise in's Altenburgische, wo er nach dem Prinzip der Zuchtwahlauslese eine mit besonders schätzbaren Vererbungsfaktoren ausgestattete Gattin zu finden hofft. Was ihm dabei widerfahren ist, meldet er seinem Freund, dem Staatsanwalt Dagobert Prellerhahn, in verschiedentlichen Briefen.
XVII. Ein Stück aus Herrn Graunzers Reisetagebuche, wunderlich überschrieben: Pas de deux getanzt von meinen verehrlichen beiden Seelen.
XVIII. Her Pankrazius Graunzer reist nach Nürnberg, badet sich in Deutschthum, lernt eine seelenfeste Wittwe kennen und berichtet über all dies seinem Freunde Peter Kahle in mehreren Briefen.
XIX. Einige Seiten aus Herrn Pankrazius Graunzers Reisetagebuch, aus denen hervorgeht, daß er philosophische und andere Anwandlungen wunderlichsten Charakters hat.
XX. Herr Pankrazius Graunzer trinkt in München Bier, sieht sich Bilder an, fühlt sich wohl und berichtet über all' dies seinem Freunde Posser in Nürnberg.
XXI. Ein Brief des Herrn Pankrazius Graunzer an seinen Freund Peter Kahle. Handelt von idyllischen Plänen.
XXII. Herrn Pankrazius Graunzer parabelt es, und er erzählt seinem Tagebuche eine Hirtengeschichte.
XXIII. Einige Stücke aus Herrn Pankrazius Graunzers Gerschle-Pepi-Buch. Man wird erfahren, was dies für ein Buch ist.
XXIIII. Herr Pankrazius Graunzer sitzt zwischen zwei wiesigen Hügeln am Bach und konfrontirt sich. Ein hochnothpeinliches Kapitel aus dem Gerschle-Pepi-Buch.
XXV. Noch ein Kapitel aus dem Gerschle-Pepi-Buch. Es scheint darnach, daß Herr Pankrazius Graunzer an Phantasmagorien leidet.
XXVI. Ein Brief des Herrn Pankrazius Graunzer an seinen Freund Peter Kahle. Unnöthig, zu sagen, wovon er handelt.
XXVII. Herr Pankrazius Graunzer versucht, hinter sich selber herzugehen und die Aehren zu lesen, die aus dem brevario Brigittae fallen, giebt es aber als unfruchtbar auf und ermannt sich statt dessen zu einem wichtigen Entschlusse.
XXVIII. Ein Bündel Briefe des Herrn Pankrazius Graunzer an seinen Freund Peter Kahle, genannt die Briefe vom Kriegsschauplatze.
XXIX. Einige Briefe des Herrn Pankrazius Graunzer an seinen Freund Peter Kahle, genannt die fröhlichen Briefe Septembris.
XXX. Kurzer Nachbericht über Herrn Pankrazius Graunzers Kindstaufen nebst einigen Bemerkungen über seine Leibes- und Seelenzustände in der Ehe.
Pankrazius Graunzer, O. J. Bierbaum
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849627195
www.jazzybee-verlag.de
Otto Julius Bierbaum – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 28. Juni 1865 zu Grünberg in Schlesien, verstorben am 1. Februar 1910 in Dresden. Studierte in Zürich, Leipzig, München und Berlin, widmete sich jedoch bald der literarischen Tätigkeit. Der modernen Kunsttheorie huldigend, übernahm er 1892 in Berlin die Redaktion der »Freien Bühne«, der er den Namen »Neue deutsche Rundschau« gab, gründete hierauf mit Julius Meier-Graefe die Kunstzeitschrift »Pan«, die er bis 1895 leitete, und lebt jetzt als Mitherausgeber der »Insel« in Berlin. Vorübergehend gehörte er der Überbrettlbewegung an. Außer den Monographien »Detlev von Liliencron« (Leipz. 1892), »Fritz von Uhde« (Münch. 1893), »F. Stuck« (das. 1893, Text zu Reproduktionen Stuckscher Werke) und dem Band »Stuck« in Knackfuß' Künstler-Monographien (Bielef. 1899) u. a. veröffentlichte er »Erlebte Gedichte« (Berl. 1892) und einen zweiten Band Lyrik: »Nemt, Frouwe, disen Kranz« (1894); ferner die Novellen: »Studentenbeichten« (1893, 4. Aufl. 1899; 2. Reihe 1897), »Die Schlangendame« (2. Aufl. 1897), »Kaktus und andre Künstlergeschichten« (3. Aufl. 1898); die Romane: »Die Freiersfahrten und Freiersmeinungen des weiberfeindlichen Herrn Pankrazius Graunzer« (1896 u. ö.), »Stilpe« (2. Aufl. 1897), »Das schöne Mädchen von Pao« (1899); gesammelte Essays, Gedichte, Sprüche, u. d. T.: »Der bunte Vogel von 1897, ein Kalenderbuch« (1896) und »von 1899« (1898); Dramatisches: »Lobetanz, ein Singspiel« (1895), »Gugeline, ein Bühnenspiel« (1899), »Pan im Busch«, Tanzspiel (mit Musik von F. Mottl, 1900), sämtlich in Berlin erschienen, und »Irrgarten der Liebe«, Lieder, Gedichte und Sprüche aus den Jahren 1885–1900 (Leipz. 1901). Auch gab B. den »Modernen Musenalmanach« (Münch. 1891, 1893, 1894) und »Deutsche Chansons (Brettl-Lieder)« (Berl. 1901) heraus.
Pankrazius Graunzer
I. Kurzer Vorbericht über Herrn Pankrazius Graunzers Leibes- und Seelenzustände, sowie Einiges aus seinem früheren Leben.
Da in dieser Geschichte der Mann, um den sie sich dreht (ich möchte nicht gerne sagen: der Held), zumeist selber das Wort hat, wird es gut sein, wenn ich, bevor wir seinen Meinungen lauschen, Einiges über ihn verlauten lasse, denn ich glaube kaum, daß er sich selber in aller Form vorstellen wird.
Ob Sie freilich ein klares Bild erhalten werden, wenn ich in seinem Signalement feststelle, daß er blond, blauäugig und etwas kurzbeinig, dazu spitzbäuchig und mit einem sehr mäßigen Schnurrbarte behaftet ist? Diese Gaben hat er mit sehr vielen Geschlechts- und Zeitgenossen gemein. Aber Einiges in seinem Leib- und Seelenwesen ist doch mehr absonderlicher Natur, und es verhilft vielleicht zu einer ungefähren Vorstellung, wenn ich dies Einige aufführe.
Was zuerst an ihm auffällt, ist seine etwas wunderliche Nase.
Von vorn, nun ja, von vorn ist sie einfach kartoffelig, die übliche Mischnase wendo-germanischen Typs, aber ihre Merkwürdigkeit beginnt, wenn Sie die Güte habe wollen, sich Herrn Pankratius von der Seite anzusehen. Stellen Sie sich zu seiner Rechten, und Sie haben ein kurzes, gedrungenes Nasenbild mit abwärts gebogener Richtung vor sich, ein Nasenbild, das auf männliche Energie, Kurzangebundenheit, Bestimmtheit, ja, ich möchte fast sagen, Störrischkeit schließen läßt, – Alles in Allem ein Nasenbild, das sich unter Brüdern sehen lassen kann. Nun treten Sie aber, bitte, 'mal links von ihm. »Himmel! Ist das dieselbe Nase?« werden Sie voll Verwunderung rufen, und Sie haben ein Recht, zu erstaunen. Denn das linke Nasenbild ist so sehr das ausgeprägte Gegentheil des rechten, wie in einem Parlamente die linke Seite der Gegenpart der rechten ist. Sie werden nicht zögern, zu erklären, daß diese Nase direkt länger ist als jene, daß ihre Richtungstendenz entschieden aufwärts geht, daß sie etwas Stuppsiges, etwas Trällerndes hat, möcht' ich sagen, und daß sie auf einen weichmüthigen Besitzer schließen läßt, der ganz und gar nicht mürrisch, absolut nicht kurzangebunden und keineswegs sehr bestimmten oder gar störrischen Charakters ist. Diese linke Nase deutet vielmehr auf eine passive, nachgiebige, wohllebige, friedliche, etwas schwankende Seele hin, man könnte sie einem Melancholiker oder einem Humoristen zusprechen, und man kann sich in Ansehung ihrer des gräulichen Verdachtes nicht entschlagen: Der Mann reimt!
Ich halte mich nicht ohne Grund bei Herrn Pankratiussens beiden Nasen auf. Ich will nichts weiter sagen... aber das scheint mir gewiß: bedeutungslos ist diese Doppelnasigkeit nicht! Ich würde es unerhört von der Natur finden, wenn sie solche Merkwürdigkeiten ganz bedeutungslos inszenierte.
Eine weitere äußerliche Eigenthümlichkeit an Herrn Graunzer, die aber nur denen auffällt, die ihn öfter zu sehen Gelegenheit haben, liegt in seinen Augen.
Sie sind blau. Nun ja. Gut. Das ist nicht merkwürdig. Aber merkwürdig ist, daß sie von einem wechselnden Blau sind. Zuweilen sind sie ganz leer blau, heller als Vergißmeinnicht, ich möchte sagen verschossen blau, so, wie unecht blaugefärbtes Kattunzeug nach der sechsten Wäsche und Bleiche aussieht; aber ein ander Mal strahlen sie, der Kuckuck weiß, aus was für Tiefen und Gründen, ganz dunkelblau, so, wie die Maler die Grotte von Capri malen und wie der Himmel im Süden an seinen schönsten Tagen aussieht; und ein ander Mal wieder haben sie gar einen schwarzen Unterglanz, so was ganz Inneräugiges, wofür ich mich vergeblich bemühen würde, einen Vergleich zu finden.
Auch dies mit der Farbe von Pankratiussens Augen ist nicht ohne! Ich will ausdrücklich darauf hingewiesen haben. Man soll mir nichts vorwerfen!
Von seiner Stirne ist zu sagen, daß sie stark gewölbt und recht hoch ist. Er hat die Gewohnheit, mit der Hand darüber hinzufahren und dabei zu seufzen oder aber auch zu stöhnen. Je nach Laune.
Die Hände selbst deuten auf keineswegs adlige Herkunft. Sie sind breit, aber nicht fett. Ich, der ich meinen Pankratius sehr gut kenne, brauche nur seine Hände anzusehen, und ich weiß schon, wie's in seiner Seele aussieht. Pankratius bekommt nämlich sogleich faltige und bleiche Krankenhände, wenn sein Gemüth auch nur ein wenig aus der Harmonie gekommen ist.
Also nicht einmal charaktervolle Hände hat er! Man wird seine Schlüsse daraus ziehen.
Pankratiussens Mund dürfte eher ein Maul geheißen werden, wenn es erlaubt wäre, den Sprachschatz der Deutschen gebührend auszunutzen. Da aber, wie billig, die gute Sitte derlei Maßlosigkeiten verbietet, muß ich mich damit behelfen, zu sagen, daß dieser Mund die ästhetischen Maße überschreitet und jenen Gesetzen des goldenen Schnittes Hohn spricht, die ein gewisses Maßverhältniß der menschlichen Körpertheile untereinander bedingen. Selbst, wenn Pankratius »Böhnchen« sagen würde (was aber bei seiner Abneigung gegen Diminutive durchaus unwahrscheinlich ist), so würde dieser Mund noch immer unbillig viel Gesichtsraum einnehmen.
Hätte nun die Vorsehung wenigstens dafür gesorgt, daß das Pankrazische Lippengeschwister von einem ausreichend großen Schnurrbart verdeckt würde! Aber just dieser Schnurrbart, in seiner dürftigen Oede und Kümmerlichkeit, giebt der extravagant langen Lippenlinie noch eine gewisse Betonung. Jedes dieser wenigen starren, blonden Härchen ist ein Ausrufezeichen: Seht, welche ein Maul! (Nichts für ungut! Das »Maul« geht auf meine Rechnung.)
Auch auf dem Haupte ist Pankratiussens Haarwuchs unvollkommen und von jedem Ueberschwang weit entfernt.
Zwar hat er, für einen akademisch gebildeten Deutschen ein merkwürdiger Fall, trotz seiner vierzig Jahre noch keine Glatze, aber die Haare selbst stehen ganz ungemein weit auseinander, fast als ob sie sich gegenseitig nicht trauten, und da sie obendrein sehr dünn sind, macht das Ganze den Eindruck eines sehr windigen Ackers.
Pankratius selber pflegt darüber folgendes Gleichniß zu erzählen, das ich im Interesse der heute so hoch gehaltenen Psychologie mit besonderer Andacht anzuhören bitte: Als der Genius meines Ichs, ein ätherisches Wesen, bitte ich zu bemerken, geboren aus Leichtsinn und Aengstlichkeit, über mein kindliches Haupt schritt und die Haare säete, siehe, da warf er die Körner bald in so leichtfertigem Schwunge, daß sie über den Kopf und die Wiege weg fielen, um als Sonnenstäubchen zum Fenster hinauszuspielen, bald zielte er in pedantischer Angst mit jedem Körnchen auf die einzelnen Poren. Wo er traf, blieben sie bumsfest sitzen, aber den Haaren die daraus wuchsen, sieht man es nun leider an, daß ihre Körner nicht gesäet, sondern gezielt worden sind. Denn darum eben sind sie gar so dünn und hat jedes mehr individuellen Ausdruck, als gut ist. Die Körner aber, die daneben fielen, – du lieber Gott! ich weiß nicht, was für Vögel sie gefressen, was für Winde sie genommen haben. Indeß der brave Genius zielte, flog auf und davon in die Welt, und wenn ich einen lockenschwingenden Dichter oder Friseur sehe, greift es mir heiß ans Herz: ob er nicht von Deinem fortgeflogenen was abbekommen hat?
Ich habe den sehr verehrten Leser zu besonderer Aufmerksamkeit auf dies Pankrazische Gleichniß ermahnt, und ich hoffe, daß ich nicht umsonst den Finger erhoben habe. Gleichnisse kann man nie tragisch genug nehmen.
Ob man sich nun einen ungefähren Eindruck davon wird machen können, wie Pankraziussens Kopf aussieht, – der Himmel mag's wissen. Ich füge nur noch hinzu, daß seine Gesichtsfarbe keineswegs an Rembrandt, dagegen lebhaft an Rubens erinnert, so posaunen-engelisch munter sieht sie aus, – sehr zu seinem Aerger, da er nie wohler zu sein scheint, als wenn er über Krankheit klagt. Man wird nicht gerne von seinen eigenen Backen dementirt.
Aus Herrn Graunzers Lebensgang bis zu seinem vierzigsten Jahre ist nicht viel zu erzählen. Er hat den Eindruck des Elternhauses so gut wie entbehrt und ist in einem Institute erzogen worden. Dann das übliche Gymnasium, die übliche Universität, die übliche Periode der Anwartschaft auf eine Stellung, dann das wohleingehegte Einerlei dieser Stellung selbst, – das ist seine Vergangenheit, von der er übrigens vielleicht selber zuweilen sprechen wird.
Hören wir nun, was er sagt! Hören wir ruhig, und, ich möchte es vorschlagen, wohlwollend zu. Ich meine: wir wollen nicht gleich auffahren, wenn der Mann dieser Geschichte einmal anderer Ansicht sein sollte, als wir. Gönnen wir ihm seinen Kopf, auch wenn er eckig ist. Der unsere verliert dadurch nichts an anmuthiger Rundung.
Und noch eins: Machen Sie sich auf keinen Roman gefaßt. Ich habe es schon angedeutet: Dieser Pankratius ist kein Held. Weder ein altmodischer in Kanonenstiefeln mit Säbel und Pistole, noch ein neumodischer in Lackstiefeln, mit dem Seziermesser und nach Wundt's Psychologie. Er ist auch kein interessanter Schwerenöther, und es widerfährt ihm nichts, was ein Anrecht darauf hätte, unter »Vermischtes« in die Zeitung eingerückt zu werden. Wenn ich es recht bedenke, ist er eigentlich ein ziemlich gewöhnlicher Bursche.
Um Gottes Willen: laufen Sie nur nicht gleich davon! Bedenken Sie dies: er mag die Weiber nicht. Dieser eine Punkt erhebt ihn über den Durchschnitt seines Geschlechtes. Sehen wir zu: wohin.
II. Ein Brief des Herrn Pankrazius Graunzer an seinen Freund den Gymnasiallehrer Peter Kahle. Handelt von einer verstorbenen Tante.
Kiebitzhof, am 10. Januar.
Mein alter Peter!
Das alte Frauenzimmerchen ist nicht mehr... Nebenan liegt sie, in der blauen Stube, Du weißt schon: wo all' das kleine Krimskramszeug aus Porzellan herumsteht, und ist ganz still und todt. Sie hat ihr schwarzseidenes Brautkleid an mit den langen Hängeärmeln und der großen, steifen Krause; um den Hals hat sie die große goldene Erbsenkette; und das alte dicke Gesangbuch mit dem quittengelben Schnitt hat sie in der Hand. Sie sieht wunderschön friedlich aus, ganz untantisch; nur ihre weißen Schläfenlöckchen haben mir etwas Unheimliches, denn ich besinne mich nicht, sie je in so ruhiger Lage gesehen zu haben. Weißt Du noch, wie sie immer zitterten, wenn das gute Ungethümchen zornwetterte?
Es ist mir eigentlich unfaßbar, daß sie nun auf einmal todt sein soll. Käme sie jetzt plötzlich herein und riefe mich an: »Na, Graunzer, was für Narrheiten spuken anjetzt in Deiner schönen Mannesseele?«, ich fände das viel natürlicher, wie daß ich denken soll, sie liegt da, starr und steif und kalt im Bett und wird nimmer aufstehen.
Ja, kannst Du Dir das vorstellen? Es ist geradezu, was soll ich gleich sagen, ja: stilwidrig. Der Tod paßt nicht zu ihr. Ich begreife es nicht.
Noch zu Weihnachten schrieb sie mir nach Berlin: »Graunzer, ich schicke Dir hier ein Dutzend wollene Socken, einen anständigen Schlafrock, einen Fußsack für unter den Schreibtisch, fünf richtige Pfefferkuchen, hausbackene, und das, was in der Schlafrocktasche steckt. Denn da Du immer noch derselbe Narr bist und keine Frau hast, muß Deine alte Tante, die sonst Besseres zu thun hätte, für Dich sorgen. Verlebe den heiligen Abend so gut, als es einem alten Junggesellen und Hagestolz möglich ist. Ich beneide Dich nicht um Deine philosophische, verhockte Einsamkeit und wünsche sehr, daß Du bald vernünftig würdest. Aber glauben thu' ich nicht daran. Wo der Wurm sitzt, ist Mehl statt Holz, und wenn sich ein Gelehrter was in den Kopf gesetzt hat, sitzt was im Kopf, wenn's auch manchmal zum Gotterbarm ist. Ich bin gesund und munter und mache eine große Bescherung für die Kinder im Dorf. So ein verwaistes Mütterchen, wie ich, muß sich mit Surrogaten helfen. Wenn sie mir nur nicht wieder die Dielen so zerkratzen wie voriges Jahr.
Deine alte Tante Ulrike.
Der Rotscheckigen mußte es gerade jetzt einfallen zu kalben. Es ist ewig 'was los.«
Wie sie den Brief schrieb, hat sie sicher nicht an's Sterben gedacht.
Ueberhaupt: wie Alles, so hat sie auch das schnell und glatt erledigt. Der alte Hans Jörg erzählte mir, am fünften Januar hätte sie sich plötzlich Nachmittags um drei niedergelegt, dann ist sie am sechsten wieder aufgestanden, war aber sehr blaß, augenränderig und auffällig ruhig, schrieb auch viel. Am siebenten hat sie ihre alten Dienstboten kommen lassen und ihnen die Briefsachen gezeigt, die besorgt werden müßten, wenn sie früh nicht mehr nach der alten Christiane klingele. Auch das Telegramm an mich: »Die gnädige Frau ist gestorben. Hans Jörg in Kibitzhof« war dabei. Wie die Leute gejammert haben, hat sie ihre großen Augen gemacht und sie sofort hinausgeschickt. Aber dann hat sie sie zurückgerufen und jedem die Hand gegeben. Am achten hat sie Vormittags viel herumgekramt und schließlich die Sterbegarderobe neben das Bett auf die alte Brauttruhe gelegt. Am neunten hat sie der alten Christiane nicht mehr geklingelt.
Ich kann Dir nicht schildern, was ich empfand, wie ich das Telegramm erhielt. Sonderbarerweise mußte ich laut Hm! sagen und das linke Auge zukneifen, wie wenn ich recht objektiv und bedächtig über eine zweifelhafte Sache nachdenken wollte. Und immer wieder kam mir das Wort herauf: Merkwürdig! Merkwürdig! Merkwürdig!
Und dann, mit einem Male, war es wie ein warmer Anhauch, und das liebe alte Frauenzimmerchen erschien fast sichtbar vor mir, und ich wurde, ich weiß nicht wie ich sagen soll, ich wurde jämmerlich gerührt und schluchzte beinahe. Mir war, als würde etwas Leeres noch leerer, etwas Kaltes, Hartes noch kälter, noch härter, und auf einmal kam mir das Wort Mutter in den Sinn.
Ach Gott ja, das gute Tantchen war ja meine Mutter gewesen... Ja freilich... ja freilich... Mutter!...
Dann bin ich also hingefahren. Bis Rosenau, Du weißt, mit der großen Bahn, dann auf der Sekundärbahn nach Kitzberge und schließlich in Tantchens uraltem Landauer (dem Sichelwagen des Königs Darius, wie wir ihn nannten) hin zum Kibitzhof.
Die Fahrt ging langsam, denn es war Nacht und stockfinster; und der alte Hans Jörg erzählte und erzählte unaufhörlich und traurig und mit sehr langen und niemals völlig zu Ende geführten Sätzen.
Meinst Du nun, daß ich von dem, was er sagte berührt worden wäre? Nicht im Geringsten! Ich lauerte nur immer, wenn er aus der Konstruktion fallen, wenn er wieder einen neuen Wortpfahl einrammen würde, um eine neue Satzleine daran zu binden, und wenn er sich ganz verfitzt hatte und hilflos abschnappend mit der Peitsche knallte, hatte ich das Gefühl einer wunderlichen Genugthuung, Triumph beinahe. Es fehlt nicht viel, und ich hätte »Siehste wohl!« gerufen.
Das Bild dann bei der Ankunft auf dem Kibitzhof, – ja, wer das malen könnte! Das große schwarze Haus in dem weiten, schwarzen Garten, in dem es rauschte und raunte; die dicken gelben Lichtscheine, erst unbeweglich, dann wandernd, und hinter ihnen die frostrothen Gesichter und das Hin und Her in den Gängen, Alles beflissen leise, wie wenn ein »Pst!« in der Luft drohte...
Und dann: Dieser sonderbare Geruch des Landhauses im Winter... Etwas anheimelndes, halb frisches, halb ein bischen stockiges.
Und ich wußte nun, wenn ich die Treppe hinaufgehe und links die erste Thüre aufmache – da liegt sie. Das Zimmer wird kalt sein, und ich werde mir die Hände am Lichte der gelben Wachskerze erwärmen müssen, und ich werde nicht im Stande sein, sie anzusehen... Ob mir die Thränen kommen werden? Oder – um Gotteswillen, wenn ich plötzlich lachen müßte? Verzerrt lachen, wie es mir manchmal gerade in den ernsthaftesten, schrecklichsten Augenblicken zustieß!... Was müßte Christiane von mir denken!
Ich ging wirklich in Angst hinauf, und ich zitterte.
Aber es war so wie meist im Leben: der Eindruck des Wirklichen hatte gar nichts gemein mit der Vorstellung vorher. Wie ich sie so still und, ja, wirklich so schön daliegen sah, die wundergute, wundersame Alte, da wurde mir ganz heimlich und warm zu Muthe, und mir kamen Thränen einer gehobenen, mehr freudigen als schmerzlichen Rührung, und ich nahm ihre schmale rechte Hand und küßte sie, und mir war wie Einem, der etwas Seltenes, Schönes erleben durfte.
Ich ging in's Bett und schlief gut.
Heut früh, wie ich aufwachte, hatte ich schier vergessen, weshalb ich diesmal in Kiebitzhof bin. Ich streckte mich im Bett mit dem Wohlgefühl »fern von Berlin« und dachte an die gute Butter, die nun zum Kaffeebrote kommen würde. Da, auf einmal, gab mir's einen Ruck inwendig, und ich erlebte jetzt erst den Schreck über Tante Ulrikens Tod.
Herrgott, Herrgott: die Tante ist todt! Die Tante! Ich hab sie ja drüben in der blauen Stube liegen seh'n! Wie kann man so was vergessen! Wo bin ich denn eigentlich gewesen mit meinem Kopf!? So was müßte sich doch einbohren wie mit eiskalten, frostbrennenden Stacheln!
Dieses verfluchte Herumstochern im eigenen Gehirn! Dadurch unterscheiden wir uns von den früheren Menschen. Nur in fauligen Zähnen stochert man.
Hol' mich doch der Kuckuck! Was quatsch ich da! Ich will doch bei Gott keine »witzigen« Bemerkungen machen. Oder doch?
Peter! Es ist zum Ausderhautfahren! So geht mir's heute wieder 'mal den ganzen Tag. Ich komm' mit meinen Gedanken nicht zurecht. Sie springen wie die jungen Pferde und schmeißen die Beine. Der Teufel weiß, aus was für einem vertrackten Gestüt sie sind.
— — —
Bis hierher hatt' ich heute Nachmittag geschrieben. Eine eigenthümliche Unruhe ritt mich, und ich wäre unter meiner verfluchten Reiterin sicher durchgegangen, wenn nicht der Pastor gekommen wäre.
Da sieht man, wozu Pastöre gut sind.
Aber es war ein unangenehmes Colloquium, das ich mit ihm hatte.
Dieser wunderbare Bäffchenträger hatte nämlich die Güte, mir einige Zweifel darüber zu äußern, ob Tante Ulrike so ohne Weiteres in den Himmel eingehen werde. Sie sei doch eigentlich eine etwas störrische Seele gewesen, meinte er, und ihr Hochmuth hätte sich einen eigenen Heiland gebildet statt des, ich hätte beinahe gesagt, staatlich approbirten.
Der Bäffchenträger:Es hat meinem seelsorgerischen Herzen zu öfteren Malen wehe, sehr, sehr wehe gethan, wenn ich hören mußte, was die nun Verblichene im irren Wandel zu Gott (denn sie wollte zu Gott) für Worte sprach, Worte... oh!
Ich:Was für Worte, Herr Pastor?
Der Bäffchenträger:Blasphemische Worte!
Ich:Sapperlot, Herr Pastor!
Der Bäffchenträger:Ja, Herr Doktor, blas–phe–mische Worte.
Ich:Nehmen Sie Sahne in den Thee, Herr Pastor?
Der Bäffchenträger:Wenn Sie Arak hätten? Oder auch Rum. So. Ja. Nur ein Bischen! So! Ja, die Verblichene war ein zu irrendes Schaf.
Ich:Wir sind allzumal Sünder, Herr Pastor, und ermangeln des Ruhms, den wir haben sollen.
Der Bäffchenträger:Gott weiß es. Oh!
Und so ging die Rede hin und her, her und hin, mit Achs und Ohs und Gestöhn und Geseufz und einem gewissen butterig ranzigen Tonfall seinerseits, und der Mann Gottes nahm sichtbarlich zu an Mißvergnügtheit und Unbehagen, daß man hätte meinen mögen, Tante Ulrike sei eine ganz gottlose und teufelbesessene Person gewesen. Die gute Tante mit ihrem schönen, starken, stillen, herzhaften Glauben, der so köstliche Ausdrücke fand, daß ein kluger Pfarrer seine Predigten damit geschmückt hätte!
Ich will Dir ein paar Stellen aus ihrem Testamente an mich hierher setzen. Hätte ich sie dem Pastor vorgelesen, er hätte die Schöße seines langen Bratenrockes hochgehoben und wäre davon gerannt wie weiland die Schriftgelehrten vor denen, die in fremden Zungen redeten.
Denn die reine, starke, herzgründige Menschennatur ihres Wesens, das an sich selber gebaut hatte sechzig Jahre lang, spricht daraus.
»Lieber Graunzer, ich weiß, Du bist ein hartgesottener Heide. Du trägst den Namen eines Christen nur wie ein Kleid, das Du gerne ablegen würdest, wenn Du nicht das Aufsehen fürchtetest, das entstehen würde, wenn so ein kleiner dicker Doktor der Philosophie plötzlich nackt spazieren ginge. Viel Courage bedeutet das nicht. Ich bin bloß eine Frau, nach Deiner Ueberzeugung also ein sehr minderwerthiges Wesen, um das Du einen sehr großen Bogen machen würdest, wenn ich nicht die Schwester Deiner guten Mutter wäre, aber Du kannst Dich drauf verlassen: wenn ich nicht an unsern Heiland Jesus Christus glaubte, ganz richtig und ehrlich glaubte, weil ich gar nicht anders kann, weil ich gar nicht ich wäre, wenn ich nicht diesen Glauben in mir hätte, – dann würd' ich hingehen und vor allen Leuten sagen: seht, es thut mir leid, aber ich muß den Namen, daß ich eine Christin wäre, abthun, denn ich bin keine. So thät' ich, und ich käme mir wahrhaftig wie eine Diebin vor, wenn ich nicht so thäte.
Nun gut: Du hältst das nicht für nöthig. Du bist ein Doktor der Philosophie und ein Mann, und in diesen beiden Eigenschaften fühlst Du Dich berechtigt, fremde Kleider zu tragen, wenn Du sie auch mit allerlei nicht dazu passendem Zeug aus ich weiß nicht woher behängst und bebaumelst. Ich muß Dir nur einmal den Standpunkt auch darüber klar machen, und deshalb schreib' ich das.
Wenn Du dies liest, bin ich dort, wo ich mein Lebtag gewußt habe, daß ich sein würde, wenn es auf Erden für mich vorbei sein wird. Ob ich dort eine gute Figur machen werde, das weiß ich freilich nicht, aber ich weiß, daß es mir gut gehen wird, denn ich habe genug christliches Leid gehabt hier und meine christlichen Freuden habe ich nicht mit den Schmerzen Anderer erkauft. Der Herr Pastor meint, die christliche Demuth gebiete, anders zu reden, und wer ein Christ sein wolle, müsse sich einen Sünder heißen. Aber ich bringe das nicht fertig, denn ich kann mich nicht eigentlich besinnen, gesündigt zu haben, es sei denn, daß man Dummheiten begehen sündigen nennen muß.
Ich habe allezeit darnach getrachtet, in meinem Umkreise das zu wecken, was ich einfältige Person (das sag' ich ohne Demuth, bloß weil's wirklich so ist) Gottseligkeit nenne. Gottseligkeit aber nenne ich, wenn eins mit sich selber in Frieden lebt. Das kann aber nur sein, wenn man in seinem Abendgebete zu Gott also sprechen kann: ich habe Dich, Vater, nicht beleidigt heute den ganzen Tag, denn ich habe Niemand wissentlich wehe gethan, und that ich's unwissentlich, hab ich's gut zu machen versucht; und ich habe versucht, Dich in mir deutlicher zu fühlen, und das Häßliche und Niedrige, das du mir, ich weiß nicht warum, mit aufgeladen hast, hab' ich getrachtet, wegzuwerfen oder sein nicht zu achten, und ich danke Dir von Herzen, daß es in mir deshalb christlich hell und heiter geworden ist und daß ich gerne in Dir gelebt habe. Hallelujah!
Ich weiß nicht, Graunzer, ob Du auch so beten kannst, aber wenn Du es kannst, oder wenn Du wenigstens so zu fühlen vermagst, dann kommt es mir auf den Titel nicht an, den Dir Deine Philosophie beilegt, und ich glaube, daß auch Du nicht gottlos bist. Nur das Dumpfe, Blöde, was an sich selber frißt und in sich selber versinkt, statt aus sich heraus zu strömen in Licht und Klarheit, nur das ist eigentlich gottlos. Aber man soll es nicht aufgeben, wie einen unheilbaren Kranken, sondern wecken, klären soll man es. Aber nicht durch Anschreien oder gar Rütteln und Stoßen, sondern durch freundlichen Zuspruch und mit leiser Hand.«
Wenn ich diese Worte lese, lieber Peter, muß ich wirklich sagen: daß gerade ich, der Neffe einer solchen Tante, einen Piek auf das Weibliche habe, ist eigentlich unerhört. Und hätt' ich nicht so meine eigenen Gedanken, ich müßte mir fast monströs vorkommen.
Das liebe Frauenzimmerchen hat natürlich nicht unterlassen, mir auch im Testamente den Text darüber zu lesen, daß ich es vorziehe, einschirrig durch dieses Leben zu ziehen, statt als Appendix irgend einer Dame, die meinen Namen trägt und unter der Vorgabe, mich zu lieben und meinem Stamme zur Fortpflanzung zu verhelfen, mich unausgesetzt verführen würde, das Einzige aufzugeben, was Werth hat: Die männliche Selbständigkeit. Daß ich den Spaltungsprozeß, den die Menschen Ehe nennen, nicht durchmachen will, behagte ihr gar nicht, die darin ganz Weib, will sagen: ganz Herdenselbstsucht war, wie jede andere.
Deshalb heißt es in ihrem Testament wie folgt:
»Eigentlich ist es sündhaft, daß ich Dir unsern alten Kiebitzhof vermache, auf dem, bei Gott, so alt er ist, noch kein Junggeselle gesessen hat. Ich will Dir auch ganz offen gestehen, daß ich eine Zeitlang so kalkulirt habe: ich werde den Graunzer einfach zur Vernunft, d. h.« (o weibliche Synonymik!) »zum Heirathen zwingen; ich werde ihm einfach in's Testament setzen: entweder eine Frau her oder draußen geblieben, in Berlin geblieben; ein spintisirender Weiberfeind kann meinetwegen in seiner städtischen Studirstube saure Glossen aus seiner unglückseligen Gemüthsverfassung herausdestilliren, aber in meinen Kiebitzhof kommt er mir nicht u. s. w., u. s. w. Aber schließlich hab' ich mir doch gesagt: nein, so machst Du's nicht! Das wäre unanständig, und Graunzer soll wieder einmal Unrecht haben mit seiner Lieblingslüge vom weiblichen Kaupel- und Kuppelgeschlecht. Nehm' er den Kiebitzhof, ohne Verpflichtung, unbeweibt in all seiner blühenden Narrheit. Und meinen Segen dazu. Denn er wird den brauchen, der wunderbare Doktor und Gutsherr ohne Frau...
Um Gotteswillen, Graunzer, – was wirst Du für eine Wirthschaft loslassen, Du Oekonom mit dem Federhalter!
Ich bin nicht schadenfroh, – aber den Kiebitzhof möcht' ich wirklich in einem Jahre sehen, wenn Du ihn in einsamer Mannesgröße wirst bewirthschaftet haben. Na! Christiane wird mir Rapport erstatten, wenn sie sich zu Tode geärgert haben wird über »die Zucht«. Hoffentlich ärgert sie Dich auch ein Bischen.
Und wer weiß. Ich habe so meine Gedanken. Vielleicht bläst Dir die frische Luft haußen doch die misogynen Grillen aus dem Kopf, und Du siehst ein, daß es nicht gut ist, daß der Mensch allein sei. Zumal auf dem Lande nicht. Als Wittwe, wie ich, so viele, viele Jahre, – ja, das geht, wenn auch schlimm und in Schmerzen, aber das ist Fügung, über die wir nicht wegkommen. Aber »aus Prinzip«, – nein, Graunzer, das geht eigentlich wirklich nicht. Zumal Du auch das bedenken mußt: Wer soll denn nach Dir kiebitzen? Graunzer! Wenn Du es über Dich gewinnst, ohne Noth, bloß aus Doktorscher Grundsatzerei und Verschrobenheit, den Kiebitzhof einmal Fremden zu überlassen... aber nein: ich habe mir vorgenommen, keinen Zwang auf Dich auszuüben. Mach's wie Du willst. Aber die Versicherung geb' ich Dir: Staat wirst Du nicht machen als Hagestolz auf dem Kiebitzhofe.«
Wie nannten wir doch die Reden unsres guten Tantchens, Peter? Tantationes, nicht wahr? Diese Tantatio ultima ist eine der schönsten, find' ich, aber überzeugen kann sie mich nicht, so überschlau sie auch angelegt ist.
Wie sie mich bei allen Zipfeln meiner Seele hernimmt! Wie sie für jeden Winkel, wo eine männliche Dummheit liegen könnte, einen eigenen weiblichen Besen hat!
Tante! Tante! Mich überschläust Du nicht! Ich berufe mich auf Dich selber und auf Dein Wort von der Gottseligkeit, »wenn eins mit sich selber in Frieden lebt«. Das kann ich bloß solo, und der Gedanke an eine Frau bedeutet für mich soviel wie Spektakel, Gezappel, heilloses Hin- und Hergezerre und zänkische Unlogik, kurz Alles, nur nicht Frieden und Sammlung. Wenn ich mir eine Frau, oder reden wir einmal wie die gebildeten Zeitgenossen: eine »Frau Gemahlin« im Hause vorstelle, so habe ich die über alle Maßen unangenehme Geruchshalluzination von spitzem, überall sich hineinbohrendem, alles Weiche, Feine, Diskrete entzweischneidendem, hartkantig machendem Essiggeruch.
Dieser Geruch mag in der Küche ab und an nicht zu umgehen sein. Für's Wohnzimmer zieh' ich mir aber reine Luft vor.
Damit verbleibe ich Dein
Pankraz.
III. Ein zweiter Brief des Herrn Pankrazius Graunzer an seinen selben Freund Peter Kahle. Handelt von allerlei ländlichen und seelischen Dingen.
Kiebitzhof, Ende Februar.
Bester Peter!
Dies ist der erste Brief, den ich Dir als Gutsbesitzer schreibe. Ich fange nämlich an mich zu fühlen. Donnerwetter noch 'mal: Jetzt bin ich doch was! Ich habe ein Dach über meinem Kopfe, und das ist mein Dach; ich habe Wald und Feld und Wiesen im Umkreis meines Blickes, und das ist mein Land. Sogar der Schnee, der jetzt darauf liegt, bild' ich mir ein, ist mein Schnee, und der graue Himmel darüber her ist mein Himmel, und wenn der Sturm in mein Gebiet fegt, thu' ich sehr pikirt und drohe mit der Gutspolizei.
Es ist ein wunderbares Gefühl, auf Eigenem zu stehen. Das allein ist fester Stand. Und wenn ich in einem Prachtpalast wohne: ich habe doch das Gefühl, nur der Geduldete zu sein. Aber im eigenen Hause, das im eigenen Garten steht, der im eigenen Gelände liegt, – Du, da kriegt man ein Wohlgefühl, ein Freiheitsgefühl, da ist es, als würde Alles stark und stolz ich sicher in uns, und wir spielen innerlich ein Bischen mit Szepter und Krone und Stern, wenn's auch bloß die Mistgabel, der Dungeimer und die Kuhkette ist.
Wem bin ich Vasall? Der Erde, die ich beackere. Wem beuge ich mich? Dem Himmel, bei dem die Herrschaft über mein Land ist. Woran glaube ich? An den Keim, der im Korne ist. Was ist mein Gesetz? Daß ich mich rühren muß. Was ist meine Lust und mein Lohn? Dasselbe!