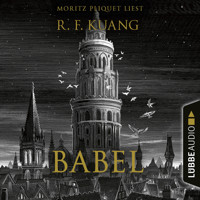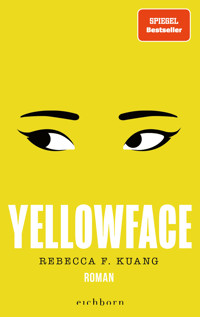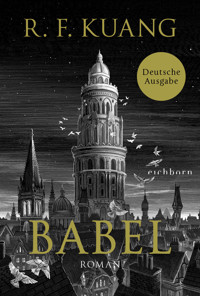
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Das Aufregendste im Fantasygenre seit Harry Potter« Denis Scheck
1828. Robin Swift, den ein Cholera-Ausbruch im chinesischen Kanton als Waisenjungen zurücklässt, wird von dem geheimnisvollen Professor Lovell nach London gebracht. Dort lernt er jahrelang Latein, Altgriechisch und Chinesisch, um sich auf den Tag vorzubereiten, an dem er in das Königliche Institut für Übersetzung der Universität Oxford - auch bekannt als Babel - aufgenommen werden soll.
Oxford ist das Zentrum allen Wissens und Fortschritts in der Welt. Für Robin erfüllt sich ein Traum, an dem Ort zu studieren, der die ganze Macht des britischen Empire verkörpert.
Denn in Babel wird nicht nur Übersetzung gelehrt, sondern auch Magie. Das Silberwerk - die Kunst, die in der Übersetzung verloren gegangene Bedeutung mithilfe von verzauberten Silberbarren zu manifestieren - hat die Briten zu unvergleichlichem Einfluss gebracht. Dank dieser besonderen Magie hat das Empire große Teile der Welt kolonisiert.
Für Robin ist Oxford eine Utopie, die dem Streben nach Wissen gewidmet ist. Doch Wissen gehorcht Macht, und als chinesischer Junge, der in Großbritannien aufgewachsen ist, erkennt Robin, dass es Verrat an seinem Mutterland bedeutet, Babel zu dienen. Im Laufe seines Studiums gerät Robin zwischen Babel und den zwielichtigen Hermes-Bund, eine Organisation, die die imperiale Expansion stoppen will. Als Großbritannien einen ungerechten Krieg mit China um Silber und Opium führt, muss Robin sich für eine Seite entscheiden ...
Aber kann ein Student gegen ein Imperium bestehen?
Der spektakuläre Roman der preisgekrönten Autorin Rebecca F. Kuang über die Magie der Sprache, die Gewalt des Kolonialismus und die Opfer des Widerstands.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1003
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumRassismuswarnungWidmungKarte von OxfordKarte von BabelVorbemerkung der AutorinBUCH IKAPITEL EINSKAPITEL ZWEIKAPITEL DREIKAPITEL VIERBUCH IIKAPITEL FÜNFKAPITEL SECHSKAPITEL SIEBENKAPITEL ACHTKAPITEL NEUNKAPITEL ZEHNKAPITEL ELFKAPITEL ZWÖLFBUCH IIIKAPITEL DREIZEHNKAPITEL VIERZEHNKAPITEL FÜNFZEHNINTERLUDIUM – RamyKAPITEL SECHZEHNKAPITEL SIEBZEHNKAPITEL ACHTZEHNBUCH IVKAPITEL NEUNZEHNKAPITEL ZWANZIGKAPITEL EINUNDZWANZIGKAPITEL ZWEIUNDZWANZIGKAPITEL DREIUNDZWANZIGKAPITEL VIERUNDZWANZIGKAPITEL FÜNFUNDZWANZIGBUCH VINTERLUDIUM – LettyKAPITEL SECHSUNDZWANZIGKAPITEL SIEBENUNDZWANZIGKAPITEL ACHTUNDZWANZIGKAPITEL NEUNUNDZWANZIGKAPITEL DREISSIGKAPITEL EINUNDDREISSIGKAPITEL ZWEIUNDDREISSIGKAPITEL DREIUNDDREISSIGEPILOG – VictoireDANKSAGUNGZitierte Übersetzerinnen und ÜbersetzerÜber dieses Buch
1828. Robin Swift, den ein Cholera-Ausbruch im chinesischen Kanton als Waisenjungen zurücklässt, wird von dem geheimnisvollen Professor Lovell nach London gebracht. Dort lernt er jahrelang Latein, Altgriechisch und Chinesisch, um sich auf den Tag vorzubereiten, an dem er in das Königliche Institut für Übersetzung der Universität Oxford – auch bekannt als Babel – aufgenommen werden soll. Oxford ist das Zentrum allen Wissens und Fortschritts in der Welt. Für Robin erfüllt sich ein Traum, an dem Ort zu studieren, der die ganze Macht des britischen Empire verkörpert. Denn in Babel wird nicht nur Übersetzung gelehrt, sondern auch Magie. Das Silberwerk – die Kunst, die in der Übersetzung verloren gegangene Bedeutung mithilfe von verzauberten Silberbarren zu manifestieren – hat die Briten zu unvergleichlichem Einfluss gebracht. Dank dieser besonderen Magie hat das Empire große Teile der Welt kolonisiert. Für Robin ist Oxford eine Utopie, die dem Streben nach Wissen gewidmet ist. Doch Wissen gehorcht Macht, und als chinesischer Junge, der in Großbritannien aufgewachsen ist, erkennt Robin, dass es Verrat an seinem Mutterland bedeutet, Babel zu dienen. Im Laufe seines Studiums gerät Robin zwischen Babel und den zwielichtigen Hermes-Bund, eine Organisation, die die imperiale Expansion stoppen will. Als Großbritannien einen ungerechten Krieg mit China um Silber und Opium führt, muss Robin sich für eine Seite entscheiden … Aber kann ein Student gegen ein Imperium bestehen? Der spektakuläre Roman der preisgekrönten Autorin Rebecca F. Kuang über die Magie der Sprache, die Gewalt des Kolonialismus und die Opfer des Widerstands.
Über die Autorin
Rebecca F. Kuang ist New York Times-Bestsellerautorin und für den Hugo, Nebula, Locus und World Fantasy Award nominierte Autorin. Sie ist Marshall-Stipendiatin, Übersetzerin und hat einen Philologie-Master in Chinastudien der Universität Cambridge und einen Soziologie-Master in zeitgenössischen Chinastudien der Universität Oxford. Zurzeit promoviert sie in Yale in ostasiatischen Sprachen und Literatur.
R. F. KUANG
B A B E L
ROMAN
Aus dem amerikanischen Englisch vonHeide Franck und Alexandra Jordan
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Babel. Or the Necessity of Violence:
An Arcane History of the Oxford Translators’ Revolution«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2022 by Rebecca Kuang
Published by Arrangement with Rebecca F. Kuang
Dieses Werk wurde vermittelt durch dieLiterarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2023 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Textredaktion: Sabine Biskup, Mainz
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille nach einem Originalentwurfvon Holly Macdonald © HarperCollinsPublishers Ltd 2022
Coverillustration: © Nico Delort
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4838-4
eichborn.de
luebbe.de
lesejury.de
In diesem Roman werden an einigen Stellen rassistische Szenen, Bilder oder rassistische Sprache reproduziert. Dies spiegelt in keiner Weise die persönliche Meinung der Autorin oder die Haltung der Übersetzerinnen oder des Verlages wider und dient dem Zweck der historisch korrekten Darstellung von Alltagsrassismen sowie fehlerhaften Vorstellungen von Ethnizität.
Für Bennett,der alles Licht und Lachen in meine Welt bringt.
Vorbemerkung der Autorinzu ihrer Darstellung des historischen Englands und insbesondere der University of Oxford
Das Problem bei einem Roman mit Schauplatz Oxford liegt darin, dass alle, die die Stadt besucht haben, den Text daraufhin untersuchen, ob die Darstellung der Autorin mit ihrer eigenen Erinnerung übereinstimmt. Es wird noch schlimmer, wenn eine Amerikanerin über Oxford schreibt, denn Amerikaner haben keine Ahnung von gar nichts. Ich möchte mich im Vorfeld verteidigen:
Babel ist ein Werk der Phantastik und spielt deshalb in einer phantastischen Version von Oxford in den 1830er-Jahren, dessen Geschichte durch Silberwerk grundlegend verändert wurde (mehr dazu in Kürze). Ich habe mich dennoch bemüht, den historischen Aufzeichnungen über das Leben im Oxford des frühen viktorianischen Zeitalters so treu wie möglich zu bleiben und mich nur dann von ihnen zu lösen, wenn es der Geschichte zuträglich ist. Als Referenzen über das Oxford des frühen neunzehnten Jahrhunderts habe ich mich unter anderem auf das höchst unterhaltsame The Historical Handbook and Guide to Oxford (1878) von James J. Moore sowie auf The History of the University of Oxford, Bände VI und VII, herausgegeben von M. G. Brock und M. C. Curthoys (je 1997 und 2000) und weitere Lektüren verlassen.
Um die Sprache und das generelle Lebensgefühl abzubilden (zum Beispiel die Alltagssprache von Oxford im 19. Jahrhundert, die sich sehr vom aktuellen Slang unterscheidet)1, habe ich mich an Primärquellen wie A History of the Colleges, Halls and Public Buildings Attached to the University of Oxford, Including the Lives of the Founders (1810) von Alex Chalmers gehalten sowie Recollections of Oxford (1868) von G. V. Cox, Reminiscences: Chiefly of Oriel College and the Oxford Movement (1882) von Thomas Mozley und Reminiscences of Oxford (1908) von W. Tuckwell zu Rate gezogen. Da auch Fiktion uns viel darüber erzählen kann, wie das Leben aussah oder zumindest wahrgenommen wurde, habe ich Details aus Romanen wie The Adventures of Mr. Verdant Green (1875) von Cuthbert M. Bede, Tom Brown at Oxford (1861) von Tomas Hughes und Die Geschichte von Pendennis (1850) von William Makepeace Thackeray eingeflochten. Alles andere entstammt meiner Phantasie und meinen Erinnerungen.
Denjenigen, die Oxford kennen und deshalb aufschreien: »Nein, so sieht es da gar nicht aus!«, möchte ich einige Besonderheiten des Romans erklären. Die Oxford Union wurde erst 1856 gegründet, weshalb sie in diesem Roman United Debating Society (gegründet 1823) genannt wird, denn das war ihr Vorgänger. Mein geliebtes Vaults & Garden Café gibt es erst seit 2003, doch ich habe so viel Zeit dort verbracht (und so viele Scones dort gegessen), dass ich Robin und den anderen dieselbe Freude gönnen wollte. Das Twisted Root existiert so, wie es hier beschrieben wird, nicht, und soweit ich weiß, gibt es in Oxford kein Pub mit diesem Namen. Es gibt auch keinen Schneider an der Winchester Road, aber ich mag die Schneider an der High Street gerne. Das Märtyrermonument existiert wirklich, aber es wurde erst 1843 fertiggestellt, drei Jahre nach den Ereignissen dieses Romans. Ich habe den Bau etwas nach vorn verlegt, damit ich einen schönen Bezugspunkt habe. Die Krönung von Queen Victoria war im Juni 1838, nicht 1839. Die Bahnverbindung von Oxford nach Paddington in London wurde erst 1844 eröffnet, doch hier wurde die Strecke aus zwei Gründen mehrere Jahre nach vorn verlegt: Erstens ergibt es in meiner Alternativweltgeschichte Sinn, und zweitens mussten meine Charaktere etwas schneller nach London kommen.
Beim Gedenkball habe ich mir viel künstlerische Freiheit genommen und ihn eher wie einen modernen Maiball oder Gründerball von Oxford und Cambridge gestaltet als wie eine viktorianische Gesellschaft. Beispielsweise weiß ich wohl, dass Austern im frühen viktorianischen Zeitalter viele Mahlzeiten der Armen ausmachten, doch in meinem Roman sind sie eine Delikatesse, weil das mein erster Eindruck war, als ich 2019 am Maiball am Magdalene College in Cambridge teilnahm – Berge über Berge von Austern auf Eis (ich hatte keine Handtasche dabei und hielt mein Handy, ein Champagnerglas und eine Auster in einer Hand, weshalb ich mein Getränk später einem älteren Herrn über den Anzug kippte).
Für einige ist der genaue Standort des Königlichen Instituts für Übersetzung, auch als Babel bekannt, vielleicht verwirrend. Das liegt daran, dass ich den Aufbau der Stadt verändert habe, um Platz für das Institut zu schaffen. Stellen Sie sich eine Rasenfläche zwischen der Bodleian Library, dem Sheldonian Theatre und der Radcliffe Camera vor. Jetzt machen Sie sie viel größer und setzen Babel mittendrauf.
Wenn Sie weitere Ungereimtheiten finden sollten, rufen Sie sich bitte ins Gedächtnis, dass es sich um eine fiktionale Geschichte handelt.
BUCH I
KAPITEL EINS
Que siempre la lengua fue compañera del imperio; y de tal manera lo siguió, que junta mente començaron, crecieron y florecieron, y después junta fue la caida de entrambos.
Immer war die Sprache Begleiterin des Imperiums und folgte ihm so, dass sie zusammen begannen, wuchsen und zur Blüte kamen und dann gemeinsam verfielen.
ANTONIO DE NEBRIJAGramática de la lengua castellana
Als Professor Richard Lovell den Weg durch die schmalen Gassen von Kanton zu der verblichenen Adresse aus seinem Kalender gefunden hatte, war in dem Haus nur noch der Junge am Leben.
Die Luft roch ranzig, der Boden war glitschig. Ein voller Wasserkrug stand unberührt neben dem Bett. Anfangs hatte der Junge zu viel Angst gehabt, sich übergeben zu müssen, wenn er trank; jetzt war er zu schwach, um den Krug zu heben. Er war zwar noch bei Bewusstsein, jedoch in einem nebligen Halbtraum versunken. Bald, so wusste er, würde er in einen tiefen Schlaf fallen und daraus nicht mehr erwachen. So war es vor einer Woche seinen Großeltern ergangen, einen Tag später seinen Tanten, und dann, noch einen Tag später, Miss Betty, der Engländerin.
Seine Mutter war an diesem Morgen gestorben. Er lag neben ihrer Leiche und sah zu, wie sich ihre Haut zunehmend blau-lila färbte. Das Letzte, was sie zu ihm gesagt hatte, war sein Name gewesen. Zwei Silben, die sie tonlos gehaucht hatte. Dann hatte sich ihr Gesicht verzerrt, war schlaff geworden. Ihre Zunge hing ihr aus dem Mund. Der Junge versuchte, ihre verhangenen Augen zu schließen, doch die Lider öffneten sich immer wieder.
Als Professor Lovell klopfte, öffnete niemand die Tür. Als er sie eintrat, schrie niemand überrascht auf – sie war verschlossen gewesen, denn Diebe nutzten die Seuche und nahmen die Häuser in der Nachbarschaft bis auf die Knochen aus, und obwohl es bei ihnen nur wenig Wertvolles zu holen gab, hatten der Junge und seine Mutter ein wenig Ruhe gewollt, bevor die Krankheit sie ebenfalls heimsuchte. Der Junge hatte das Gepolter gehört, konnte sich jedoch nicht dazu aufraffen, sich darum zu scheren.
Zu diesem Zeitpunkt wollte er nur sterben.
Professor Lovell ging die Treppe hinauf, betrat das Zimmer und blieb einen langen Augenblick neben dem Jungen stehen. Entweder bemerkte er die tote Frau auf dem Bett nicht, oder er wollte sie nicht bemerken. Der Junge lag still in seinem Schatten und fragte sich, ob diese große, bleiche Gestalt gekommen war, um seine Seele zu holen.
»Wie fühlst du dich?«, fragte Professor Lovell.
Der Junge atmete zu angestrengt, um zu antworten.
Professor Lovell kniete sich neben das Bett. Er zog einen schmalen Silberbarren aus seiner Jacketttasche und legte ihn auf die nackte Brust des Jungen, der zusammenzuckte; das Metall brannte, stechend wie Eis.
»Triacle«, sagte Professor Lovell erst auf Französisch. Dann auf Englisch: »Treacle.« Sirup.
Der Barren leuchtete blassweiß auf. Aus dem Nichts erklang ein gespenstischer Laut; ein Klingen, ein Singen. Der Junge wimmerte, drehte sich auf die Seite, krümmte sich zusammen, seine Zunge tastete verwirrt in seinem Mund umher.
»Durchhalten«, murmelte Professor Lovell. »Schluck den Geschmack hinunter.«
Die Sekunden tröpfelten vorbei. Der Atem des Jungen beruhigte sich. Er öffnete die Augen. Jetzt sah er Professor Lovell deutlicher, konnte die schiefergrauen Augen und die gebogene Nase erkennen – yīnggōubí nannten sie so eine Nase, Adlernase –, die nur einem Ausländer gehören konnte.
»Wie fühlst du dich jetzt?«, fragte Professor Lovell.
Der Junge holte noch einmal tief Luft. Dann sagte er auf überraschend gutem Englisch: »Es ist süß. Es schmeckt so süß …«
»Gut. Dann hat es funktioniert.« Professor Lovell steckte den Barren wieder zurück in seine Tasche. »Ist hier noch jemand am Leben?«
»Nein«, flüsterte der Junge. »Nur ich.«
»Gibt es etwas, das du nicht zurücklassen willst?«
Der Junge war einen Augenblick lang still. Eine Fliege landete auf der Wange seiner Mutter und krabbelte über ihre Nase. Er wollte sie verscheuchen, war jedoch zu schwach, um die Hand zu heben.
»Ich kann keine Leiche mitnehmen«, sagte Professor Lovell. »Nicht dorthin, wo wir hingehen.«
Der Junge blickte seine Mutter lange an.
»Meine Bücher«, sagte er schließlich. »Unter dem Bett.«
Professor Lovell beugte sich hinab und zog vier dicke Bände hervor. Bücher auf Englisch, deren Rücken vom vielen Lesen ramponiert waren, die Seiten so abgegriffen, dass die gedruckte Schrift kaum noch lesbar war. Der Professor blätterte darin umher, musste gegen seinen Willen lächeln und packte sie in seine Tasche. Dann nahm er den dünnen Jungen auf den Arm und trug ihn aus dem Haus.
Im Jahr 1829 breitete sich eine Seuche, die später als Cholera bekannt werden sollte, von Kalkutta über den Golf von Bengalen bis in den Fernen Osten aus – erst nach Siam, dann nach Manila und dann über Kaufmannsschiffe bis an die Küste Chinas. Die dehydrierten, hohläugigen Mannschaften warfen ihre Abfälle in den Perlfluss, aus dem Tausende tranken, in dem Tausende schwammen und badeten, und kontaminierten so das Wasser. Die Cholera traf wie eine Flutwelle auf Kanton und arbeitete sich rasant von den Docks bis in die weiter innen liegenden Wohnviertel vor. Das Viertel, in dem der Junge gelebt hatte, war innerhalb weniger Wochen wie ausgelöscht, ganze Familien starben hilflos in ihren Häusern. Als Professor Lovell den Jungen aus den Gassen Kantons trug, waren bereits alle Nachbarn in seiner Straße tot.
All das erfuhr der Junge, als er in einem sauberen, gut beleuchteten Zimmer in der English Factory erwachte, in Decken gewickelt, die weicher und weißer waren als alles, was er jemals berührt hatte. Sie trugen nur wenig dazu bei, dass es ihm besser ging. Ihm war unglaublich heiß und seine Zunge lag ihm wie ein sandiger Stein im Mund. Er fühlte sich, als ob er weit über seinem Körper schwebte. Wann immer der Professor sprach, schoss dem Jungen ein scharfer Schmerz durch die Schläfen, und seine Sicht färbte sich rot.
»Du hast großes Glück«, sagte Professor Lovell. »Diese Krankheit rafft beinahe alle dahin.«
Der Junge starrte ihn an, fasziniert von dem langen Gesicht und den hellgrauen Augen des Fremden. Wenn er seinen Blick unscharf werden ließ, wurde der Fremde zu einem Riesenvogel. Einer Krähe. Nein, einem Raubvogel. Zu etwas Grausamem, etwas Starkem.
»Verstehst du, was ich sage?«
Der Junge leckte sich über die ausgetrockneten Lippen und antwortete.
Professor Lovell schüttelte den Kopf. »Auf Englisch. Benutze dein Englisch.«
Dem Jungen brannte die Kehle. Er hustete.
»Ich weiß, dass du Englisch sprichst.« Professor Lovells Stimme klang warnend. »Nutze es.«
»Meine Mutter«, keuchte der Junge. »Sie haben meine Mutter vergessen.«
Professor Lovell antwortete nicht. Umgehend stand er auf und strich sich über die Knie, bevor er den Raum verließ, auch wenn der Junge nicht verstand, wie sich in den wenigen Minuten, die der Professor bei ihm gesessen hatte, Staub auf seiner Hose hätte sammeln können.
Am nächsten Morgen konnte der Junge eine Schale Brühe austrinken, ohne zu würgen. Den darauffolgenden Morgen konnte er ohne allzu viel Schwindel stehen, obwohl seine Knie in letzter Zeit so selten gebraucht worden waren und so stark zitterten, dass er sich am Bettrahmen festhalten musste, um nicht umzufallen. Sein Fieber sank; sein Appetit kehrte zurück. Als er am Nachmittag erneut erwachte, stand anstelle einer Schale ein Teller mit zwei dicken Scheiben Brot und einem großen Stück Roastbeef vor ihm. Ausgehungert aß er den Teller mit bloßen Händen leer.
Die meiste Zeit verbrachte er in traumlosem Schlaf, der regelmäßig durch die Ankunft einer Mrs Piper unterbrochen wurde – einer fröhlichen runden Frau, die seine Kissen aufschüttelte, ihm die Stirn mit einem wunderbar kalten Tuch abwischte und deren Englisch so merkwürdig klang, dass der Junge sie bei jedem Besuch mehrfach bitten musste, sich zu wiederholen.
»Meine Güte«, gluckste sie, als er sie das erste Mal darum bat. »Hast wohl noch nie ’ne Schottin gesehen.«
»Eine … Schottin? Was ist eine Schottin?«
»Zerbrich dir darüber mal nicht den Kopf.« Sie tätschelte ihm die Wange. »Du lernst schon noch früh genug, wie Großbritannien aussieht.«
An jenem Abend brachte Mrs Piper ihm neben seinem Abendessen – wieder Brot und Fleisch – die Nachricht, dass der Professor ihn in seinem Büro sehen wollte. »Das ist nur die Treppe hoch. Zweite Tür rechts. Iss erst auf; der geht nirgendwohin.«
Der Junge aß schnell und zog sich mit Mrs Pipers Hilfe an. Er wusste nicht, woher die Kleidung kam – sie war im westlichen Stil geschneidert und passte überraschend gut an seinen kleinen, dünnen Körper –, doch er war zu müde, um Fragen zu stellen.
Als er die Treppe hinaufging, zitterte er. Ob es an Müdigkeit oder Beklommenheit lag, wusste er nicht. Die Tür zum Büro des Professors war geschlossen. Er hielt einen Moment inne, um zu Atem zu kommen, dann klopfte er.
»Herein«, rief der Professor.
Die Tür war sehr schwer. Der Junge musste sich gegen das Holz stemmen, um sie zu öffnen. Ihm schlug der überwältigende, staubig-tintige Geruch von Büchern entgegen. Stapel über Stapel – einige ordentlich in Regale gestellt, andere achtlos zu wackeligen Pyramiden überall im Raum aufgetürmt; einige lagen auf dem Boden und wieder andere auf Schreibtischen, die scheinbar zufällig in dem schwach erleuchteten Labyrinth aufgestellt worden waren.
»Hier drüben.« Der Professor war fast vollständig von Bücherregalen verborgen. Der Junge ging zögerlich durch den Raum, voller Angst, dass auch nur die kleinste falsche Bewegung die Pyramiden zum Einsturz bringen könnte.
»Nicht so schüchtern.« Der Professor saß hinter einem mächtigen Schreibtisch voller Bücher, loser Zettel und Briefumschläge. Er bedeutete dem Jungen, sich auf den Platz ihm gegenüber zu setzen. »Haben sie dich hier viel lesen lassen? Englisch war kein Problem?«
»Ich habe ein wenig gelesen, ja.« Vorsichtig setzte der Junge sich und achtete darauf, nicht auf die Bücher zu treten – Richard Hakluyts Reisenotizen, wie er feststellte –, die um seine Füße herum angehäuft waren. »Wir hatten nicht viele Bücher. Ich habe dieselben immer wieder gelesen.«
Für jemanden, der Kanton noch nie im Leben verlassen hatte, war sein Englisch bemerkenswert gut. Er sprach nur mit leichtem Akzent. Das war der Engländerin zu verdanken – einer Miss Elizabeth Slate, die der Junge Miss Betty genannt hatte und die schon solange er denken konnte im Haus gewesen war. Er hatte nie ganz verstanden, was sie dort tat – seine Familie war auf keinen Fall reich genug, um Dienstboten anzustellen, und schon gar keine englischen –, doch jemand musste ihr Lohn gezahlt haben, denn sie war nie gegangen, nicht einmal dann, als die Seuche ausbrach. Ihr Kantonesisch war akzeptabel, gut genug, um sich problemlos in der Stadt zurechtzufinden, aber mit dem Jungen sprach sie ausschließlich Englisch. Sie schien keine andere Aufgabe zu haben, als sich um ihn zu kümmern, und er hatte fließend Englisch gelernt, indem er sich erst mit ihr, dann mit den britischen Matrosen an den Docks unterhielt.
Er konnte die Sprache besser lesen als sprechen. Seit seinem vierten Geburtstag hatte der Junge zwei Mal pro Jahr ein großes Paket bekommen, in dem sich ausschließlich Bücher auf Englisch befanden. Die Adresse des Absenders war ein Herrenhaus in Hampstead knapp außerhalb von London – ein Ort, der Miss Betty nicht bekannt war und über den der Junge natürlich nichts wusste. Trotzdem saß er mit Miss Betty gemeinsam bei Kerzenlicht und fuhr mit den Fingern über jedes Wort, bevor er es aussprach. Als er älter wurde, verbrachte er ganze Nachmittage damit, allein über den abgegriffenen Seiten zu brüten. Doch ein Dutzend Bücher reichten kaum sechs Monate. Er las jedes einzelne so oft, dass er alle fast auswendig kannte, wenn das nächste Paket ankam.
Jetzt erkannte er, ohne das große Ganze zu verstehen, dass der Professor diese Pakete geschickt haben musste.
»Es macht mir recht viel Spaß«, sagte er dünn. Dann dachte er, dass er wohl etwas mehr sagen sollte. »Und nein, Englisch war kein Problem.«
»Sehr gut.« Professor Lovell nahm einen Band vom Regal hinter sich und schob ihn über den Tisch. »Dieses hier hast du vermutlich noch nie gesehen?«
Der Junge blickte auf den Titel. Der Wohlstand der Nationen von Adam Smith. Er schüttelte den Kopf. »Nein, tut mir leid.«
»Das macht nichts.« Der Professor öffnete das Buch in der Mitte und deutete auf die Seite. »Lies mir laut vor. Fang hier an.«
Der Junge schluckte, räusperte sich, um die Kehle freizubekommen, und begann zu lesen. Das Buch war beängstigend dick, die Schrift sehr klein und die Sätze wesentlich schwieriger als die einfachen Abenteuerromane, die er mit Miss Betty gelesen hatte. Seine Zunge stolperte über Worte, die er nicht kannte, deren Aussprache er nur erraten konnte.
»Die be-besonderen V-Vorteile, die jedes ko-l-onisierende Land aus den ihm gehörigen Ko… Kolonien zieht, sind von zwei… zweierlei Art: Es sind erstens die ge…gewöhn…lichen, die jeder Staat aus den seiner Herrschaft un… un… unterworfenen?« Er räusperte sich. »Provinzen zieht.«2
»Das genügt.«
Er hatte keinen Schimmer, was er gerade gelesen hatte. »Sir, was bedeutet …«
»Kümmere dich nicht darum«, sagte der Professor. »Ich habe nicht erwartet, dass du internationale Wirtschaft verstehst. Das hast du sehr gut gemacht.« Er legte das Buch beiseite, griff in die Schreibtischschublade und zog einen Silberbarren heraus. »Erinnerst du dich daran?«
Der Junge starrte den Barren mit großen Augen an und wagte nicht einmal, ihn zu berühren.
Er hatte solche Barren schon zuvor gesehen. In Kanton waren sie selten, doch jeder wusste von ihrer Existenz. Yínfúlù, Silbertalismane. Er hatte sie im Bug von Schiffen gesehen, in den Seitenwänden von Sänften und über den Türen von Lagerhäusern im Fremdenviertel. Er hatte nie herausgefunden, was es mit diesen Barren auf sich hatte, und niemand in seinem Haushalt konnte es ihm erklären. Seine Großmutter nannte sie Zaubersprüche der Reichen, Metallamulette, die den Segen der Götter trugen. Seine Mutter dachte, sie enthielten gefangene Dämonen, die beschworen werden konnten, um die Befehle ihrer Meister auszuführen. Selbst Miss Betty, die laut ihre Verachtung für indigenen chinesischen Aberglauben kundtat und unablässig den Respekt seiner Mutter vor hungrigen Geistern kritisierte, fand sie unheimlich.
»Sie haben Zauberkraft«, sagte sie, als er danach fragte. »Werke des Teufels, das sind sie.«
Also wusste der Junge nicht, was er von diesem yínfúlù halten sollte, doch ein Barren genau wie dieser hatte ihm vor mehreren Tagen das Leben gerettet.
»Nur zu.« Professor Lovell hielt ihm das Silber hin. »Schau ihn dir an. Er beißt nicht.«
Der Junge zögerte, nahm ihn dann jedoch mit beiden Händen entgegen. Der Barren war sehr glatt und kalt, schien ansonsten jedoch völlig normal zu sein. Wenn ein Dämon in seinem Inneren gefangen war, versteckte er sich gut.
»Kannst du lesen, was darauf steht?«
Der Junge sah genauer hin und bemerkte, dass tatsächlich auf beiden Seiten des Barrens winzige Wörter eingraviert waren: Englisch auf der einen, Chinesisch auf der anderen. »Ja.«
»Lies die Worte laut vor. Erst Chinesisch, dann Englisch. Sprich sehr deutlich.«
Der Junge erkannte die chinesischen Schriftzeichen, obwohl sie merkwürdig aussahen, als wären sie von jemandem gezeichnet worden, der sie gesehen und sie dann Radikal für Radikal abgezeichnet hatte, ohne ihre Bedeutung zu erfassen.
Dort stand:
»Húlún tūn zǎo«, las er langsam und achtete darauf, jede Silbe deutlich auszusprechen. Dann las er das Englische: »To accept without thinking.« Akzeptieren, ohne zu denken.
Der Barren begann zu summen.
Sofort schwoll seine Zunge an, blockierte ihm die Luftröhre. Der Junge griff sich würgend an die Kehle. Der Barren fiel ihm in den Schoß, wo er unkontrolliert vibrierte, tanzte, als wäre er besessen. Ein widerlich süßer Geschmack breitete sich in seinem Mund aus. Wie Datteln, schoss es dem Jungen schwach durch den Kopf, während Schwarz sich von den Rändern seines Sichtfeldes ausbreitete. Starke, marmeladige Datteln, so reif, dass einem schlecht wurde. Er ertrank darin. Sein Hals war völlig verschlossen, er konnte nicht atmen …
»Moment.« Professor Lovell beugte sich zu ihm hinüber und nahm ihm den Barren aus dem Schoß. Das Erstickungsgefühl verschwand. Der Junge sackte auf dem Schreibtisch zusammen und schnappte nach Luft.
»Interessant«, sagte Professor Lovell. »Ich wusste nicht, dass es so einen starken Effekt haben würde. Welchen Geschmack hast du im Mund?«
»Hóngzǎo.« Tränen strömten ihm über die Wangen. Hastig wechselte er zu Englisch. »Datteln.«
»Das ist gut. Das ist sehr gut.« Einen langen Augenblick lang beobachtete Professor Lovell ihn, dann legte er den Barren wieder in die Schublade. »Sogar ausgezeichnet.«
Der Junge wischte sich schniefend die Tränen aus den Augen. Professor Lovell lehnte sich zurück und wartete, bis der Junge sich etwas erholt hatte, bevor er fortfuhr. »In zwei Tagen verlassen Mrs Piper und ich dieses Land und fahren in eine Stadt namens London in einem Land namens England. Ich bin sicher, du hast von beidem gehört.«
Der Junge nickte unsicher. London war für ihn wie Liliput: weit weg, eine Phantasiestadt, die nur in seiner Vorstellung existierte und wo niemand auch nur im Entferntesten aussah wie er, sprach wie er oder sich kleidete wie er.
»Ich schlage vor, dass du mitkommst. Du wirst auf meinem Anwesen leben, und ich werde dir Kost und Logis zur Verfügung stellen, bis du alt genug bist, dein eigenes Geld zu verdienen. Im Gegenzug wirst du die Kurse eines von mir entworfenen Kurrikulums belegen. Es wird um Sprachen gehen – Latein, Griechisch und natürlich Mandarin. Du wirst ein sorgloses, bequemes Leben führen und die beste Bildung erhalten, die man für Geld kriegen kann. Im Gegenzug erwarte ich von dir lediglich, dass du dich fleißig deinen Studien widmest.«
Professor Lovell verschränkte die Finger, als würde er beten. Der Junge fand seinen emotionslosen Tonfall verwirrend. Er konnte nicht ausmachen, ob der Professor ihn in London bei sich haben wollte oder nicht; er schien ihm weniger eine Adoption vorzuschlagen als ein Geschäftsabkommen.
»Ich rate dir, gut darüber nachzudenken«, fuhr Professor Lovell fort. »Deine Mutter und Großeltern sind tot, dein Vater ist unbekannt, und du hast keine weitere Familie. Wenn du hierbleibst, wirst du bettelarm sein. Du wirst nur Armut, Krankheit und Hunger erleben. Wenn du Glück hast, wirst du im Hafen arbeiten können, aber du bist noch klein, also wirst du einige Jahre lang betteln und stehlen müssen. Wenn du das Erwachsenenalter erreichst, kannst du bestenfalls auf Knochenarbeit auf den Schiffen hoffen.«
Der Junge ertappte sich dabei, wie er Professor Lovell fasziniert ins Gesicht starrte, während er sprach. Es war, als hätte er noch nie zuvor einen Engländer getroffen. Im Hafen hatte er viele Matrosen gesehen, hatte alle Ausprägungen der Gesichter weißer Männer kennengelernt, von den breiten, rötlichen über die kränklichen, leberfleckigen bis hin zu den langen, bleichen und ernsten. Doch das Gesicht des Professors war ein völlig neues Rätsel. Es hatte alle Bestandteile eines gewöhnlichen menschlichen Gesichts – Augen, Lippen, Nase, Zähne, alles gesund und normal. Seine Stimme war tief, ein wenig tonlos, aber dennoch menschlich. Doch wenn er sprach, waren sein Tonfall und seine Mimik völlig ausdruckslos. Er war ein unbeschriebenes Blatt. Der Junge konnte seine Gefühle absolut nicht erahnen. Der Professor hätte auch die Zutaten für einen Eintopf auflisten können, so distanziert sprach er von dem unvermeidlichen Tod des Jungen.
»Warum?«, fragte der Junge.
»Warum was?«
»Warum wollen Sie mich?«
Der Professor nickte zur Schublade, in der nun der Silberbarren lag. »Weil du das kannst.«
Da erst erkannte der Junge, dass dies ein Test gewesen war.
»Dies sind die Bedingungen meiner Vormundschaft.« Professor Lovell schob ein zweiseitiges Dokument über den Tisch. Der Junge blickte darauf hinab und gab es sofort auf, den Text überfliegen zu wollen; die enge, verschnörkelte Handschrift war fast unleserlich. »Sie sind recht simpel, aber lies sie aufmerksam, bevor du unterschreibst. Mach das noch heute, bevor du zu Bett gehst.«
Der Junge war zu aufgewühlt und konnte nur nicken.
»Sehr gut«, sagte Professor Lovell. »Aber eines noch. Mir scheint, du brauchst einen Namen.«
»Ich habe einen Namen«, sagte der Junge. »Ich heiße …«
»Nein, der geht nicht. Kein Engländer wird den aussprechen können. Hat Miss Slate dir einen Namen gegeben?«
Das hatte sie. An seinem vierten Geburtstag hatte sie darauf bestanden, dass er einen Namen annahm, mit dem Engländer ihn ernst nehmen würden, hatte jedoch nie ausgeführt, welche Engländer das sein mochten. Sie hatten irgendeinen Namen aus einem Reimbuch für Kinder ausgewählt, und der Junge mochte, wie prall und rund die Silben sich auf seiner Zunge anfühlten, also beschwerte er sich nicht. Doch niemand sonst im Haus hatte den Namen je benutzt und bald hatte auch Miss Betty ihn nicht mehr so genannt. Der Junge dachte einen Augenblick lang angestrengt nach, bevor er ihm wieder einfiel.
»Robin.«3
Professor Lovell war kurz still. Sein Gesichtsausdruck verwirrte den Jungen – der Professor zog die Brauen zusammen, als wäre er wütend, doch gleichzeitig spielte ein Lächeln um einen Mundwinkel, als wäre er amüsiert. »Und ein Nachname?«
»Ich habe einen Nachnamen.«
»Einen, der in London nicht auffällt. Nimm einen, der dir gefällt.«
Der Junge blinzelte ihn an. »Ich soll mir … einen aussuchen?«
Nachnamen legte man nicht aus einer Laune heraus ab, um sich dann einen neuen zu suchen, dachte er. Sie deuteten auf sein Erbe hin; sie bedeuteten Zugehörigkeit.
»Die Engländer erfinden ihre Namen andauernd neu«, sagte Professor Lovell. »Die Einzigen, die ihre Namen behalten, sind die, die Titel behalten wollen, von denen du bestimmt keine hast. Du musst dich nur irgendwie vorstellen können. Es ist egal, welcher Name es ist.«
»Kann ich dann Ihren nehmen? Lovell?«
»Oh nein«, sagte Professor Lovell. »Die Leute werden denken, ich sei dein Vater.«
»Oh … natürlich.« Der Junge blickte verzweifelt im Raum umher und suchte nach einem Wort oder Geräusch, das ihm auffiel. Auf dem Regal über Professor Lovells Kopf sah er ein bekanntes Buch – Gullivers Reisen. Ein Fremder in einem fremden Land, der die Sprache lernen musste, wenn er am Leben bleiben wollte. Er glaubte, jetzt zu verstehen, wie Gulliver sich fühlte.
»Swift?«, schlug er vor. »Wenn das …«
Zu seiner Überraschung lachte Professor Lovell. Gelächter aus diesem ernsten Mund zu hören war merkwürdig; es klang zu abrupt, beinahe grausam, und der Junge zuckte unwillkürlich zusammen. »Sehr gut. Dann sollst du Robin Swift sein. Sehr erfreut, Sie zu treffen, Mr Swift.«
Er stand auf und streckte dem Jungen über den Schreibtisch hinweg eine Hand entgegen. Der Junge hatte gesehen, wie sich fremde Matrosen im Hafen begrüßten, also wusste er, was er tun musste. Er schlug ein. Die Hand des Professors war groß, trocken und unangenehm kühl.
Zwei Tage später gingen Professor Lovell, Mrs Piper und der neugetaufte Robin Swift an Bord eines Schiffs Richtung London. Robin war dank vieler Stunden Bettruhe, einer konstanten Versorgung mit warmer Milch und Mrs Pipers großzügigen Essensportionen wieder auf dem Damm und konnte allein laufen. Er zog eine schwere Reisetruhe voller Bücher auf dem Steg hinter sich her und hatte Mühe, mit dem Professor Schritt zu halten.
Der Hafen Kantons, die Mündung, an der China die Welt empfing, war ein Universum voller Sprachen. Lautes und schnelles Portugiesisch, Französisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Englisch und Chinesisch schwebten durch die salzige Luft und vermischten sich zu einem unmöglichen, allgemein verständlichen Kauderwelsch, das jedoch nur wenige fließend sprachen. Robin kannte diese Geräuschkulisse gut. Er hatte seine Einführung in Fremdsprachen bekommen, während er auf den Kais des Hafens herumgelaufen war, hatte oft für Matrosen übersetzt und im Gegenzug einen Penny und ein Lächeln bekommen. Er hätte nie damit gerechnet, dass er den linguistischen Fragmenten der englischen Sprache bis zu ihren Wurzeln folgen würde.
Sie gingen die Ufermauer entlang, um sich in die Schlange der Wartenden vor der Countess of Harcourt einzureihen, einem Schiff der East India Company, auf dem bei jeder Überfahrt eine kleine Anzahl privater Passagiere mitfahren durfte. An jenem Tag war die See laut und unruhig. Robin zitterte, als eisige Winde ihm unter den Mantel griffen. Er wollte unbedingt auf das Schiff, in eine Kabine oder an einen anderen Ort mit Wänden, doch etwas hielt die Schlange auf. Professor Lovell trat aus der Schlange, um nachzusehen. Robin folgte ihm. Oben am Steg stritt ein Besatzungsmitglied mit einem Passagier, raue englische Laute durchdrangen die kühle Morgenluft.
»Verstehst du, was ich sage? Ni hao? Lai ho? Irgendwas?«
Seine Wut richtete sich gegen einen chinesischen Arbeiter, der sich unter dem Gewicht eines schweren Rucksacks vornüberbeugte. Falls der Arbeiter antwortete, konnte Robin ihn nicht hören.
»Versteht nix von dem, was ich sage«, beschwerte sich das Besatzungsmitglied. Er wandte sich an die Menge. »Kann hier wer diesem Kerl sagen, dass er nicht an Bord kommt?«
»Oh, der arme Mann.« Mrs Piper stupste Professor Lovell am Arm. »Können Sie übersetzen?«
»Ich spreche kein Kantonesisch«, sagte Professor Lovell. »Robin, geh zu ihm.«
Robin zögerte plötzlich angsterfüllt.
»Geh.« Professor Lovell schob ihn den Steg hinauf.
Robin stolperte nach vorn in die Menge. Sowohl das Besatzungsmitglied als auch der Arbeiter drehten sich zu ihm um. Der Matrose sah nur genervt aus, doch der Arbeiter schien erleichtert – er schien in Robin sofort einen Verbündeten zu erkennen, den einzigen anderen Chinesen weit und breit.
»Was ist los?«, fragte Robin ihn auf Kantonesisch.
»Er lässt mich nicht an Bord«, sagte der Arbeiter verzweifelt. »Aber ich habe einen Vertrag mit diesem Schiff. Bis nach London. Guck, hier steht’s.«
Er drückte Robin ein zusammengefaltetes Blatt Papier in die Hand.
Robin öffnete es. Das Dokument war auf Englisch verfasst und sah in der Tat nach einem Laskar-Kontrakt aus – ein Zahlungsbeleg für eine Reise von Kanton nach London, um genau zu sein. Robin hatte solche Verträge schon gesehen; sie hatten im Laufe der letzten Jahre zunehmend an Beliebtheit gewonnen, denn der Bedarf an vertraglich verpflichteten chinesischen Bediensteten wuchs proportional zu den Schwierigkeiten, denen sich der Sklavenhandel gegenübersah. Dies war nicht der erste Vertrag, den er übersetzt hatte; er hatte Arbeitsaufträge für chinesische Beschäftigte an so fernen Orten wie Portugal, Indien und den Westindischen Inseln gesehen.
Robin schien mit dem Vertrag alles in Ordnung zu sein. »Wo liegt denn das Problem?«
»Was sagt er dir?«, fragte der Matrose. »Sag ihm, der Vertrag ist nicht gültig. Ich nehm keine Chinesen auf diesem Schiff mit. Das letzte Schiff, wo ich einen dabeihatte, war voller Läuse. Ich geh kein Risiko ein, nur weil sich einer nicht waschen kann. Der würde nicht mal verstehen, wenn ich baden schreien würde. Hallo? Kleiner? Verstehst du mich?«
»Ja. Ja.« Hastig wechselte Robin wieder ins Englische. »Ja, es ist nur … einen Moment, ich versuche, die Worte …«
Aber was sollte er sagen?
Der Arbeiter, der kein Wort verstand, blickte Robin flehentlich an. Sein wettergegerbtes Gesicht war voller Falten und die Haut so ledern, dass man ihn auf sechzig geschätzt hätte, obwohl er vermutlich gerade mal in den Dreißigern war. Robin hatte Gesichter wie seines tausend Mal am Hafen gesehen. Einige der Seemänner warfen ihm Süßigkeiten zu; andere kannten ihn gut genug, um ihn mit Namen zu grüßen. Aber er hatte noch nie erlebt, dass ein Älterer sich in solcher Hilflosigkeit an ihn wandte.
Schuld rumorte in seinem Magen. Wörter sammelten sich auf seiner Zunge, grausame und schreckliche Wörter, aber er konnte sie nicht zu einem Satz verbinden.
»Robin.« Professor Lovell war an seiner Seite, und sein eiserner Griff an Robins Schulter schmerzte. »Bitte übersetze.«
Es hing alles von ihm ab, erkannte Robin, und er hatte die Wahl. Es lag an ihm, die Wahrheit festzulegen, denn nur er konnte mit allen Parteien kommunizieren.
Doch was sollte er sagen? Er sah die aufschäumende Wut des Matrosen und die wachsende Ungeduld der anderen Passagiere in der Schlange. Sie waren müde, ihnen war kalt und sie verstanden nicht, warum sie nicht an Bord konnten. Er spürte, wie Professor Lovells Daumen gegen sein Schlüsselbein drückte, und etwas schoss ihm durch den Kopf – ein Gedanke, so beängstigend, dass ihm die Knie zitterten. Sollte er ein zu großes Problem darstellen, sollte er Ärger machen, dann könnte die Countess of Harcourt ihn ebenfalls am Ufer zurücklassen.
»Der Vertrag ist ungültig«, murmelte er dem Arbeiter zu. »Probieren Sie’s auf dem nächsten Schiff.«
Der Arbeiter starrte ihn mit ungläubig geöffnetem Mund an. »Hast du ihn gelesen? Da steht London, da steht East India Trading Company, da steht dieses Schiff, die Countess …«
Robin schüttelte den Kopf. »Er ist nicht gültig«, sagte er und wiederholte seine Aussage noch mal, als ob sie dadurch wahr würde. »Nicht gültig, probieren Sie’s auf dem nächsten Schiff.«
»Was stimmt nicht damit?«, wollte der Arbeiter wissen.
Robin bekam die Worte kaum heraus. »Ist einfach nicht gültig.«
Der Mann starrte ihn an. Eintausend Emotionen zeigten sich auf dem verwitterten Gesicht – Verärgerung, Frustration und schließlich Resignation.
Robin hatte befürchtet, dass der Mann widersprechen, dass er sich wehren würde, doch er erkannte schnell, dass eine solche Behandlung für den Arbeiter nichts Neues war. Das war ihm schon einmal passiert. Er drehte sich abrupt um und drängelte sich grob durch die Passagiere den Steg hinab. Nach wenigen Augenblicken war er aus dem Sichtfeld verschwunden.
Robin war sehr schwindelig. Er flüchtete den Steg hinunter zu Mrs Piper. »Mir ist kalt.«
»Oh, du zitterst ja, du armes Ding.« Sie kümmerte sich sofort wie eine Glucke um ihn und wickelte ihn in ihren Schal, dann wandte sie sich mit scharfem Blick an Professor Lovell. Er seufzte, nickte; dann drängten sie sich zum Anfang der Schlange und wurden von dort sofort in ihre Kabinen gebracht, während ein Gepäckträger ihnen ihre Truhen hinterherschleppte.
Eine Stunde später war die Countess of Harcourt ausgelaufen.
Robin lag in seiner Koje, hatte eine dicke Decke um die Schultern geschlungen und wäre nur zu gerne den ganzen Tag liegen geblieben, doch Mrs Piper drängte ihn, an Deck zu gehen und die schwindende Küste zu beobachten. Als Kanton hinter dem Horizont verschwand, durchzuckte ihn ein scharfer Schmerz, als ob ein Enterhaken ihm das Herz aus der Brust gerissen hätte. Bis jetzt war ihm nicht klar gewesen, dass er sein Heimatland viele Jahre nicht mehr sehen würde – falls er überhaupt je zurückkehren würde. Er war sich nicht sicher, was er davon halten sollte. Das Wort Verlust war unzureichend. Verlust bedeutete einfach nur ein Fehlen, bedeutete, dass etwas nicht mehr da war, umfasste jedoch nicht die Totalität dieser Trennung, das angsteinflößende Entwurzeln von allem, was er je gekannt hatte.
Er blickte lange über den Ozean, ignorierte den Wind und fixierte den Horizont so lange, bis selbst das geistige Bild der Küste verblasste.
Die ersten Reisetage verschlief er. Er war immer noch nicht völlig wiederhergestellt; Mrs Piper bestand darauf, dass er täglich an Deck spazieren ging – seiner Gesundheit wegen –, doch anfangs hielt er nur wenige Minuten durch, bevor er sich wieder hinlegen musste. Er hatte Glück, dass ihm die Seekrankheit erspart blieb; eine Kindheit am Hafen und an den Flüssen hatte seine Sinne an unruhigen Untergrund gewöhnt. Als er sich stark genug fühlte, um ganze Nachmittage an Deck zu verbringen, saß er gern an der Reling und beobachtete, wie die unermüdlichen Wellen gemeinsam mit dem Himmel die Farbe veränderten, genoss die Gischt auf dem Gesicht.
Von Zeit zu Zeit ging Professor Lovell mit ihm über das Deck und unterhielt sich mit ihm. Robin lernte schnell, dass der Professor ein genauer, doch wortkarger Mensch war. Er teilte Robin nur Informationen mit, wenn er der Meinung war, dass dieser sie brauchte, ließ ansonsten Fragen aber auch gerne unbeantwortet.
Er erzählte Robin, dass sie in seinem Herrenhaus in Hampstead wohnen würden, sobald sie England erreichten, sagte aber nicht, ob er dort auch Familie hatte. Er bestätigte, dass er Miss Betty all die Jahre lang bezahlt hatte, nannte ihm jedoch keinen Grund. Er deutete an, dass er Robins Mutter gekannt und so auch von Robins Adresse erfahren habe, doch er führte nicht weiter aus, welcher Natur ihre Beziehung gewesen war oder wie sie sich kennengelernt hatten. Er bezog sich nur ein einziges Mal auf ihre längere Bekanntschaft, indem er Robin fragte, wie seine Familie in der Hütte am Fluss gelandet war.
»Als ich sie kannte, war deine Familie eine gut situierte Kaufmannsfamilie«, sagte er. »Hatte ein Haus in Peking, bevor sie nach Süden zog. Was ist passiert, war es das Glücksspiel? Bestimmt ihr Bruder, nicht wahr?«
Vor einigen Monaten hätte Robin jedem ins Gesicht gespuckt, der so grausam von seiner Familie sprach. Doch hier, allein, mitten auf dem Ozean, ohne Verwandte und ohne einen Penny, konnte er die Wut nicht heraufbeschwören. In ihm war kein Feuer übrig. Er hatte nur noch Angst und war so, so müde.
Doch all diese Informationen passten zu dem, was man Robin über den vergangenen Reichtum seiner Familie erzählt hatte. Der war in den Jahren nach seiner Geburt vollständig verspielt worden. Seine Mutter hatte sich oft bitter darüber beklagt. Robin kannte keine Details, doch die Geschichte klang wie die vieler gefallener Familien der Qing-Dynastie: ein alternder Patriarch, ein verschwenderischer Sohn, böswillige, manipulative Freunde und eine hilflose Tochter, die aus mysteriösen Gründen niemand heiraten wollte. Einst, so hatte man Robin erzählt, hatte er in einer lackierten Wiege geschlafen. Einst hatten sie ein Dutzend Bedienstete beschäftigt und einen Koch gehabt, der seltene Delikatessen zubereitete, die sie von den Märkten im Norden importiert hatten. Einst hatten sie auf einem Anwesen gelebt, auf dem Platz für fünf Familien gewesen wäre und auf dem Pfaue über den Hof stolzierten. Doch Robin kannte nur das kleine Haus am Fluss.
»Meine Mutter hat erzählt, mein Onkel hätte all ihr Geld in den Opiumhäusern verloren«, sagte er zum Professor. »Schuldner haben ihr Anwesen gepfändet, und wir mussten umziehen. Mein Onkel wird vermisst, seit ich drei bin, also gab es nur uns, meine Tanten und meine Großeltern. Und Miss Betty.«
Professor Lovell machte ein unverbindliches, mitfühlendes Geräusch. »Das tut mir leid.«
Bis auf diese Unterhaltungen verbrachte der Professor die meiste Zeit in seiner Kabine. Sie sahen ihn nur ab und zu zum Abendessen in der Messe, doch oft musste Mrs Piper Schiffszwieback und getrocknetes Schweinefleisch auf einen Teller häufen und ihm in seine Kabine bringen.
»Er arbeitet an seinen Übersetzungen«, sagte sie zu Robin. »Von diesen Reisen bringt er immer Schriftrollen und alte Bücher mit und möchte sie ins Englische übersetzt haben, bevor wir in London ankommen. Dort ist er immer sehr beschäftigt – er ist ein sehr wichtiger Mann, weißt du? Mitglied der Royal Asiatic Society. Er meint, er habe nur auf Seefahrten etwas Ruhe. Ist das nicht lustig? In Macau hat er einige schöne Reimwörterbücher erstanden – hübsche Ausgaben, aber anfassen darf ich sie nicht, weil die Seiten so dünn sind.«
Robin war überrascht, als er hörte, dass sie in Macau gewesen waren. Er hatte nichts von einer Reise nach Macau gewusst; naiv, wie er war, war er davon ausgegangen, dass der Professor nur seinetwegen nach China gekommen sei. »Wie lang waren Sie da? In Macau, meine ich.«
»Oh, gute zwei Wochen. Wir wären genau zwei Wochen dortgeblieben, aber wir wurden am Zoll aufgehalten. Sie lassen fremde Frauen nicht gerne aufs Festland – ich musste mich verkleiden und als Onkel des Professors ausgeben, kannst du dir das vorstellen?«
Zwei Wochen.
Vor zwei Wochen war Robins Mutter noch am Leben gewesen.
»Alles in Ordnung, mein Lieber?« Mrs Piper wuschelte ihm durch die Haare. »Du siehst so blass aus.«
Robin nickte und schluckte die Worte herunter, die er nicht sagen durfte.
Er hatte kein Recht, bitter zu sein. Professor Lovell hatte ihm alles versprochen und schuldete ihm nichts. Robin verstand die Regeln der Welt, die er kennenlernen würde, noch nicht, aber er verstand, dass Dankbarkeit vonnöten war. Hochachtung. Man verärgerte seine Retter nicht.
»Soll ich diesen Teller für Sie zum Professor bringen?«, fragte er.
»Danke, mein Lieber. Sehr nett von dir. Komm danach an Deck, dann schauen wir uns gemeinsam den Sonnenuntergang an.«
Die Tage verschwammen miteinander. Die Sonne ging auf und unter, doch ohne regelmäßige Routine – er hatte keine Hausarbeit zu erledigen, musste kein Wasser holen und keine Erledigungen machen – schienen die Tage und Stunden einander zu gleichen. Robin schlief, las seine alten Bücher noch einmal und spazierte über die Decks. Dann und wann unterhielt er sich mit einem der anderen Passagiere, die immer hocherfreut schienen, einen perfekten Londoner Akzent aus dem Mund dieses kleinen orientalischen Jungen zu hören. Er erinnerte sich an Professor Lovells Worte und gab sich große Mühe, ausschließlich auf Englisch zu reden und zu denken. Sobald ihm Gedanken auf Chinesisch aufkamen, unterdrückte er sie.
Er unterdrückte auch seine Erinnerungen. Sein Leben in Kanton – seine Mutter, seine Großeltern, ein Jahrzehnt auf den Docks – all das konnte er überraschend leicht ablegen. Vielleicht weil diese Überfahrt so erschütternd, der Bruch so glatt war. Er hatte alles zurückgelassen, was er gekannt hatte. Er konnte sich an nichts festhalten, sich zu nichts zurückflüchten. Seine Welt bestand nun aus Professor Lovell, Mrs Piper und dem Versprechen von einem Land auf der anderen Seite des Ozeans. Er begrub sein altes Leben, nicht weil es schrecklich gewesen wäre, sondern weil er nur so überleben konnte. Er schlüpfte in seinen englischen Akzent wie in einen Mantel, gab sich alle Mühe, dass er richtig saß, und innerhalb weniger Wochen gefiel es ihm sogar. Bald bat ihn niemand mehr darum, zur allgemeinen Belustigung einige Brocken Chinesisch zu sprechen. Innerhalb weniger Wochen schienen alle vergessen zu haben, dass er Chinese war.
Eines Morgens weckte Mrs Piper ihn früh auf. Er gab einige Protestlaute von sich, doch sie war beharrlich. »Komm, mein Lieber, das willst du nicht verpassen.« Gähnend zog er sich ein Jackett an. Er rieb sich immer noch die Augen, als sie in den kalten Morgen an Deck traten. Der Nebel war so dicht, dass Robin kaum den Bug erkannte. Doch dann lichtete sich der Nebel, eine grauschwarze Silhouette erschien am Horizont, und das war der erste Blick, den Robin auf London erhaschte: die Silberstadt, das Herz des britischen Imperiums, und zu jener Zeit die größte und reichste Stadt der Welt.
KAPITEL ZWEI
[…] von der Präsenz der kolossalen Metropole,
der Quelle des Geschickes meines Landes,
ja des Geschicks der Erde selbst
WILLIAM WORDSWORTHThe Prelude
London war ein trostloses Grau und eine bunte Farbexplosion. Es war lautes Getöse und gespenstische Stille, voller unheimlicher Geister und Friedhöfe. Als die Countess of Harcourt die Themse hinauf landeinwärts in Richtung der Werften fuhr, die im pulsierenden Zentrum der Stadt lagen, verstand Robin sofort, dass London wie Kanton eine Stadt der Gegensätze und der Vielfalt war – wie jede Stadt, die ein Tor zur Welt bildete.
Doch anders als in Kanton schlug in London ein mechanisches Herz. Silber floss durch die Adern der Stadt. Es schimmerte von den Rädern der Droschken und Kutschen und von den Hufen der Pferde; schien von Gebäuden herab, unter den Fenstern und über den Türen; lag vergraben unter den Straßen und war hoch oben in den tickenden Zeigern der Uhrentürme verarbeitet; es lag in Schaufenstern von Läden, deren Aushängeschilder stolz von der magischen Verbesserung der Torten, Teller und Töpfe kündeten.
Der Lebenssaft Londons hatte eine scharfe, blecherne Note, völlig anders als der klappernde Bambus, der in Kanton überall präsent war. London war künstlich, metallisch – das Kreischen eines Messers auf dem Wetzstein; es war das monströse industrielle Labyrinth von William Blakes »grausamem Wirken/vieler Räder, durch mich erspäht, Rad ohne Rad, mit despotischen Zähnen, die einzig durch Zwang einander bewegen«.4
London hatte sich den Löwenanteil des globalen Silbererz- und Sprachvorkommens gesichert, und das Ergebnis war eine Stadt, die größer, schwerer, schneller und heller war, als die Natur erlaubte. London war unersättlich, labte sich an dem Ertrag seines Raubguts und verhungerte trotzdem. London war sowohl unvorstellbar reich als auch bettelarm. London – wunderschön, hässlich, weitläufig, beengt, rülpsend, schniefend, rechtschaffen, scheinheilig, versilbert – stand der Abrechnung kurz bevor, denn es würde der Tag kommen, an dem es sich entweder von innen auffraß oder sich weiter ausbreitete, auf der Suche nach neuen Delikatessen, neuer Arbeit, neuem Kapital, neuen Kulturen, die es verschlingen konnte.
Doch die Entscheidung war noch nicht gefallen, auch wenn sie unausweichlich war, und zumindest für den Augenblick hatten die Wunder Bestand. Als Robin, Professor Lovell und Mrs Piper im Hafen von London an Land gingen, waren die Docks voll vom Trubel des kolonialen Handels auf seinem Höhepunkt. Schiffe beladen mit schweren Truhen voller Tee, Baumwolle und Tabak, die Masten und Querbalken mit Silber besetzt, um schneller und sicherer zu segeln, warteten nur darauf, dass ihre Fracht gelöscht wurde, damit sie zu ihrer nächsten Reise nach Indien, zu den Westindischen Inseln, nach Afrika oder in den Fernen Osten aufbrechen konnten. Sie schickten britische Waren rund um die Welt und brachten Truhen voller Silber zurück.
Silberbarren wurden in London – und ja, auf der ganzen Welt – seit einem Jahrtausend verwendet, aber seit der Blütezeit des spanischen Reiches hatte kein Ort mehr so viel Silber besessen und sich so sehr auf dessen Macht verlassen.
Silberlegierungen in den Kanälen machten das Wasser frischer und sauberer, als es in einem Fluss wie der Themse sein könnte. Das Silber in den Abwasserkanälen übertünchte den Gestank von Regen, Schlamm und Unrat mit dem Geruch unsichtbarer Rosen. Silber in den Uhrentürmen ließ die Glocken viele Meilen weiter hallen, als es möglich sein sollte, bis sich die Töne überall in der Stadt und sogar auf dem Land vermengten.
In die Sitze des zweirädrigen Hansoms, das Professor Lovell heranwinkte, nachdem sie die Zollstation passiert hatten, war ebenfalls Silber eingearbeitet. Als sie sich eng aneinandergedrückt in die kleine Droschke gezwängt hatten, deutete Professor Lovell auf einen Silberbarren, der in ihren Boden eingelassen war.
»Kannst du lesen, was da steht?«, fragte er.
Robin beugte sich mit zusammengekniffenen Augen vor. »Speed – Geschwindigkeit. Und … spes?«
»Spēs«, sagte Professor Lovell. »Das ist Latein und die Wurzel des englischen Wortes speed. Es steht für eine ganze Reihe von Dingen, darunter Hoffnung, Glück, Erfolg und das Erreichen der eigenen Ziele. Dadurch fährt die Kutsche etwas sicherer und schneller.«
Robin runzelte die Stirn und fuhr mit dem Finger über den Barren. Er schien so klein, zu harmlos, um einen solch großen Effekt zu haben. »Aber wie?« Und eine zweite, dringlichere Frage: »Werde ich …«
»Mit der Zeit.« Professor Lovell klopfte ihm auf die Schulter. »Aber ja, Robin Swift. Du wirst einer der wenigen Gelehrten weltweit sein, die in die Geheimnisse des Silberwerkens eingeweiht werden. Deswegen habe ich dich hergebracht.«
Zwei Stunden später kamen sie in einem Dorf namens Hampstead an, das mehrere Meilen nördlich von London lag. Dort besaß Professor Lovell ein vierstöckiges Haus aus roten Ziegeln und weißem Stuck, das von einem großzügigen Stück Land mit gepflegten Büschen umgeben war.
»Dein Zimmer ist oben«, sagte Professor Lovell zu Robin, als er die Tür entriegelte. »Die Treppe hinauf und dann nach rechts.«
Im Haus war es dunkel und kühl. Mrs Piper ging die Räume ab und öffnete Vorhänge, während Robin seine Truhe wie geheißen die Wendeltreppe hinauf und durch den Korridor zerrte. Sein Zimmer war nur spärlich eingerichtet – ein Schreibtisch, ein Bett und ein Stuhl. Es gab keine Dekoration oder andere Besitztümer. Nur ein Bücherregal stand in der Ecke, das so vollgestellt war, dass seine geliebte Sammlung ihm im Vergleich mickrig erschien.
Neugierig trat Robin an das Regal heran. Waren diese Bücher extra für ihn ausgewählt worden? Das schien ihm unwahrscheinlich, doch viele der Bücher sahen so aus, als könnte er sie interessant finden – allein auf dem obersten Regalbrett standen mehrere Bücher von Swift und Defoe, Romane seiner Lieblingsautoren, von denen er nichts gewusst hatte. Ah, dort stand auch Gullivers Reisen. Er nahm das Buch aus dem Regal. Es schien häufig gelesen worden zu sein, einige Seiten waren zerknittert und hatten Eselsohren, andere waren voller Tee- oder Kaffeeflecken.
Verwirrt stellte er das Buch wieder zurück. Jemand anderes musste vor ihm in diesem Zimmer gelebt haben. Vielleicht ein anderer Junge – jemand in seinem Alter, der Jonathan Swift genauso gerne las wie er, jemand, der diese Ausgabe von Gullivers Reisen so oft gelesen hatte, dass die Tinte oben rechts auf der Seite, wo man umblätterte, schon abgegriffen war.
Doch wer könnte das gewesen sein? Er vermutete, dass Professor Lovell keine Kinder hatte.
»Robin!«, rief Mrs Piper von unten herauf. »Du sollst runterkommen.«
Robin eilte die Treppe hinunter. Professor Lovell wartete an der Tür auf ihn und sah ungeduldig auf seine Taschenuhr.
»Gefällt dir dein Zimmer?«, fragte er. »Vermisst du etwas?«
Robin schüttelte den Kopf. »Es gefällt mir sehr.«
»Gut.« Professor Lovell nickte zu der wartenden Droschke. »Rein mit dir, wir müssen einen Engländer aus dir machen.«
Das meinte er wörtlich. Den restlichen Nachmittag machten Professor Lovell und Robin mehrere Erledigungen, durch die der Junge in die britische Gesellschaft eingegliedert werden sollte. Sie gingen zu einem Arzt, der ihn wog, untersuchte und widerstrebend für geeignet zum Leben auf der Insel befand: »Keine tropischen Krankheiten und Gott sei Dank auch keine Flöhe. Er ist etwas klein für sein Alter, aber wenn Sie ihm Hammelfleisch und Kartoffelbrei zu essen geben, wird das schon. Jetzt die Pockenimpfung – rolle bitte deinen Ärmel hoch, vielen Dank. Tut nicht weh. Zähl bis drei.«
Sie gingen zu einem Barbier, der Robins wildes, kinnlanges Haar ordentlich bis über die Ohren zurückschnitt. Sie hatten Termine bei einem Hut- und einem Schuhmacher und besuchten einen Schneider, der ihm mehrere Stoffballen zeigte, von denen der überforderte Robin willkürlich einige auswählte.
Im Laufe des Nachmittags gingen sie zum Gericht, wo sie einen Termin bei einem Anwalt hatten, der einige Dokumente aufsetzte, durch die Robin unter der Vormundschaft von Professor Richard Linton Lovell zu einem rechtmäßigen Bürger des Vereinigten Königreichs werden würde.
Professor Lovell unterschrieb schwungvoll. Dann trat Robin an den Schreibtisch des Anwalts. Er war zu hoch für ihn, sodass ein Assistent eine Bank für ihn holte, auf die er sich stellen konnte.
»Ich dachte, ich hätte das schon unterschrieben.« Robin blickte auf das Dokument. Es schien dem Vertrag recht ähnlich zu sein, den Professor Lovell ihm in Kanton gegeben hatte.
»Das war der Vertrag zwischen dir und mir«, sagte Professor Lovell. »Dieser hier macht dich zu einem Engländer.«
Robin überflog die geschwungene Schrift. Vormund, Waise, Minderjähriger, Sorgerecht. »Sie adoptieren mich als Ihren Sohn?«
»Ich mache dich zu meinem Mündel. Das ist etwas anderes.«
Warum?, hätte er beinahe gefragt. Die Frage erschien ihm wichtig, doch er war noch zu jung, um den Grund dafür zu verstehen. Ein bedeutungsschwerer Moment der Stille breitete sich zwischen ihnen aus. Der Anwalt kratzte sich an der Nase. Professor Lovell räusperte sich. Doch der Moment verstrich. Der Professor war nicht mitteilsam, und Robin wusste, dass es keinen Zweck hatte, auf einer Erklärung zu beharren. Er unterschrieb.
Als sie nach Hampstead zurückkehrten, war die Sonne schon lange untergegangen. Robin bat um Erlaubnis, ins Bett gehen zu dürfen, doch Professor Lovell drängte ihn, zuvor ins Esszimmer zu gehen.
»Du darfst Mrs Piper nicht enttäuschen. Sie hat den ganzen Nachmittag in der Küche gestanden. Du solltest dein Abendessen wenigstens etwas auf dem Teller herumschieben.«
Mrs Piper und ihre Küche hatten tatsächlich ein wunderbares Wiedersehen gefeiert. Der Esszimmertisch, der viel zu groß für nur zwei Personen schien, ächzte unter Karaffen voller Milch, Brötchen aus weißem Mehl, gerösteten Karotten und Kartoffeln aus dem Ofen, Schüsseln mit Bratensoße, einer köchelnden, versilberten Terrine und etwas, das nach einem ganzen, glasierten Hähnchen aussah. Robin hatte seit dem Morgen nichts gegessen. Er hätte am Verhungern sein müssen, doch er war so erschöpft, dass sich ihm beim Anblick des Essens der Magen umdrehte.
Also blickte er zu einem Gemälde, das über dem Tisch hing. Es war unmöglich, es zu ignorieren, denn es dominierte das ganze Zimmer. Zu sehen war eine schöne Stadt in der Abenddämmerung, die vermutlich nicht London war. Sie erschien Robin würdevoller. Älter.
»Ah. Das ist Oxford«, sagte Professor Lovell, der seinem Blick gefolgt war.
Oxford. Das Wort hatte Robin schon gehört, aber er wusste nicht genau, wo. Er versuchte, den Namen zu analysieren, wie er es mit allen unbekannten englischen Wörtern tat. »Ford, Furt … also ein Ort, an dem man Kühe über einen Fluss treibt? Warum, gibt es dort einen Markt?«
»Eine Universitätsstadt«, sagte Professor Lovell, »in der alle großen Geister der Nation forschen, lernen und lehren. Es ist ein wunderbarer Ort, Robin.«
Er deutete auf ein großes Gebäude mit einer Kuppel in der Mitte des Gemäldes. »Das ist die Radcliffe Camera, in der sich eine Bibliothek befindet. Und das hier ist das Königliche Institut für Übersetzung«, sagte er und wies auf einen Turm neben der Kuppel, das größte Gebäude auf dem Gemälde. »In Oxford lehre ich, und dort verbringe ich auch einen Großteil des Jahres, wenn ich mich nicht in London aufhalte.«
»Wunderschön«, sagte Robin.
»Das ist es.« In Professor Lovells Stimme schwang eine ungewöhnliche Wärme mit. »Es ist der schönste Ort auf Erden.«
Er fuhr mit gespreizten Fingern durch die Luft, als ob er Oxford vor sich sähe. »Stell dir eine Stadt voller Gelehrter vor, die alle die wundersamsten, faszinierendsten Dinge erforschen. Naturwissenschaften. Mathematik. Sprachen. Literatur. Stell dir Gebäude vor, die mehr Bücher beherbergen, als du in deinem ganzen Leben gesehen hast. Stell dir Stille, Einsamkeit und einen ruhigen Ort zum Nachdenken vor.« Er seufzte. »London ist ein lärmendes Durcheinander. Unmöglich, in der Stadt irgendetwas zu schaffen; sie ist zu laut und sie verlangt einem zu viel ab. Du kannst an Orte wie Hampstead flüchten, doch der schreiende Stadtkern zieht dich immer wieder zurück, ob du nun willst oder nicht. Aber Oxford gibt dir alles, was du zum Arbeiten brauchst – Nahrung, Kleidung, Bücher, Tee –, und dann lässt es dich in Frieden. Es ist das Zentrum allen Wissens und aller Innovation der zivilisierten Welt. Solltest du in deinen Studien hier ausreichend Fortschritte machen, hast du vielleicht eines Tages das Glück, Oxford dein Zuhause zu nennen.«
Die einzig angebrachte Antwort schien ehrfürchtiges Schweigen zu sein. Professor Lovell blickte das Gemälde wehmütig an. Robin versuchte, seinen Enthusiasmus zu spiegeln, konnte sich aber einen verunsicherten Seitenblick auf den Professor nicht verkneifen. Der sanfte Blick, das Verlangen, das er dort sah, überraschte ihn. In der kurzen Zeit, in der Robin ihn gekannt hatte, hatte er den Professor nie so voller Zuneigung für etwas erlebt.
Robins Unterricht begann am nächsten Tag.
Sobald er das Frühstück beendet hatte, wies Professor Lovell ihn an, sich zu waschen und in zehn Minuten wieder in den Salon zu kommen. Dort erwartete ihn ein beleibter, lächelnder Herr namens Mr Felton – ein Mann mit dem besten Abschluss des Oriel College in Oxford, der dafür sorgen sollte, dass Robins Latein dem Standard der Universitätsstadt entsprach. Der Junge fing im Vergleich zu Gleichaltrigen spät an, doch wenn er sich anstrengte, würde das schon werden.
Und so begann ein Morgen voller grundlegender Vokabelübungen – agricola, terra, aqua –, was entmutigend genug war, ihm jedoch im Vergleich mit den verwirrenden Erklärungen von Deklinationen und Konjugationen, die darauf folgten, einfach erschien. Robin hatte die Grundlagen von Grammatik nie gelernt – er wusste, wie man Sätze auf Englisch bildete, weil sie sich richtig anhörten –, und so lernte er im Lateinunterricht zugleich die Grundbegriffe der Sprache kennen. Nomen, Verb, Subjekt, Prädikat, Kopula; dann Nominativ, Genitiv, Akkusativ … Im Laufe der nächsten drei Stunden saugte er beeindruckend viel Wissen in sich auf und hatte bis zum Ende des Unterrichts die Hälfte schon wieder vergessen. Doch was blieb, war eine große Wertschätzung für Sprache, für all die Worte und das, was man mit ihnen anstellen konnte.
»Schon in Ordnung, Junge.« Zum Glück war Mr Felton ein geduldiger Mann und schien die geistigen Qualen, denen er Robin aussetzte, nachvollziehen zu können. »Nachdem wir die Basis erarbeitet haben, wird es dir viel mehr Spaß machen. Warte nur ab, bis wir zu Cicero kommen.« Er blickte auf Robins Notizen hinab. »Aber du musst dir mehr Mühe mit deiner Rechtschreibung geben.«
Robin verstand nicht, was er falsch gemacht hatte. »Was meinen Sie?«
»Du hast fast alle Längenstriche vergessen.«
»Oh.« Robin unterdrückte einen ungeduldigen Laut; er hatte großen Hunger und wollte einfach nur fertig werden, damit er zum Mittagessen gehen konnte. »Ach so.«
Mr Felton trommelte mit den Knöcheln auf den Tisch. »Die Länge jedes einzelnen Vokals ist von Bedeutung, Robin Swift. Denk doch nur an die Bibel. Der hebräische Text spezifiziert nicht, welche verbotene Frucht die Schlange Eva anbietet. Doch auf Latein bedeutet malum ›schlecht‹ und mālum ›Apfel‹. Es war leicht, einen Apfel für die Erbsünde verantwortlich zu machen. Doch soweit wir wissen, könnte auch eine Kaki der Übeltäter gewesen sein.«
Um die Mittagszeit verließ Mr Felton das Haus, nachdem er Robin eine Liste von etwa einhundert Wörtern genannt hatte, die er bis zum nächsten Morgen lernen sollte. Robin aß allein im Salon, schaufelte mechanisch Schinken und Kartoffeln in sich hinein und blinzelte verständnislos die Grammatik an.
»Mehr Kartoffeln, Kleiner?«, fragte Mrs Piper.
»Nein, danke.« Das schwere Essen und die kleine Schrift seiner Lektüre machten ihn schläfrig. Sein Kopf pochte; was er wirklich brauchte, war ein ausgedehntes Nickerchen.