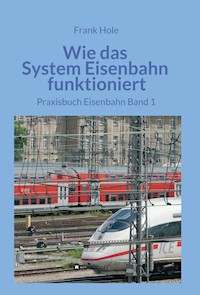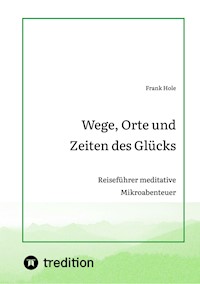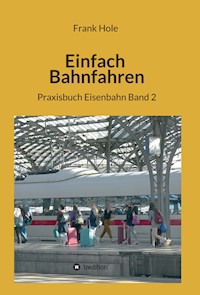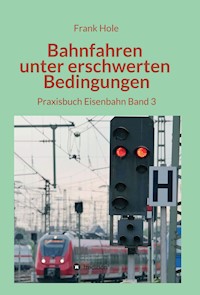
15,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Bildung
- Serie: Praxisbuch Eisenbahn
- Sprache: Deutsch
Planänderungen, Qualitätsmängel und Unregelmäßigkeiten gehören zur Bahn, ob man will oder nicht. Die gute Nachricht: Es gibt häufig Möglichkeiten, vorzubeugen oder die persönliche Betroffenheit zu verringern. Ausführlich werden alle wichtigen Themen behandelt, die sich um die Schattenseite der Bahn drehen: Verspätungen, Zugausfälle, Haltausfälle, Streckensperrungen, Anschlussverluste, Gleisänderungen, Busnotverkehr, Informationsdefizite, überfüllte Züge, umgekehrte Wagenreihung und technische Defekte verschiedenster Art. Gefährliche Situationen und die Einflüsse auf die Bahn werden in jeweils eigenen Kapiteln beschrieben, und die Fahrgastrechte spielen praktisch durchgehend eine Rolle. Doch es bleibt nicht bei der Beschreibung alleine: Immer geht es ganz praxisnah darum, was man als Fahrgast in der jeweiligen Situation tun kann, was die Bahn tut, und - ebenso wichtig - wie man vorbeugen kann. Zahlreiche konkrete Beispiele und 65 überwiegend farbige Abbildungen verdeutlichen die Sachverhalte, die in möglichst verständlicher Sprache beschrieben sind. Der Autor nimmt eine kritisch - konstruktive Haltung ein und wendet sich an alle Fahrgäste, die möglichst gut und gerne Bahn fahren wollen und deren Vorteile trotz mancher Unannehmlichkeiten nutzen möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Autor
Frank Hole, Jahrgang 1965, ist seit 1999 in unterschiedlichen, überwiegend leitenden Funktionen bei DB Regio, S-Bahn München, Omnibusverkehr Franken sowie im Verkehrsverbund VGN tätig. Als Pendler und auf Geschäftsund Urlaubsreisen sammelte er jahrzehntelange Erfahrungen mit der Bahn in Deutschland und Europa.
In dieser Buchreihe „Praxisbuch Eisenbahn“ sind erschienen:
Band 1: Wie das System Eisenbahn funktioniert
Band 2: Einfach Bahnfahren
Band 3: Bahnfahren unter erschwerten Bedingungen
Frank Hole
Praxisbuch EisenbahnBand 3
BahnfahrenuntererschwertenBedingungen
© 2020 Frank Hole
www.praxisbuch-eisenbahn.de
Layout und Umschlaggestaltung: Frank Hole
Korrektorat und Lektorat: Dr. Grit Zacharias (www.umwelt-lektorat.de)
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-04353-4
e-Book:
978-3-347-04355-8
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation innerhalb der Deutschen Nationalbibliografie. Informationen: www.dnb.de.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Dieses Werk wurde vom Autor mit größter Sorgfalt erarbeitet und recherchiert. Eine Gewährleistung für die Aktualität und Richtigkeit der Informationen, Empfehlungen und Aussagen kann jedoch nicht übernommen werden.
Inhalt
Einleitung
1 „… trifft zehn Minuten verspätet ein …“
1.1 Was Sie als Fahrgast bei Verspätungen tun können
1.1.1 Maßnahmen vor der Fahrt
1.1.2 Informieren
1.1.3 Informationen einordnen
1.1.4 Entwicklung einschätzen
1.1.5 Persönliche Betroffenheit bewusst machen
1.1.6 Entscheidung treffen
1.1.7 Verspätungsvermeidend verhalten
1.2 Was die Bahn tut
1.2.1 Information der F ahrgäste
1.2.2 Disposition der Züge und Personale
1.2.3 Betriebliche Spielräume nutzen
1.2.4 Verspätungsursache beheben
1.2.5 Vorausschauend planen
1.2.6 Reserven einsetzen
1.2.7 Aufklärung über Verspätungsursachen
1.2.8 Analysieren und Maßnahmenpläne erarbeiten
1.3 Beispiele aus der Praxis
1.3.1 Ein Intercity gerät unterwegs in eine Signalstörung
1.3.2 Ein Fernverkehrszug wird verspätet bereitgestellt
1.4 Hintergründe und Zusammenhänge
1.4.1 Verspätungsursachen
1.4.2 Pünktlichkeit von Nah- und Fernverkehr gesamt
1.4.3 Pünktlichkeit von S-Bahnsystemen
1.4.4 Pünktlichkeit des Regionalverkehrs
1.4.5 Die Prognose von Verspätungen
1.4.6 Perspektiven
2 „… fällt heute leider aus …“
2.1 Was Sie als Fahrgast bei einem Zugausfall tun können
2.1.1 Maßnahmen vor der Fahrt
2.1.2 Informieren
2.1.3 Informationen einordnen
2.1.4 Handlungsmöglichkeiten mit Fahrtalternativen
2.1.5 Entscheidung ohne zeitnahe Fahrtalternativen
2.2 Was die Bahn tut
2.2.1 Information der F ahrgäste
2.2.2 Folgen des Zugausfalls minimieren
2.2.3 Reserven aufbauen und nutzen
2.2.4 Ursache für den Zugausfall beheben
2.2.5 Analysieren und Maßnahmenpläne erarbeiten
2.3 Konkrete Beispiele
2.3.1 Zugausfall IC 209 mit Ersatzzug
2.3.2 Teilausfall bei der S-Bahn München
2.4 Hintergründe und Zusammenhänge
2.4.1 Die Sicht des Unternehmens
2.4.2 Der Ersatzzug
2.4.3 Organisatorische Leistungen hinter den Kulissen
2.4.4 Ausfallursachen des SPNV in Bayern
2.4.5 Ausfallursachen der S-Bahn Stuttgart
2.4.6 Die Häufigkeit von Zugausfällen
2.4.7 Perspektiven
3 „… heute ohne Halt in …“
3.1 Was Sie als Fahrgast bei einem Haltausfall tun können
3.1.1 Maßnahmen vor der Fahrt
3.1.2 Im Zug
3.1.3 Im Bahnhof
3.2 Was die Bahn tut
3.2.1 Information der F ahrgäste
3.2.2 Folgen des Haltausfalls minimieren
3.2.3 Ursachen für den Haltausfall beheben
3.2.4 Standards erarbeiten
3.3 Konkrete Beispiele
3.3.1 Sperrung des Frankfurter Hauptbahnhofs
3.3.2 Ungeplante Sperrung München Hbf–München Ost
3.3.3 Geplanter Ausfall des Halts in Hohen Neuendorf West
3.4 Hintergründe und Zusammenhänge
4 „… aufgrund einer Streckensperrung …“
4.1 Was Sie als Fahrgast bei einer Streckensperrung tun können
4.1.1 Maßnahmen vor der Fahrt
4.1.2 Informieren
4.1.3 Informationen einordnen
4.1.4 Möglichkeiten bei geplanten Streckensperrungen
4.1.5 Möglichkeiten bei ungeplanten Streckensperrungen
4.2 Was die Bahn tut
4.2.1 Information der F ahrgäste
4.2.2 Ursache der Streckensperrung beheben
4.2.3 Disposition der Züge und Personale
4.2.4 Planerische Spielräume nutzen
4.2.5 Analysieren und Maßnahmenpläne erarbeiten
4.3 Konkrete Beispiele
4.3.1 Streckensperrung Ingolstadt–München
4.3.2 Streckensperrung bei der S-Bahn München
4.4 Hintergründe und Zusammenhänge
4.4.1 Hauptursachen
4.4.2 Wesentliche Folgen
4.4.3 Umleitungen
4.4.4 Zugbezogene Fahrgastinformation
5 „… konnte leider nicht warten …“
5.1 Was Sie als Fahrgast bei gefährdetem Anschluss tun können
5.1.1 Maßnahmen vor der Fahrt
5.1.2 Informieren
5.1.3 Weitere Möglichkeiten
5.2 Was die Bahn tut
5.3 Konkretes Beispiel
5.4 Hintergründe und Zusammenhänge
5.4.1 Die Planung von Anschlusszeiten
5.4.2 Wartezeitregelungen
5.4.3 Destabilisierung von Netzen
5.4.4 Anschlusssicherheit in Zahlen
6 „… fährt abweichend auf Gleis 2 ein …“
6.1 Was Sie als Fahrgast bei einem Gleiswechsel tun können
6.2 Was die Bahn tut
6.3 Konkrete Beispiele
6.3.1 München Hbf: Gleisänderung mit optimaler Information
6.3.2 München Hbf: Gleisänderung mit Informationsmängeln
6.4 Hintergründe und Zusammenhänge
7 Ein Bus wird vielleicht kommen
7.1 Was Sie als Fahrgast bei Busnotverkehr tun können
7.1.1 Maßnahmen vor der Fahrt
7.1.2 Orientierung verschaffen
7.1.3 Aktiv Informationen einholen:
7.1.4 Entscheidung treffen
7.1.5 Weitere Hinweise zu Busnotverkehren
7.2 Was die Bahn tut
7.2.1 Informieren
7.2.2 Organisation des Busnotverkehrs
7.2.3 Konzepte entwickeln
7.3 Konkretes Beispiel: BNV bei der Südostbayernbahn
7.4 Hintergründe und Zusammenhänge
8 „… derzeit liegen keine Informationen vor …“
8.1 Was Sie als Fahrgast bei Informationsdefiziten tun können
8.1.1 Maßnahmen vor der Fahrt
8.1.2 Informationen beurteilen
8.1.3 Wirksamkeit der Störung ableiten
8.1.4 Alternativen prüfen und entscheiden
8.2 Was die Bahn tut
8.2.1 Kommunikationskanäle aufbauen
8.2.2 Organisation ausrichten
8.2.3 IT ausrichten
8.3 Konkrete Beispiele
8.3.1 Streckensperrung bei der S-Bahn Stuttgart
8.3.2 Streckensperrung Essen–Mühlheim (Ruhr) Hbf
8.4 Hintergründe und Zusammenhänge
8.4.1 Betriebliche Situationen
8.4.2 Konkrete Ursachen
8.4.3 Perspektive
9 „… bitte ins Wageninnere durchgehen …“
9.1 Was Sie als Fahrgast bei überfüllten Zügen tun können
9.1.1 Maßnahmen vor der Fahrt
9.1.2 Planen
9.1.3 Unterwegs
9.2 Was die Bahn tut
9.2.1 Planen
9.2.2 Nachfrage steuern
9.2.3 Kapazitäten erhöhen
9.3 Konkrete Beispiele
9.4 Hintergründe und Zusammenhänge
9.4.1 Die subjektive Sicht
9.4.2 Die objektive Sicht
9.4.3 Situationen mit absolut überfüllten Zügen
9.4.4 Auslastung der Fernverkehrszüge
9.4.5 Auslastung der Nahverkehrszüge
9.4.6 Perspektive
10 „… verkehrt heute in umgekehrter Wagenreihung …“
10.1 Was Sie als Fahrgast tun können
10.1.1 Maßnahmen vor der Fahrt
10.1.2 Orientieren
10.1.3 Allgemeine Hinweise und Tipps
10.2 Was die Bahn tut
10.3 Konkretes Beispiel: Flügelzug ICE 1600
10.4 Hintergründe und Zusammenhänge
11 „… aufgrund eines technischen Defekts …“
11.1 Fehlende Wagen
11.1.1 Was Sie tun können
11.1.2 Was die Bahn tut
11.1.3 Hintergründe und Zusammenhänge
11.2 Fehlende Platzreservierung
11.3 Klimaanlage und Heizung defekt
11.4 Toilette nicht in Betrieb
11.5 Türe nicht funktionsfähig
11.6 Fahrkartenautomaten außer Betrieb
11.6.1 Was Sie tun können
11.6.2 Was die Bahn tut
11.6.3 Hintergründe und Zusammenhänge
12 „Vorsicht am Bahnsteig, der Zug fährt ein!“
12.1 Den Gleisbereich nie ungesichert betreten
12.2 Am Bahnsteig volle Aufmerksamkeit
12.2.1 Was kann konkret passieren?
12.2.2 Unbeabsichtigtes Betreten des Gefahrenbereichs
12.2.3 Fahrlässiges Verhalten
12.2.4 Beispiel: Eichstätt Bahnhof
12.3 Von Bahnstromleitungen fernhalten
12.4 Zugtüren während der Fahrt geschlossen halten
12.5 Vorsicht beim Spalt zwischen Tür und Bahnsteig
12.6 Rauchverbot in den Zügen beachten
12.7 Verhalten bei Gefahr im Zug
12.8 Verhalten bei Gefahr im Bahnhof
12.9 Zugevakuierungen auf freier Strecke
13 Einflüsse auf die Bahn
13.1 Bauarbeiten
13.1.1 Anlässe und Ursachen
13.1.2 Planung, Durchführung und Auswirkungen
13.1.3 Gesetzmäßigkeiten bei Baustellen
13.1.4 Die Dimensionen von Bauarbeiten
13.1.5 Perspektive
13.2 Menschen: Fahrgäste
13.2.1 Verhalten beim Ein- und Aussteigen
13.2.2 Medizinische Notfälle
13.2.3 Abkürzung über die Gleise
13.2.4 Eingriffe in den Bahnverkehr
13.2.5 Resümee
13.3 Menschen: Nicht-Fahrgäste
13.3.1 Suizide
13.3.2 Personen im Gleis
13.3.3 Weitere Ursachen
13.4 Menschen: Personal
13.4.1 Streik
13.4.2 Fehlendes Fahrpersonal
13.5 Wetter
13.5.1 Herbst: Rutschige Schienen
13.5.2 Winter: Kälte, Schnee und Eis
13.5.3 Sommer: Hitze, Brände, defekte Klimaanlagen
13.5.4 Extremereignisse: Stürme und Orkane
13.5.5 Extremereignisse: Hochwasser und Gewitter
13.6 Technik
13.7 Bahnübergänge
13.7.1 Langsamfahrstellen an Bahnübergängen
13.7.2 Unfälle an Bahnübergängen
13.8 Folgeverspätungen
13.9 Öffentlichkeit
13.9.1 Wirkungsmechanismen der Öffentlichkeit
13.9.2 Beispiel: Gräfenbergbahn
14 Unterm Strich
14.1 Fachlich: Allgemeine Schlussfolgerungen
14.2 Fachlich: Konkrete Zusammenhänge
14.3 Subjektiv: Die Einschätzung der Kunden
14.3.1 Der ÖPNV in deutschen Großstädten
14.3.2 Kundenzufriedenheitsstudie des VCD
14.3.3 Die Deutsche Bahn
14.3.4 Der SPNV im VBB
14.3.5 Schlussfolgerungen
14.4 Politisch: Forderungen
14.5 Die persönliche Einstellung des Autors
14.5.1 Meine Einstellung zur Bahn
14.5.2 Meine persönlichen Konsequenzen
14.6 Was machen Sie ganz persönlich daraus?
14.6.1 Situation analysieren
14.6.2 Handeln
14.6.3 Rückmeldung an das Verkehrsunternehmen geben
14.6.4 Wählen und sich engagieren
14.6.5 Einige Aufgaben der persönlichen Art
15 TOP 5
15.1 Vorbeugend
15.2 In der Situation
15.3 Strategische Fragestellungen
15.4 Die besten Informationsquellen
15.5 Für eine angenehme Reise
16 Nachwort
Anmerkungen und Quellennachweise
Vorwort
Unregelmäßigkeiten bei der Bahn – jeder Fahrgast ist selbst immer mal wieder davon betroffen, und alle Bundesbürger reden mit. Es gibt wohl nur wenige Themen, abgesehen von Finanzamt, Beamten und Bundesliga, über die man sich in Deutschland so gern aufregt wie über die Unfähigkeit der Bahn, ihre eigenen Pläne einzuhalten.
Wie schlimm ist die Situation wirklich? Entspricht die Bahn ihrem miserablen Image oder ist dies nicht eher eine Folge der von Medien und dramatisch ausgeschmückten persönlichen Erzählungen geschaffenen Wahrnehmung?
Lange habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ob dieser dritte Band des „Praxisbuchs Eisenbahn“ wirklich nötig ist, ob er nicht einen völlig falschen Akzent setzt und vielleicht eher abschreckt als zum Bahnfahren motiviert. Leider ist es nach meiner Einschätzung jedoch nicht möglich, die Zahl und Auswirkungen der Unregelmäßigkeiten im Bahnsystem Deutschlands zu einer vernachlässigbaren Randgröße schrumpfen zu lassen.
Es ist allerdings möglich, damit konstruktiv umzugehen. Ein differenzierter Blick, eine nüchterne Beurteilung kann helfen, Emotionen aus den Themen herauszunehmen und das System Bahn nicht als Ganzes abzulehnen, sondern trotzdem bestmöglich zu nutzen. Mein Anliegen ist, dass Sie möglichst entspannt mit der Bahn unterwegs sein können.
Ich möchte Ihnen in diesem Band 3 alle Informationen geben, die Ihnen helfen werden, trotz der unbestreitbar vorhandenen Unregelmäßigkeiten wie Zugausfälle, Verspätungen und Qualitätsmängel möglichst gut klarzukommen. Noch besser: Sie können oft sogar vorbeugen und bestimmte Situationen vermeiden. Dazu gehört ein Verständnis über deren Ursachen, Folgen und vor allem ihrer Zusammenhänge. Es gehört auch dazu, die Unregelmäßigkeiten in einen Gesamtzusammenhang einzuordnen.
Dieses Buch ist für Sie geschrieben, wenn Sie sich als Fahrgast dem Bahnsystem ausgeliefert fühlen, überwiegend negative Erfahrungen machen, sich oft darüber ärgern und keine Abhilfe wissen –daran aber nach Möglichkeit etwas ändern wollen. Es ist auch für alle geschrieben, die vom Auto oder Flugzeug auf die Bahn umsteigen und Unannehmlichkeiten von vornherein vermeiden wollen. Ich verzichte deswegen weitgehend auf Fremdwörter, Bahnjargon und Abkürzungen. Zahlreiche Praxisbeispiele und Abbildungen verdeutlichen meine Aussagen und machen sie nachvollziehbar.
Nach meinem Verständnis gibt es kein perfektes Verkehrsmittel. Im Straßenverkehr haben Sie es mit im Vergleich zur Bahn extremen Umwelt- und Sicherheitsproblemen zu tun, von Staus, Parkplatzsuche, dem hohen finanziellen und organisatorischen Aufwand, dem Stress und der verlorenen Lebenszeit ganz zu schweigen. Bei der Bahn fallen viele dieser negativen Dinge weg, Sie haben es stattdessen mit anderen Themen zu tun. Wenn Sie sich jedoch mit diesen etwas auseinandersetzen, können Sie die Bahn in vielen Situationen deutlich einfacher, besser und entspannter nutzen und die Qualität Ihrer Mobilität stark verbessern.
Einleitung
Bahnfahren kann so schön sein!
In den Zug setzen, die Gedanken ziehen lassen, die Landschaft oder ein gutes Buch genießen, in Ruhe arbeiten und am Ziel entspannt aussteigen.
Das ist die Hoffnung vieler Fahrgäste, und in vielen Fällen klappt das sehr gut. Doch es gibt auch zahlreiche Beispiele, bei denen es anders läuft. Und hört man die Erzählungen mancher Pendler oder liest die Berichte in den Zeitungen, so sind Störungen nicht nur an der Tagesordnung, sondern ist Chaos der Regelzustand.
Als Ursachen werden, je nach Wissensstand und Einstellung, die Unfähigkeit des Bahnvorstands, die verfehlte Verkehrspolitik, die EU-Gesetzgebung oder die Unwilligkeit der Lokführerinnen und Lokführer benannt, die nur Dienst nach Vorschrift schieben.
Das mögen alles Ansätze sein, sie helfen als wirkliche Erklärung im konkreten Fall allerdings nicht weiter. Und schon gar nicht nützen sie dabei, an einer misslichen Situation etwas zu verändern, in der sich der einzelne Fahrgast möglicherweise befindet. Sie helfen auch nicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Die Wahrnehmung der Bahn ist sehr stark davon abhängig, wie oft, auf welchen Strecken und zu welchen Zeiten Sie unterwegs sind. Wenn Ihre Erfahrungen überwiegend negativ sind, dann haben Sie diese gemacht und es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln. Wie Sie diese jedoch bewerten und was Sie daraus machen, ist ein eigenes Thema. Umgekehrt gibt es auch Pendlerinnen und Pendler, die jeden Tag einen Sitzplatz finden und fast immer pünktlich ankommen, von zwei oder drei Ausnahmen im Jahr abgesehen.
Woran das liegt, das ist Thema dieses Buchs. Was dann jeder Fahrgast konkret in der jeweiligen Situation tun kann, das ist ebenfalls Schwerpunkt in diesem Band, und es geht auch darum, welche Maßnahmen die Bahn ergreift, um störende Einflüsse und deren Folgen zu minimieren.
Interessant wird es, wenn es darum geht, die Wurzeln der Unregelmäßigkeiten zu verstehen und dann anzupacken. Diese Themen sind in der Regel vielschichtig und hochkomplex.
Es ist zum Beispiel illusorisch, zu glauben, man könne der Bahn anordnen, dass sie pünktlicher fahren soll, und dass dies dann innerhalb von ein paar Wochen möglich wäre. Oder dass in den Hauptverkehrszeiten einfach zusätzliche Züge verkehren sollen, um mehr Platz zur Verfügung zu stellen.
Grundsätzliche Änderungen brauchen im Bahnsystem Jahre bis Jahrzehnte, bis sie geplant, beschlossen, finanziert und umgesetzt sind.1 Um an die Ursachen der tatsächlichen, gefühlten oder zumindest durch die Medien beschworenen Unzuverlässigkeit zu kommen, sind nach dem jahrzehntelangen Abbau der Bahn umfangreiche Investitionsmaßnahmen nötig. Und dazu wiederum benötigt man einen Konsens in der Bevölkerung, dass die Bahn wichtig und Teil einer Lösung der großen Umwelt- und Verkehrsprobleme ist. Und dann brauchen die jeweiligen Regierungen den entsprechenden Auftrag.
Bis diese langfristig umzusetzenden Maßnahmen angepackt werden und Wirkung zeigen, führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass all die zahlreichen Menschen, die die Bahn nutzen, sich mit der heutigen Situation bestmöglich arrangieren müssen. Dazu gibt es glücklicherweise einige vielversprechende Möglichkeiten. Und die lernen Sie nun kennen, ergänzt um viele Hintergrundinformationen und praktische Beispiele.
Ziel ist es, dass Sie möglichst souverän und selbstbestimmt mobil sind. Dazu gehört es, Planabweichungen und Störungen im Betriebsablauf idealerweise bereits vorab zu erkennen und zu vermeiden. Und wenn Sie sich doch in einer derartigen, unangenehmen Situation befinden sollten, dass Sie sich über Ihre Handlungsmöglichkeiten im Klaren sind und eine eigene Entscheidung treffen können.
Es geht um nichts weniger, als dass Sie immer möglichst gut unterwegs sind!
1 „… trifft zehn Minutenverspätet ein …“
Zugverspätungen kennen alle Fahrgäste. „Pünktlich wie die Eisenbahn“ – dieser Spruch gilt nur bedingt. Leider müssen Sie die Möglichkeit von Verspätungen bei Ihrer Reiseplanung berücksichtigen, auch wenn – insgesamt betrachtet – die meisten Züge pünktlich ankommen.
In diesem Kapitel geht es darum, was jeder Fahrgast selbst tun kann, um diese Erfahrungen entweder möglichst selten zu machen oder deren Auswirkungen auf sich selbst zu verringern. Thema ist auch der übergeordnete Blick: Wie lassen sich die Fahrplanabweichungen in das gesamte Bahngeschehen einordnen? Wer die zahlreichen Ursachen für Verspätungen verstehen will, findet in Kapitel 13.1 bis 13.8 die wichtigsten Zusammenhänge.
1.1 Was Sie als Fahrgast bei Verspätungen tun können
1.1.1 Maßnahmen vor der Fahrt
Schon bei der Reiseplanung empfiehlt es sich, dass Sie sich im Klaren darüber sind, wie WICHTIG die Pünktlichkeit für Sie im Allgemeinen und speziell bei der nächsten Fahrt ist. Wer wirklich richtig pünktlich sein muss, sei es zu einem geschäftlichen Termin, zum Beginn eines einzigartigen Konzerts mit Ihrer Partnerin oder einem entscheidenden Bundesligaspiel, sollte deutliche Spielräume einplanen und keinesfalls glauben, dass eine perfekte minutengenaue Planung funktioniert. Eine Planung ohne Spielräume kann klappen und wird in vielen Fällen auch aufgehen, sie muss aber nicht. Und für Pendlerinnen und Pendler kann ein Zug früher eine große Entspannung bewirken – alternativ die Vereinbarung von Gleitzeit bei der Arbeit.
Zur Planung gehört auch, die WAHRSCHEINLICHKEIT VON VERSPÄTUNGEN einzuschätzen. Zur Hauptverkehrszeit sind Verspätungen wahrscheinlicher, und wenn Baustellen auf Ihrer Strecke liegen, ebenfalls. Dicht befahrene Strecken mit Mischverkehr und solche mit knapp bemessenen Umläufen sind ebenfalls anfälliger.
Es gibt auch eine Datenquelle, die wertvolle Hinweise liefert: die PÜNKTLICHKEITSSTATISTIK vieler Fernverkehrszüge. Zum Beispiel steht dort, dass der IC 2024 Passau–Hamburg über Mainz im Durchschnitt der letzten zwei Jahre auf jeder Fahrt 22 Minuten Verspätung einfuhr, der ICE 1553 Leipzig–Dresden hingegen mit durchschnittlich 1 Minute Verspätung ein sehr pünktlicher und zuverlässiger Zug ist.2
Ebenfalls sind, wo immer möglich und sinnvoll, DIREKTVERBINDUNGEN günstiger. Damit entfallen Anschlussverluste automatisch, die oft eine Stunde Zeitverlust bedeuten. Alternativ sind auch STABILE UMSTEIGEVERBINDUNGEN empfehlenswert, bei denen es nicht um ein oder zwei Minuten Umsteigezeit geht, sondern eher um 10 bis 15 Minuten bei kleineren Knotenbahnhöfen und 20 bis 30 Minuten bei großen Hauptbahnhöfen.
Mit größeren Spielräumen zu planen heißt auch, die dann häufiger auftretenden Aufenthaltszeiten mit positiv besetzten Aktivitäten zu füllen: einen Spaziergang unternehmen oder in Ruhe zu Mittag essen, telefonieren, in der Buchhandlung stöbern – hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Wenn GRAVIERENDE WETTEREREIGNISSE wie ein Orkan über Norddeutschland oder massive Schneefälle mit Sturm und Blitzeis in Sachsen angekündigt sind, sind solche Wetterwarnungen durchaus ernst zu nehmen, zusätzlich ist es wahrscheinlich, dass in beiden Fällen spürbare Verspätungen und Ausfälle von Fernverkehrszügen auch im restlichen Deutschland vorkommen.
GROßVERANSTALTUNGEN (bekannte Publikumsmessen, Bundesliga-Fußballspiele, Kölner Karneval, Oktoberfest, Papstbesuch) sorgen nicht nur für volle Züge, sondern auch für spürbare Verspätungen. Das bedeutet konkret, entweder die betroffenen Strecken und Ziele vollständig zu vermeiden oder früher zu fahren.
1.1.2 Informieren
Sie werden im Internet, in Ihrer App, per Durchsage im Zug oder auf dem Bahnsteig und im Bahnhof mittels Durchsage und/oder Monitore über die Verspätung informiert. Reisende sollten deswegen, wie in Band 2 in den Kapiteln 18 und 19 bereits erarbeitet, alle auf die eigene Situation zugeschnittenen, geeigneten INFORMATIONSQUELLEN kennen und griffbereit haben. Wer beispielsweise die Fahrt mit der DB-Fahrplanauskunft geplant hat, kann im Rahmen der Verbindungssuche den VERSPÄTUNGSALARM aktivieren oder mit der APP „DB STRECKENAGENT“ Verkehrsmeldungen zur jeweiligen Strecke abonnieren.3 Auch die Abfahrten von Bahnhöfen und Haltestellen sind einfach abrufbar.4 Derartige Tools gibt es teilweise auch bei anderen EisenbahnVerkehrs-Unternehmen und in Verkehrsverbünden.5 Es sind sogar vereinzelt recht komfortable und aussagekräftige kartografische Informationsmedien auf dem Markt, die die Position der Züge in Echtzeit in einer Karte darstellen.6
1.1.3 Informationen einordnen
Gehen Sie allerdings davon aus, dass die Angabe über die aktuelle Verspätung zwar exakt sein kann, aber die Prognose immer nur eine ungefähre EINSCHÄTZUNG ist. Denn die Einflussfaktoren und Wechselwirkungen sind beim Bahnbetrieb zu groß, als dass es immer eine wirklich sichere, minutengenaue Vorhersage geben kann.
Generell ist zwischen zugbezogenen Informationen und qualitativen Störungsinformationen zu unterscheiden.
• ZUGBEZOGENE INFORMATIONEN: Hier erhalten Sie über einen bestimmten Zug mit einer bestimmten Zugnummer konkrete Informationen über Zugziel, Laufweg, Abfahrtszeit, Gleis und Verspätung/Ausfall.
• QUALITATIVE STÖRUNGSINFORMATIONEN: Sie bekommen Informationen über Ursache, Ort, Dauer und Auswirkung der Störung. Diese Art der Information ist in der Regel recht schnell vorhanden und häufig auch zuverlässig. Sie gibt wichtige Anhaltspunkte, wie sich die Situation darstellt und entwickelt und welche Handlungsoptionen möglicherweise existieren.
Abbildung 1: Ein Beispiel für qualitative und nicht zugbezogene Information: Auf dem Monitor erkennen Sie auf den ersten Blick, dass wegen Bauarbeiten für rund 7 Wochen kein Zugverkehr im Regionalbahnhof des Frankfurter Flughafens möglich ist. Stattdessen fährt die S-Bahnlinie S8 über den Flughafen Fernbahnhof. Außerdem ist ein Ersatzverkehr eingerichtet, der von Rüsselsheim über Raunheim und Kelsterbach zum Terminal 1 fährt. Streng genommen sind Baustellen allerdings keine Störungen, sondern geplante Abweichungen.7 [Copyright Frank Hole]
Die Rangliste der Qualität von zugbezogenen Informationen bei Fahrplanabweichungen sieht so aus:
1. ZUVERLÄSSIG, wenn bei kleineren Störungsereignissen nur wenige Züge gering betroffen sind. Sie bekommen Informationen wie „… trifft wenige Minuten später ein“ oder „… hat ungefähr 5 Minuten Verspätung“.
2. EINGESCHRÄNKT ZUVERLÄSSIG, wenn auf einer Strecke ein größerer Einfluss stattfindet, der beispielsweise zu einer Streckensperrung führt und viele Züge betroffen sind oder einige relativ stark. Die Informationen können lauten „… hat ungefähr 25 bis 30 Minuten Verspätung“ oder „wegen Gleisbelegung im Bahnhof … verzögert sich unsere Einfahrt noch um kurze Zeit“.
3. UNZUVERLÄSSIG, wenn ein Ereignis mit größeren Folgen wie beispielsweise einer Streckensperrung sich erst vor Kurzem ereignet hat und noch keine konkreten Gegenmaßnahmen getroffen wurden, weil die Auswirkungen des Einflusses noch unbekannt sind. Oder es überlagern sich mehrere Störungsquellen. Die entsprechende Durchsage kann lauten: „Wir informieren Sie, wenn neue Informationen vorliegen.“ Im Internet können Sie erkennen, dass sich solche Verspätungsprognosen immer wieder ändern.
4. NICHT MÖGLICH ODER VOLLSTÄNDIG UNZUVERLÄSSIG: Bei Großstörungen8, wenn mehrere Bahnstrecken oder Linien zeitgleich unterbrochen sind. Bei großen Störungsereignissen sind Dutzende oder gar Hunderte von Zügen zeitgleich betroffen, die alle in Wechselwirkung miteinander stehen. Zugbezogene Informationen sind in solchen Fällen so unpräzise oder liegen gar nicht in den Hintergrundsystemen vor, dass sich die Fahrgäste darauf nicht verlassen könnten. Deswegen wird in aller Regel völlig darauf verzichtet und Sie sehen auf Anzeigern nur noch die Information „Bitte auf Ansagen achten“ oder „Zugbetrieb eingestellt“. Sollten bei derartigen Betriebslagen dennoch zugbezogene Informationen kommuniziert werden, so sind diese keinesfalls verlässlich. Es könnte sein, dass diese nur noch der Planzustand auf den Monitoren oder in den Onlinemedien abbilden, nicht aber die Realität.
Je größer die betrieblichen Auswirkungen, desto weniger präzise die zugbezogenen Informationen und desto wichtiger werden die qualitativen Störungsinformationen.
Wenn die Verspätungsursache bekannt ist, geht es darum, diese mittels folgender Fragen einzuordnen:
• Ist die Ursache bereits behoben?
• Welcher Art ist die Ursache?
• Besteht die Ursache fort und ist sie von unbestimmter Dauer oder können Sie eine ungefähre Prognose wagen?
• Ist Ihr Zug von der Ursache direkt betroffen oder steht er im Stau?
• Gibt es möglicherweise Fahrtalternativen vor Fahrtantritt? Bietet sich eventuell unterwegs eine Möglichkeit?
1.1.4 Entwicklung einschätzen
Wer in einem verspäteten Zug sitzt oder am Bahnsteig auf diesen wartet, kann sich klarmachen, welche Entwicklung die Verspätung möglicherweise nehmen wird:
1. SIE WIRD KLEINER. Wenn der Zug verspätet abfährt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er an Ihrem Zielbahnhof auch nicht pünktlich ist. Nach den Erfahrungen des Autors kommt es in vielleicht einem Viertel der Fälle vor, dass ein Zug eine Verspätung wieder einholt und dann ganz oder fast pünktlich ankommt. Ob ein Aufholen der Verspätung möglich ist, hängt letztlich von folgenden Faktoren ab:
o Gibt es Spielräume im Fahrplan? Das ist nicht oft, aber immerhin manchmal der Fall. Diese Einschätzung können Sie nur durch einige Erfahrung treffen.
o Hat ein Zug an einem Bahnhof planmäßig mehrere Minuten Aufenthalt, die ggf. verringert werden können?
o Sind weniger Fahrgäste unterwegs, sodass die Aufenthaltszeiten an Bahnhöfen jeweils etwas verkürzt werden können? Insbesondere spätabends und nachts stehen die Chancen recht gut.
o Liegt die Verspätungsursache räumlich gesehen hinter oder vor Ihrem Zug? Falls sie hinter Ihnen liegt, gibt es etwas bessere Chancen, dass sich die Verspätung reduziert.
o Und natürlich geht es auch um die Größe der Verspätung im Verhältnis zur Reisedauer. Eine Viertelstunde Verspätung lässt sich auf einer achtstündigen Fahrt quer durch Deutschland eher aufholen als eine fünfminütige Verspätung einer halbstündigen S-Bahnfahrt.
2. SIE BLEIBT UNGEFÄHR GLEICH. Das ist bei etwa der Hälfte der verspäteten Züge der Fall. Wenn der Fahrplan wenig Spielräume aufweist und die Aufenthaltszeiten an Bahnhöfen knapp bemessen sind, dann wird Ihr Zug kaum aufholen können.
3. SIE WIRD GRÖßER. In vielleicht einem Viertel der Fälle nimmt die Verspätung unterwegs spürbar zu. Mögliche Gründe:
o Der verspätete Zug kann in sein normales Gleis im nächsten Bahnhof nicht einfahren, weil dieses nun durch einen pünktlichen Zug belegt ist.
o Der verspätete Zug fährt hinter einem pünktlichen, aber langsameren Zug her und kann nicht überholen.
o Der verspätete Zug wird durch einen pünktlichen überholt.
o Oder es kommt noch eine weitere Verspätungsursache hinzu, z. B. deutlich erhöhtes Fahrgastaufkommen aufgrund des Ausfalls des Zuges einen Takt früher.
o Die Verspätungsursache (z. B. eingleisiger Streckenabschnitt wegen Bauarbeiten oder ein Signalausfall) liegt noch vor Ihnen.
o Oder Sie sind zur Hauptverkehrszeit unterwegs, die Strecke ist mit Zügen dicht belegt und die Züge sind allesamt voller Fahrgäste.
Mit einiger Erfahrung lässt sich leichter einordnen, in welche Kategorie der betreffende Zug fällt. Natürlich gibt es keine wirkliche Garantie dafür, da Sie normalerweise nicht alle relevanten Informationen haben, auch kennen Sie nicht die Entscheidungen der Fahrdienstleiter, der Disponenten des Eisenbahn-Verkehrs-Unternehmens oder der Netzdisponenten. Selbst bahninterne Experten können nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, wie sich eine Fahrt entwickeln wird, da die Komplexität der Wechselwirkungen insbesondere bei größeren Ereignissen zu groß ist.
1.1.5 Persönliche Betroffenheit bewusst machen
Eine wichtige Frage in der jeweiligen Verspätungssituation lautet: WAS BEDEUTET DIE VERSPÄTUNG FÜR MICH KONKRET? Beispielsweise:
• Gar nichts. Wenn kein Termindruck da ist, man sich in einer Direktverbindung befindet, ohnehin eher der entspannte Reisende ist und ein gutes Buch griffbereit ist.
• Anschlussverlust. Dadurch geht vielleicht die Platzreservierung verloren und der nächste Zug kommt erst in einer Stunde und ist dann auch noch überfüllt. Das ist sehr ärgerlich und unbequem dazu.
• Sie verpassen Ihren Flieger nach Tokio und somit den gemeinsamen Beginn einer vierzehntägigen Studienreise oder es entgeht Ihnen ein wichtiger geschäftlicher Termin.
• Das lang vereinbarte Treffen mit einer guten Freundin verkürzt sich.
• Sie kommen zu spät nach Hause, das Essen verkocht und Ihre kleine Tochter müsste eigentlich längst ins Bett, will aber vorgelesen bekommen.
• Sie können in Ruhe Ihre geschäftliche Präsentation fertigmachen, Mails durchgehen und beantworten oder WhatsApp-Nachrichten lesen, wozu Sie sonst nie gekommen wären.
• Es ergeben sich gute Gespräche mit Menschen, denen Sie sonst nie begegnet wären, daraus entwickeln sich Bekanntschaften, neue Ideen und Sie bekommen interessanten Anregungen und Informationen.
Es ist also alles drin – von der gefühlten persönlichen Katastrophe über Unbequemlichkeit bis hin zu positiven oder zumindest nicht unwillkommenen Aspekten. Oft ist das Ärgerlichste an einer Verspätung, dass man sich nicht selbst imstande sieht, Einfluss darauf zu nehmen und dass etwas mit einem geschieht, was man sich nicht gewünscht hat. Auch die Unklarheit, wie und wann es weitergeht und ob nach einem ungeplanten Umsteigen ein Sitzplatz zur Verfügung steht, kann deutliche Verunsicherung und Ärger hervorrufen.
1.1.6 Entscheidung treffen
In vielen Fällen gibt es Wahlmöglichkeiten, was Sie tun können, auch wenn diese nicht Ihren ursprünglichen Plänen entsprechen. In Ihre Entscheidung fließen folgende Aspekte ein:
• Was ist tatsächlich MÖGLICH in der momentanen Situation?
o Wenn der Zug auf freier Strecke für längere Zeit zum Stehen gekommen ist, können Sie nicht aussteigen und zu Fuß zum nächsten Bahnhof gehen.
o Wenn Sie aber von Gerolstein in der Eifel kommen und mittags in Köln Hbf mit 30 Minuten Verspätung eintreffen und nach Dortmund wollen, haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, weiterzufahren. Vielleicht sogar schneller als mit der ursprünglich geplanten Verbindung.
• Was ist in Ihrer Situation SINNVOLL?
Es gibt ganz grundsätzliche WAHLMÖGLICHKEITEN. Diese können auch mit der Anwendung der Fahrgastrechte zu tun haben. Hier gibt es Regelungen ab 20 und ab 60 Minuten Verspätung.9 Die Fahrgastrechte sind teils differenziert je nach benutztem Fahrausweis zu sehen, ferner gelten je nach Verkehrsvertrag und Verbund ggf. andere, weitergehende Regelungen. Die genauen Mindestregelungen können Sie auf einer zentralen Fahrgastrechte-Website nachlesen10, ansonsten in den Beförderungsbedingungen Ihres Eisenbahnverkehrsunternehmens oder – falls Sie mit einer Verbundfahrkarte unterwegs sind – in denen Ihres Verkehrsverbunds.
• FAHRT ANTRETEN BZW. FORTSETZEN. Hinterher können Sie ab 60 Minuten Verspätung über die Fahrgastrechte eine Entschädigung geltend machen.
• MIT EINEM ANDEREN ZUG FAHREN. Das ist ebenfalls im Rahmen der Fahrgastrechte für Verspätungen ab 20 Minuten geregelt.
• FAHRT ABBRECHEN und wieder zurückfahren oder Reise erst gar nicht antreten. Ab 60 Minuten voraussichtlicher Verspätung am Zielort können Sie sich den Fahrpreis über die Fahrgastrechte erstatten lassen.
• MIT EINEM ANDEREN VERKEHRSMITTEL WEITERFAHREN und die Kosten bis zu einem bestimmten Betrag erstattet bekommen. Dies ist in den Fahrgastrechten ebenfalls geregelt, allerdings an einige Konditionen gebunden.
Um sich auf die Fahrgastrechte zu berufen, ist es sinnvoll, wenn auch nicht zwingend nötig, dass Sie sich die Verspätung vom Personal im Zug oder in großen Bahnhöfen bescheinigen lassen. Das wird nicht in allen Fällen möglich sein, z. B. weil das Personal vielleicht gar nicht vorhanden oder von sehr vielen Fahrgästen gleichzeitig beansprucht ist.
Je nachdem, wie wichtig Ihnen die Reise ist und was Ihr Budget ermöglicht, sollten Sie auch in Erwägung ziehen, völlig unabhängig von den Fahrgastrechten zu entscheiden und ggf. höhere Kosten in Kauf zu nehmen um anzukommen. Im Nachgang zu Ihrer Fahrt lässt sich dann möglicherweise noch etwas auf dem Wege der Kulanz regeln.
1.1.7 Verspätungsvermeidend verhalten
Fahrgäste können die Wahrscheinlichkeit von Verspätungen verringern oder deren Folgen abmildern.
• Zügig ein- und aussteigen.
• Am Bahnsteig dort stehen, wo Sie reserviert haben.
• Am Bahnsteig nicht im Pulk warten, sondern gleichverteilt über die gesamte Zuglänge.
• Nicht in sich gerade schließende Türen hineinlaufen oder die Abfertigung verzögern (vgl. Kapitel 6.3 in Band 2 und 4.13 in Band 1).
• Sicherheitsrelevante Eingriffe in den Bahnverkehr unbedingt vermeiden (vgl. Kapitel 12).
• Anderen Reisenden helfen, sofern offensichtlich nötig und gewünscht.
1.2 Was die Bahn tut
Es macht einen Großteil der täglichen Arbeit der Eisenbahn-Verkehrs-Unter- nehmen und der Eisenbahn-Infrastruktur-Unternehmen aus, Verspätungen zu vermeiden, Fahrgäste und Betriebspersonal darüber zu informieren und deren Folgen und Wechselwirkungen gering zu halten.
Die Maßnahmen sind so vielfältig wie die Ursachen, die zu Verspätungen führen (vgl. Kapitel 13 „Einflüsse auf die Bahn“).
Wenn Sie als Fahrgast eine Verspätung erleben, dann arbeiten im Hintergrund immer mehrere Menschen daran, diese zu beheben oder zumindest darüber zu informieren und weitere negative Folgen abzuwenden. Und viele Verspätungen sind erst gar nicht entstanden, weil vorbeugende Maßnahmen wirksam waren.
1.2.1 Information der Fahrgäste
Alle Eisenbahn-Verkehrs-Unternehmen und Eisenbahn-Infrastruktur-Unternehmen sammeln ständig die Informationen zu jeder gerade stattfindenden Zugfahrt und bereiten diese für verschiedene Informationsmedien auf. Konkret geht es bei verspäteten Zügen um die derzeitige Verspätung und die Prognosen für die weiteren Bahnhöfe und um den Grund der Verspätung. Im Endergebnis erhalten die Fahrgäste im Zug, im Bahnhof, im Internet und über entsprechende Apps für die meisten aktuell verkehrenden Züge Echtzeitinformationen – je nach Möglichkeit sowohl optisch als auch akustisch.
Abbildung 2: Auch auf den Monitoren an den Bahnsteigen wird die voraussichtliche Verspätung mitgeteilt. [Copyright Frank Hole]
1.2.2 Disposition der Züge und Personale
Ein verspäteter Zug birgt immer das Risiko, dass er zusätzlich andere Züge verspätet. Deswegen arbeiten die Disponenten daran, dass diese Folgewirkungen möglichst selten eintreten: Sie setzen je nach Höhe der Verspätung zusätzliches Personal ein, tauschen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus, legen ggf. zusätzliche Züge ein, und manchmal lassen Sie verspätete Fahrten ganz oder teilweise ausfallen, um das Gesamtsystem wieder pünktlicher werden zu lassen oder alternativ keine Unpünktlichkeit auf andere Fahrten zu übertragen.
1.2.3 Betriebliche Spielräume nutzen
Auf Strecken, deren Fahrplan relativ großzügig geplant wurde, bestehen gewisse Spielräume, Verspätungen wieder einzuholen. Lokführer setzen im Falle von Verspätungen alles daran, diese Spielräume zu nutzen und wieder pünktlicher zu werden. Konkret reizen sie dann nach Möglichkeit zulässige Höchstgeschwindigkeiten aus, verkürzen Aufenthalte in Bahnhöfen und wenden an Endbahnhöfen zügiger.
1.2.4 Verspätungsursache beheben
Je nach Ursache ist es möglich und notwendig, die Verspätungsursache möglichst schnell zu beheben, damit sich nicht noch weitere Züge verspäten. Wenn beispielsweise eine Signalstörung die Ursache ist, dann kümmern sich ganz unterschiedliche Personale des Eisenbahn-Infrastruktur-Unternehmens darum, die Leit- und Sicherungstechnik schnellstmöglich wieder funktionsfähig zu machen. Wenn Personen im Gleisbereich gesichtet wurden, arbeiten Eisenbahn-Infrastruktur-Unternehmen, Eisenbahn-Verkehrs-Unternehmen und Bundespolizei gemeinsam daran, dass diese aufgegriffen werden, sodass die Strecke wieder mit normaler Geschwindigkeit befahren werden kann.
1.2.5 Vorausschauend planen
Vorbeugend lassen sich durch eine vorausschauende Planung etliche Verspätungen minimieren oder gar vermeiden. Dies gilt beispielsweise für einen Hauptverspätungsgrund – die Baustellen. Je nach Konzept erweisen sich Baustellenfahrpläne als sehr störanfällig – und das kann ein Eisenbahn-Verkehrs-Unternehmen zusammen mit dem Eisenbahn-Infrastruktur-Unternehmen oft schon vorher abschätzen und entsprechend anders planen, sofern die Spielräume gegeben sind (vgl. Kapitel 13.1 Bauarbeiten).
1.2.6 Reserven einsetzen
Manche, zumeist große Eisenbahn-Verkehrs-Unternehmen haben sich gewisse Reserven an Fahrzeugen und Bereitschaften beim Fahrpersonal aufgebaut. Diese können dann im Bedarfsfall eingesetzt werden. So einfach es klingt: In der Praxis ist dies wesentlich schwieriger umzusetzen. Das liegt nicht nur an der Frage, ob der Standort dieser Fahrzeuge und Personale günstig gelegen ist, sodass für einen verspäteten Zug ein Ersatz im regulären Fahrplan fahren kann. Noch wesentlich schwieriger ist es, über diese Fahrzeuge und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt zu verfügen. Das ist eine eindeutig finanzielle Frage, da Ausschreibungen derzeit solche Reserven nur in Ausnahmefällen vorsehen.
1.2.7 Aufklärung über Verspätungsursachen
Die Eisenbahn-Verkehrs-Unternehmen führen je nach Notwendigkeit teils aufwendige Kommunikationsmaßnahmen durch, um fahrgastbedingte Verspätungen nicht entstehen zu lassen (vgl. Kapitel 13.2 „Fahrgäste“).
1.2.8 Analysieren und Maßnahmenpläne erarbeiten
Alle Eisenbahn-Verkehrs-Unternehmen führen Statistiken über Verspätungsursachen und -folgen. So ist es möglich, bestimmte Situationen zu simulieren, deren Ergebnisse – zusammen mit dem Sachverstand von Fahrpersonal, Disponenten, Fahrdienstleitern und Datenanalytikern – letztlich in Maßnahmenplänen münden, die im Idealfall gute Wirkung zeigen. Beispiele hierfür sind der Einsatz von Einstiegslotsen in bestimmten S-Bahnsystemen, der leuchtende Bahnsteig, Aufkleber zum Verhalten beim Ein- und Aussteigen, Engpass-Management, dispositive Regeln bei Verspätungen, Anschlussregelungen, Wendezeitregelungen, der planmäßige Einsatz von zwei Fahrpersonalen oder die Durchführung „überschlagener“ Wenden bei knappen Wendezeiten, Schulung und Sensibilisierung des Personals, Einsatz von Pünktlichkeitsmanagern, geänderte Winterdienstpläne und viele mehr.
1.3 Beispiele aus der Praxis
1.3.1 Ein Intercity gerät unterwegs in eine Signalstörung
Als erstes Beispiel dient die Einsteiger-Bahnreise von Passau nach Köln aus Kapitel 11 in Band 2, die damals völlig problemlos verlaufen ist. Doch für heute sei angenommen, dass unterwegs Unregelmäßigkeiten auftreten, die zu einer spürbaren Verspätung führen.
Sie haben eine Fahrkarte mit Zugbindung für den Intercity 2024. Dieser fährt in Passau pünktlich los und bleibt im Bahnhof von Hanau wegen einer Signalstörung stehen. Dadurch erhält er, so die Prognose um 11.35 Uhr, voraussichtlich 33 Minuten Verspätung.
Abbildung 3: Fahrplan für IC 2024 Passau–Köln mit Angabe der tatsächlichen und prognostizierten Ankunfts- und Abfahrtszeiten, fiktives Beispiel bei der Abfrage in Hanau Hbf. [Copyright Frank Hole11]
Sie lassen sich vom Zugbegleiter die Zugbindung aufheben und die Verspätung bestätigen. Angesichts der prognostizierten Verspätung von 29 Minuten am Zielort ist nun freie Zugwahl möglich.
Der DB Navigator nennt bei der Anfrage Frankfurt Hbf–KÖLN drei ICE-Verbindungen mit Abfahrten um 12: 10, 12.29 und 12.42 Uhr ab Frankfurt Hbf, die alle früher in Köln ankommen als der verspätete IC 2024:
Abbildung 4: Alternative Fahrtmöglichkeiten nach Köln für die ursprüngliche Verbindung mit IC 2024 [Copyright Frank Hole12]
Der ICE der ersten alternativen Verbindung um 12: 10 ist nicht zu schaffen bei einer prognostizierten Ankunft Ihres IC 2024 um 12.09 Uhr. Abgesehen davon wollen Sie auch nicht unbedingt nach Köln Messe/Deutz, sondern zum Hauptbahnhof. Die beiden anderen Verbindungen erscheinen geeigneter.
Der Zug kommt dann tatsächlich um 12.20 Uhr in Frankfurt Hbf mit 44 Minuten Verspätung an, somit ist die Weiterfahrt um 12.29 Uhr mit dem ICE möglich. Zwar ist ein Umsteigen nötig, doch die Ankunft in Köln ist früher als mit dem ursprünglichen IC 2024, wenn er pünktlich gewesen wäre. In der Praxis wird es bei Verspätungen nur in seltenen Fällen schnellere alternative Verbindungen geben, aber ganz ausgeschlossen sind sie nicht.
Woher aber kommen die Informationen über Fahrtalternativen?
• Ansagen im Zug oder auf dem Bahnsteig,
• DB Navigator,
• Persönliche Auskünfte über das Personal,
• Faltblatt „Ihr Reiseplan“ in Fernverkehrszügen.
Die größte Unabhängigkeit bringt der DB Navigator, der zudem auch über aktuelle Daten verfügt. Größere Spielräume gibt es übrigens, indem Sie, sofern vorhanden und passend, bei der Zielauswahl die Orte in Großbuchstaben auswählen. Also beispielsweise
• KÖLN statt Köln Messe/Deutz oder Köln Hbf,
• BERLIN statt Berlin Südkreuz oder Berlin Hbf.
1.3.2 Ein Fernverkehrszug wird verspätet bereitgestellt
Angenommen, die Fahrt soll von Nürnberg Hbf nach Freiburg (Breisgau) Hbf führen. Geplant ist, ab Nürnberg Hbf mit dem Intercity 2164 um 5.37 Uhr zu fahren, der Sie nach Karlsruhe bringen soll. Dort soll es dann mit dem ICE 101 nach Freiburg weitergehen. Sie haben eine Fahrkarte mit Zugbindung und sind somit auf diese beiden Züge angewiesen.
Um 5.30 Uhr kommen Sie zum Bahnsteig 15 in Nürnberg Hbf, wo der IC 2164 abfahren soll. Auf dem Monitor am Bahnsteig steht dieser Zug mit 15 Minuten Verspätung aufgrund einer technischen Störung am Zug angeschrieben. Um 6.00 Uhr ist der Zug noch nicht da, die prognostizierte Verspätung erhöht sich auf 30 Minuten.
Sie schauen sich nach Alternativen um: Um 6.00 Uhr wäre ein Zug über Frankfurt gefahren, diese Verbindung hätte eine halbe Stunde länger gedauert. Dafür ist es nun zu spät.
Ansonsten fährt der nächste reguläre Zug in Richtung Stuttgart zwar um 6.36 Uhr, aber die Anschlüsse nach Karlsruhe und Freiburg sind dann nicht günstig. Erst um 7.40 Uhr gibt es ab Nürnberg Hbf eine weitere gute Verbindung.
Sie entscheiden sich, zu warten, und der 5.37-Uhr-Zug fährt mit einer Stunde Verspätung ab. Auf der Strecke erhöht sich die Verspätung bis Karlsruhe auf 70 Minuten. Doch durch die über 20-minütige Verspätung ist die Zugbindung automatisch aufgehoben und die Weiterfahrt ab Karlsruhe ist mit jedem Zug möglich, und auf dieser dicht befahrenen Strecke bestehen auch genügend alternative Fahrtmöglichkeiten.