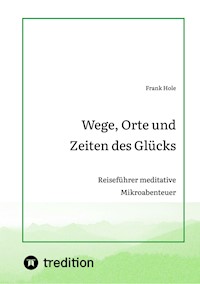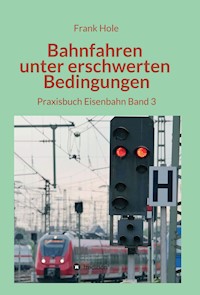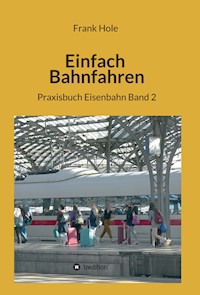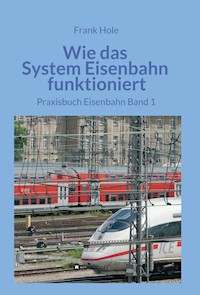
15,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Praxisbuch Eisenbahn
- Sprache: Deutsch
Die Eisenbahn steht in Deutschland an einem Wendepunkt: Nach Jahrzehnten des Rückzugs und Abbaus kommt ihr vor dem Hintergrund der großen Umwelt- und Verkehrsprobleme eine immer größere Bedeutung zu. Geht es nach dem Willen der Politik, so sollen sich bis zum Jahre 2030 die Fahrgastzahlen verdoppeln. Allerorts werden Bahnstrecken reaktiviert, neue Bahnfahrzeuge eingeführt, Fahrpläne ausgeweitet, ambitionierte Planungen begonnen. Auf allen Ebenen - von der Europa- bis zur Kommunalpolitik, von den Bestellerorganisationen über die Verbünde bis hin zu Verbänden - engagieren sich zahlreiche Menschen, Institutionen und Organisationen, um das System attraktiver zu gestalten. Und die Bevölkerung reagiert mit wachsender Nachfrage und oft großem Interesse für Bahnthemen, die regelmäßig und umfassend in der Presse aufgriffen werden. Doch die Bahn ist kein einfacher Stoff. So selbstverständlich es aussieht, wenn ein Zug durch die Landschaft fährt: im Hintergrund laufen auf ganz unterschiedlichen Ebenen sehr komplexe Prozesse ab. Diese sind zumeist nicht sichtbar und noch viel weniger verständlich. Dieses Buch vermittelt die wichtigsten Informationen rund um das Bahnsystem und bringt diese in verständliche Zusammenhänge. Es geht um das Netz, die Bahnhöfe, die Leit- und Sicherungstechnik, um Planung, Politik und Personal, die Gesetzgebung, Umwelt und Sicherheit. Dieser Band 1 aus der Reihe "Praxisbuch Bahn" ermöglicht es, die Bahn als vernetztes System zu begreifen und kommt all denjenigen zugute, die in der Verkehrsbranche arbeiten, über die Bahn berichten oder als Fahrgast dieses Verkehrsmittel nutzen. Es schafft die Grundlagen für ein umfassendes Verständnis, wie das System Bahn tickt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Autor
Frank Hole, Jahrgang 1965, ist seit 1999 in unterschiedlichen, überwiegend leitenden Funktionen bei DB Regio, S-Bahn München, Omnibusverkehr Franken sowie im Verkehrsverbund VGN tätig. Als Pendler und auf Geschäfts- und Urlaubsreisen sammelte er jahrzehntelange Erfahrungen mit der Bahn in Deutschland und Europa.
In dieser Buchreihe „Praxisbuch Eisenbahn“ sind erschienen:
Band 1: Wie das System Eisenbahn funktioniert
Band 2: Einfach Bahnfahren
Band 3: Bahnfahren unter erschwerten Bedingungen
Frank Hole
Praxisbuch Eisenbahn Band 1
Wie das System Eisenbahn funktioniert
© 2020 Frank Hole
www.praxisbuch-eisenbahn.de
Layout und Umschlaggestaltung: Frank Hole
Korrektorat und Lektorat: Dr. Grit Zacharias (www.umwelt-lektorat.de)
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-03317-7
e-Book:
978-3-347-03319-1
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation innerhalb der Deutschen Nationalbibliografie. Informationen: www.dnb.de.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Dieses Werk wurde vom Autor mit größter Sorgfalt erarbeitet und recherchiert. Eine Gewährleistung für die Aktualität und Richtigkeit der Informationen, Empfehlungen und Aussagen kann jedoch nicht übernommen werden.
Inhalt
Einleitung
1 Infrastruktur
1.1 Netz
1.1.1 Schienen und Gleise
1.1.2 Der Oberbau und Unterbau
1.1.3 Energieversorgung
1.1.4 Streckenführung und Kunstbauten
1.1.5 Die zulässige Höchstgeschwindigkeit
1.1.6 Eingleisige Strecken, mehrgleisige Strecken
1.1.7 Weichen
1.1.8 Die Trennung von Verkehren im Netz
1.1.9 Die Flexibilität des Netzes
1.1.10 Erschließung durch das Gleisnetz
1.1.11 Grundlegende Orientierungsmöglichkeiten
1.1.12 Investitionen in die Qualität des Schienennetzes
1.1.13 Die Vermarktung des Netzes
1.2 Bahnhöfe
1.2.1 Bahnsteige
1.2.2 Gerade und gekrümmte Bahnsteigkanten
1.2.3 Bahnsteige in der Ebene und Bahnsteige mit Gefälle
1.2.4 Bahnsteighöhe und Einstiegshöhe
1.2.5 Die Bahnsteiglänge
1.2.6 Spezielle Bezeichnungen von Bahnsteigen
1.2.7 Die Erreichbarkeit von Bahnsteigen
1.2.8 Nummerierung der Gleise
1.2.9 Barrierefreiheit
1.2.10 Bahnhofskategorien und -ausstattung
1.2.11 Merkmale verschiedener Bahnhofstypen
1.2.12 Größe von Bahnhöfen
1.2.13 Die Aussagekraft von Bahnhofsnamen
1.2.14 Die Vermarktung der Bahnhöfe
1.3 Leit- und Sicherungstechnik
1.3.1 Grundprinzipien
1.3.2 Häufige Schilder und Lichtsignale
1.3.3 Fahrstraßen
1.3.4 Stellwerke
1.3.5 Die Netzleitzentralen
2 Planung
2.1 Fahrplan
2.1.1 Planungsvorlauf
2.1.2 Internationale Abstimmungen
2.1.3 Abstimmungen auf regionaler Ebene
2.1.4 Gültigkeit von Fahrplänen
2.1.5 Taktfahrpläne
2.1.6 Integrale Taktfahrpläne
2.1.7 Beispiel: Neuer ITF nach Bahnhofsneubau
2.1.8 Grenzen von Fahrplänen
2.1.9 Planung der Umsteigezeiten
2.1.10 Resümee
2.2 Fahrzeugumlaufplan
2.2.1 Beispiel: Zugumlauf der Biebermühlbahn
2.2.2 Wendezeit bei Zugumläufen
2.2.3 Optimierung von Zugumläufen
2.3 Dienstplan
2.3.1 Dienstplanung der Lokführerinnen und Lokführer
2.3.2 Optimierung der Dienstplanung
2.4 Gleisbelegungsplan
2.5 Beispiel: Produktionsprogramm der S-Bahn München
3 Verkehrsunternehmen
3.1 Fernverkehr
3.2 Nahverkehr
3.3 Organisation
4 Züge
4.1 Was ist überhaupt ein Zug?
4.1.1 Lokbespannter Zug
4.1.2 Triebzug
4.2 Rahmenbedingungen zum Fahrzeugeinsatz
4.3 Zugnummern
4.4 Linien
4.5 Fernverkehrszüge
4.5.1 InterCityExpress
4.5.2 Intercity und Eurocity
4.5.3 Sonstige Fernverkehrszüge in Deutschland
4.6 Nahverkehrszüge
4.7 Informationen an den Fahrzeugen
4.8 Finanzielle Aspekte
4.9 Flügelzüge
4.10 Stärken und Schwächen
4.11 Neigetechnikzüge
4.12 Zweisystembahnen
4.13 Zugtüren und Abfertigung
4.14 Beispiel: Das technikbasierte Abfertigungsverfahren
5 Rechtlicher und politischer Rahmen
5.1 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
5.2 Eisenbahnneuordnungsgesetz
5.3 Allgemeines Eisenbahngesetz
5.4 Regionalisierungsgesetz
5.4.1 Beispiel: Die Ausschreibung der S-Bahn München
5.4.2 Verkehrsverträge als Steuerungsinstrument
5.4.3 Beispiel: Nicht bedarfsgerechte Ausschreibung
5.5 Bundespolitik
5.5.1 Resümee der Bahnreform
5.5.2 Weiterer Handlungsbedarf und Ausblick
5.6 Eisenbahn-Verkehrsordnung
5.7 Beförderungsbedingungen
5.7.1 Beispiel: Beförderungsbedingungen der DB AG
5.7.2 Beförderungsbedingungen anderer EVU
5.8 Fahrgastrechte-Verordnung
5.9 Bundesnetzagentur
5.10 Eisenbahn-Bundesamt
6 Personal
6.1 Entwicklung und Wandel
6.2 Berufsbilder
6.3 Motivation und Selbstverständnis
7 Sicherheit (Safety) und Umwelt
7.1 Sicherheit (Safety)
7.2 Umwelt
8 Nachwort zum ersten Band
Anmerkungen und Quellennachweise
Vorwort
Drei Bücher über die Eisenbahn – ist das wirklich nötig?
Ich habe im Laufe meiner zahlreichen Eisenbahnfahrten, aber auch beruflich bedingt, vieles mitbekommen, was die Fahrgäste der Bahn bewegt. Allen gemeinsam ist ein großes Unverständnis, weshalb „die Bahn“ so ist, wie sie ist, und wie die Dinge zusammenhängen.
Umfassende Wissenslücken sind in diesem Bereich nicht weiter verwunderlich; bei der Bahn spielt sich sehr viel hinter den Kulissen ab. Und da die Bahn ein komplexes System ist, bei dem Ursache und Wirkung oft zeitlich versetzt und vielleicht auch in ganz verschiedenen Regionen auftreten, entzieht sie sich einfachen und offensichtlichen Erklärungen und Erkenntnissen. Und das wiederum lässt viel Raum für Vermutungen und Spekulationen.
Zwar engagieren sich viele Menschen in zahlreichen Vereinen, die sich mit historischen Bahnfahrzeugen, Modelleisenbahnen oder der Bahnpolitik beschäftigen. Auch gibt es ein großes Angebot liebevoll gestalteter Farbbände von schönen Bahnstrecken, Videos von Führerstandsmitfahrten, Fotos von bestimmten Zugtypen aus jedem erdenklichen Blickwinkel und Foren, in denen Spezialisten und Expertinnen mit bewundernswertem Engagement sehr ausgefallene Aspekte der Bahn dokumentieren oder diskutieren. Nicht zu vergessen die zahlreichen Bücher, die die Bahn satirisch aufs Korn nehmen.
Doch ich habe immer wieder festgestellt, dass es keine umfassende und verständliche Darstellung gibt, wie die Bahn funktioniert und wie man sie am besten nutzt. Diese Lücke soll die Reihe „Praxisbuch Eisenbahn“ schließen. Die drei Bücher sind ein konstruktives Angebot, die Eisenbahn besser zu verstehen und sie möglichst einfach, souverän und mit einem guten Gefühl zu nutzen. Band 1 vermittelt die wichtigsten Tatsachen und Zusammenhänge, wie das Bahnsystem funktioniert. Band 2 ist eine Anleitung zum Bahnfahren, und in Band 3 geht es rund um das Thema Unregelmäßigkeiten bei Bahnfahrten. Jedes dieser Bücher ist auch einzeln für sich verständlich, doch sinnvoller ist es, die drei nacheinander zu lesen.
Alle drei Bände beruhen auf meiner jahrzehntelangen Praxis als Bahnnutzer: als Pendler und Geschäftsreisender, auf dem Weg in den Urlaub, mit Familie, mit Kindern, als Radfahrer, im Ausland, in Verkehrsverbünden. Ich war und bin weiterhin in der 1. wie 2. Klasse und in allen Zuggattungen unterwegs, mit Netzkarten und Ländertickets, zum Sparpreis und Kurzstreckentarif. Ich habe für diese Bücher ausführlich recherchiert und viele Erfahrungen und Kenntnisse meiner beruflichen Tätigkeiten im Verkehrssektor eingebracht.
Ich möchte Ihnen in diesem ersten Band näherbringen, wie das System funktioniert und wie die Bahn tickt. Es ist ein Buch für alle, die die Bahn nutzen oder nutzen möchten, die in der Verkehrsbranche arbeiten oder die über sie berichten und entscheiden. Oder für Menschen, die einfach nur interessiert sind.
Ich habe mich um eine gut lesbare und verständliche Sprache bemüht und verzichte weitgehend auf Abkürzungen und Fremdwörter. Sie kommen nur dort vor, wo sie unumgänglich sind oder zum allgemeinen Sprachgebrauch gehören. Es ist außerdem mein Anspruch, nach Möglichkeit einen übergeordneten Blickwinkel einzunehmen und mich nicht in Details, Besonderheiten und Ausnahmen zu verlieren, sondern mit zahlreichen Beispielen und Abbildungen die alltäglichen Erfahrungen stets im Auge zu behalten.
Ich wünsche mir, dass Sie dieses Buch mit Interesse lesen werden und dass Sie gut mit der Bahn unterwegs sind!
Einleitung
Die Bahn ist ein vielschichtiges System. Man könnte sie mit einem dynamischen, mehrdimensionalen Puzzle mit vielen Teilen vergleichen: Züge, Gleise, Weichen, Signale, Personal, Bahnhöfe, Gesetze, technische Regelwerke, Politik, Finanzierung, Aufsichtsbehörden, Verbünde, Bestellerorganisationen, Medien, Parteien, Interessensverbände und Fahrgäste sind Bestandteile dieses System-Puzzles. Jedes Teil hat seinen Platz und erfüllt eine bestimmte Aufgabe, untereinander gibt es unzählige Abhängigkeiten und Wechselwirkungen. Verändert sich nur ein Teil dieses Puzzles in Form, Menge, Größe, Inhalt, Einstellung, Material oder Geschwindigkeit, dann hat dies in der Regel umfangreichste Auswirkungen.
Abbildung 1: Stellvertretend für die Komplexität der sichtbaren Bestandteile des Bahnsystems steht dieses Bild des Vorfeldes des Frankfurter Hauptbahnhofs. Auf engstem Raum treffen hier tagtäglich weit über 2.000 Züge ein, fast eine halbe Million Fahrgäste nutzen diesen Bahnhof. [Copyright Frank Hole]
Wer ohne Wissen um die komplexen Zusammenhänge der Bahn einzelne Teile des Puzzles verändern möchte, wird wahrscheinlich nur Scheinerfolge erzielen. Unbedachte Änderungen und Einflüsse können erstaunliche Auswirkungen an völlig anderen, unerwarteten Stellen haben.
So mag der ersatzlose Ausbau einer Weiche oder eines wenig genutzten Gleises vordergründig Kosten sparen, in Wirklichkeit fehlen dadurch vielleicht betriebliche Spielräume, die zu erhöhten Verspätungen, Unzufriedenheit bei den Fahrgästen und geringerer Nachfrage aufgrund des miserablen Images führen können.
Oder: Wenn die Bahn im Jahre 2030 doppelt so viele Fahrgäste wie heute befördern soll, wie es die Pläne der Bundesregierung sinnvollerweise vorsehen, kann dies nicht über den Preis allein erreicht werden, sondern dann muss das mit einem deutlichen Ausbau der Kapazitäten bei den Zügen und beim Personal, aber insbesondere bei der Infrastruktur einhergehen. Und das kostet Geld und dauert sehr lange.
Derartige Zusammenhänge sind oft nur unzureichend bekannt. Selbst Fachleute in Behörden, Angestellte von Verkehrsbetrieben und Politikerinnen und Politiker, die sich mit Verkehrsfragen beschäftigen, kennen oft nur einzelne Aspekte, selten aber gibt es ein großes Gesamtbild über das Puzzle mit all seinen Teilen. Sogar Fahrgäste, die häufig Bahn fahren, stehen oft kopfschüttelnd vor bestimmten Situationen, die auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar sind, für die es aber oft gute Gründe gibt.
Dieses Buch wendet sich an alle Interessierten, die mehr über die Hintergründe des Bahnsystems wissen wollen, um beruflich oder als Fahrgast bessere Entscheidungen treffen zu können: Wer um die Zusammenhänge weiß oder zumindest ahnt, dass es Wechselwirkungen gibt, wird eine differenziertere Einstellung haben, konstruktiver kommunizieren und sich anders verhalten – sei es als Fahrgast, als fachlicher oder politischer Entscheidungsträger, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eines Eisenbahn-Verkehrs-Unternehmens oder Mitglied eines Interessensverbandes.
Wenn die Bahn in Zukunft eine tragende und wichtige Rolle zur Lösung von Verkehrs- und Umweltproblemen spielen soll – und das Potenzial hat dieses System auf jeden Fall –, dann ist dauerhafter Rückhalt in allen Institutionen, Gremien und in der Bevölkerung unumgänglich. Dazu ist einiges Wissen über die Zusammenhänge und eine grundsätzlich positive Einstellung zum Gesamtsystem nötig. Dieses einfach verständliche und praxisnah geschriebene Buch will einen Beitrag dazu leisten.
Und damit genug der allgemeinen Worte, hinein in die Inhalte! Den Anfang macht die Frage: Was ist denn nun das Besondere an der Bahn?
Züge unterscheiden sich von Autos und Lastwagen wie Flugzeuge von Schiffen. Alle haben gemeinsam, dass sie Menschen und Güter transportieren können. Doch sie folgen alle ihren eigenen Regeln und Gesetzmäßigkeiten.
Für die Bahn gilt insbesondere:
• Die Züge fahren auf SCHIENEN und können nicht davon abweichen. Ein Lokführer, eine Lokführerin1 bedient deswegen kein Lenkrad. Es gibt keine Notwendigkeit, sich wie beim Autofahren darauf zu konzentrieren, auf der richtigen Fahrbahnseite zu bleiben. Das bedeutet MAXIMALE SICHERHEIT – ein Zug bleibt auch ohne menschliches Zutun immer in seiner Spur. Einen Nachteil gibt es dennoch: An Hindernissen kann der Zug nicht einfach vorbeifahren und er kann auch nicht ohne Weiteres wenden und rückwärtsfahren. Deshalb bedeutet jedes Hindernis auf den Schienen einen großen Zeitverlust.
Abbildung 2: Die Schienengebundenheit bedeutet maximale Sicherheit auch im Winter. [Copyright Deutsche Bahn AG/Jochen Schmidt]
• Die Räder eines Zuges bestehen ebenso wie die Schienen aus Metall. Gleichzeitig ist die Auflagefläche eines Rades auf der Schiene extrem klein: Sie beträgt gerade mal einen Zentimeter im Quadrat, das ist kleiner als ein Fingernagel.2 Die Folge ist eine minimale Reibung, die sich positiv auf den ENERGIEVERBRAUCH auswirkt. Ein Zug, der einmal in Bewegung ist, rollt über eine große Entfernung einfach weiter: Beispielsweise kommt ein ICE-Zug auf der Strecke Stuttgart–Mannheim schon 50 km (!) vor Mannheim ohne weitere Energiezufuhr aus, er rollt einfach mit fast unverminderter Geschwindigkeit weiter.3
• Der geringe Rollwiderstand bedeutet – in Kombination mit seinem hohen Gewicht – auf der anderen Seite auch, dass ein Zug im Gegensatz zum Auto nur über eine GERINGE STEIGUNGSFÄHIGKEIT verfügt. Deswegen werden Bahnstrecken immer so angelegt, dass sie entweder möglichst eben verlaufen oder dass Neigungen gleichmäßig gering sind. 2,5 % Neigung kommen bei der Bahn auf Hauptstrecken noch gelegentlich vor, sehr viel seltener sind 4 %, die hin und wieder auf Nebenstrecken erreicht werden. Beides gilt bei der Bahn schon als Steilstrecke. Es gibt zwar noch Bahnstrecken mit größeren Steigungen, doch diese sind selten: Begrenzende Faktoren sind die physikalisch mögliche Steigungsfähigkeit, Energieverbrauch und die geringen zulässigen und möglichen Geschwindigkeiten.
• Gleichzeitig führt die MINIMALE REIBUNG neben dem hohen Gewicht dazu, dass Züge einen enorm LANGEN BREMSWEG haben: Dieser ist um ein Vielfaches länger als beim Auto, hier geht es in der Regel um Hunderte von Metern, bei Hochgeschwindigkeitszügen um mehrere Kilometer. Dazu gibt es im Internet beeindruckende Videos.4
• Weil ein Zug nicht ausweichen und nur sehr verzögert zum Stillstand kommen kann, beruht das ganze System Eisenbahn auf der Voraussetzung, dass die Gleise immer und überall FREI VON HINDERNISSEN sind. Deswegen gibt es Schranken an Bahnübergängen, deswegen dürfen Menschen die Gleise nur unter ganz strengen Voraussetzungen an wenigen, klar gekennzeichneten Stellen zu Fuß überqueren. Das ist letztlich auch der Grund, weshalb hierzulande so viele Unterführungen und Brücken in Zusammenhang mit der Bahn gebaut werden: Risikominimierung.
• Außerdem ist eine AUSGEFEILTE SIGNALTECHNIK nötig, um den Zugverkehr zu ermöglichen. Denn zwischen zwei Zügen benötigt man wegen des langen Bremswegs sehr viel Raum. Dieser ist viel zu groß, um mit dem Auge zuverlässig noch etwas erkennen und rechtzeitig reagieren zu können. Bei Dunkelheit, im Nebel und bei Kurven ist „Fahren auf Sicht“ bei normalen Geschwindigkeiten ohnehin nicht möglich. Die Bahn ist in diesem Aspekt das absolute Gegenteil zum Auto, bei dem das gesamte Prinzip im Grundsatz darauf beruht, dass die Fahrerinnen und Fahrer alles wahrnehmen und rechtzeitig bremsen können.
• Die Eisenbahn ist ein vollständig GEPLANTES UND GESTEUERTES SYSTEM. Jeder einzelne Zug hat seinen eigenen Fahrplan. Wenn er unterwegs ist oder im Bahnhof steht, läuft parallel dazu eine menschliche und signaltechnische Überwachung und Steuerung. Ohne diese Menschen und Technik im Hintergrund ist moderner Bahnverkehr nicht möglich.
• Das System der Bahn ist so aufgebaut, dass im Falle von technischen und menschlichen Ausfällen, Fehlern oder unklaren Situationen ein sicherer Zustand hergestellt wird. Das bedeutet beispielsweise, dass Signale dann automatisch auf „Rot“ geschaltet werden oder der Zug bis zum Stillstand abgebremst wird. Dadurch wird maximale Sicherheit erreicht (FAIL-SAFE-PRINZIP).5
• Personenzüge können mehrere Hundert Meter lang sein und brauchen geeignete Ein- und Ausstiegspunkte: BAHNHÖFE. Ohne Bahnhöfe ist kein Personenverkehr mit der Bahn möglich. Ein Personenzug benötigt immer einen passenden Bahnsteig, der die richtige Höhe und Länge hat.
• Das System Bahn ist ein Massenverkehrsmittel und hat eine SEHR HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT, wenn es so genutzt wird, wie es dem Stand der Technik entspricht und die Systemvorteile vollständig zum Tragen kommen. Die theoretisch maximale Kapazität bei einer S-Bahn liegt bei rund 54.000 Fahrgästen pro Stunde auf einem Gleis. Zum Vergleich das Auto: Hier werden theoretisch maximal rund 13.000 Personen je Stunde und Fahrspur befördert.6
• Die Bahn hat einen MINIMALEN FLÄCHENVERBRAUCH im Vergleich zur Straße: Das Auto verbraucht pro beförderter Person mehr als zehnmal mehr Fläche als der Zug.7
• Auch in Bezug auf SICHERHEIT, ENERGIEVERBRAUCH und SCHADSTOFFEMISSIONEN hat die Bahn ganz eindeutige Vorteile gegenüber dem Auto (vgl. auch Kapitel 7).
Aus all diesen Besonderheiten folgt: Die Bahn ist im Verhältnis zum Auto ein maximal sicheres Verkehrsmittel, das jedoch minimale Flexibilität besitzt und zum Teil grundlegend anderen Gesetzmäßigkeiten folgt.
Abbildung 3: Dank Schienengebundenheit und der Leit- und Sicherungstechnik kann ein Zug – im Gegensatz zum Auto – auch bei dichtem Nebel mit voller Geschwindigkeit fahren. [Copyright Deutsche Bahn AG/Uwe Miethe]
1 Infrastruktur
Damit ein Zug überhaupt fahren kann, ist Infrastruktur nötig8: Das Schienennetz, die Bahnhöfe und die Signalanlagen.9 Betreiber der Infrastruktur sind in Deutschland die sogenannten „Eisenbahn-Infrastruktur-Unternehmen“.10 Davon gibt es zahlreiche, aber die mit Abstand größten sind DB Netz AG (Eigentümer und zuständig u. a. für den größten Teil des Schienennetzes und die Signalanlagen in Deutschland) und DB Station & Service AG (zuständig für die meisten Bahnhöfe). Diese beiden Aktiengesellschaften sind zu 100 % in Besitz des Bundes und gehören zum Deutsche Bahn-Konzern (DB).
Abbildung 4: Zur Infrastruktur gehören auch Brückenbauwerke wie die Göltzschtalbrücke in Sachsen, die schon seit 1851 in Betrieb ist. [Copyright Deutsche Bahn AG/Barteld Redaktion & Verlag]
Bahninfrastruktur, insbesondere die Gleisanlagen, ist extrem langlebig und robust: Der Gesetzgeber billigt Bahndämmen, Brücken und Tunneln beispielsweise 75 Jahre Lebensdauer zu und den Metallschienen und Bahnsteigen immerhin noch 25 Jahre.11
Was bei der Bahn einmal gebaut wurde, das bleibt in aller Regel für Generationen erhalten und wird in dieser Zeit lediglich instand gehalten. Grundlegende Änderungen von Lage, Funktion und Beschaffenheit der Gleise werden entweder nicht durchgeführt oder haben einen oft jahre-, wenn nicht jahrzehntelangen Vorlauf. Diese sind an Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren gebunden und als Investitionsvorhaben entsprechend zeitintensiv und kostspielig.
Abbildung 5: Auch die Reste aufgegebener Eisenbahninfrastruktur, hier aufgrund Zerstörung im 2. Weltkrieg, überdauern Jahrzehnte, und sind überall in Deutschland mehr oder minder offensichtlich erkennbar. Im Bild: der Rest der „Brücke von Remagen“, Inbetriebnahme 1918, Zerstörung 1945, Foto von 2019. [Copyright Frank Hole]
So haltbar die Bauwerke und Materialien auch sind, so aufwendig ist deren Bau. Sie müssen enormen Belastungen standhalten, denn Züge fahren je nach Strecke wesentlich schneller als Autos (in Deutschland bis zu 300 km/h) und sind um ein Vielfaches schwerer: Güterzüge bringen in Deutschland weit über 1000 Tonnen auf die Waage.
Wenn sich also herausstellt, dass eine neue Eisenbahnstrecke oder ein zusätzlicher Bahnhof nötig ist, dann erweist sich die bestehende Struktur als außerordentlich träge. Beispielsweise dauerte es über 20 Jahre, bis die Neubaustrecke Hannover–Würzburg geplant und gebaut war. Bei der Neu- und Ausbaustrecke Erfurt–Nürnberg liegen gar weit über 30 Jahre zwischen Planungsbeginn bis zur weitgehenden Fertigstellung – bis zur endgültigen Fertigstellung wird es noch etliche Jahre dauern. Auch vermeintlich kleinere Maßnahmen wie die Bahnanbindung des Münchener Flughafens aus Richtung Norden und Osten können 10 bis 20 Jahre dauern.12 Da der politische Meinungsbildungsprozess, die Planung und Finanzierung und die spätere Umsetzung so lange dauern, gibt es oft genug einen Unterschied zwischen den Anforderungen und der Realität.
1.1 Netz
Auf Schienen, Gleisen, Strecken und dem Netz fährt die Eisenbahn. Der Unterschied zwischen diesen Begriffen? Eine Schiene allein ist nichts als ein funktionsloses langes Stück Stahl, extrahart. Aber zwei Schienen im richtigen Abstand zueinander bilden das Gleis, auf dem ein Zug fahren kann. Eine Strecke kann aus einem Gleis bestehen oder aus mehreren – jedenfalls verbindet sie mindestens zwei Bahnhöfe13 miteinander. Und das Netz besteht dann aus allen Strecken einer bestimmten Region oder eines Landes.
1.1.1 Schienen und Gleise
Das Auffälligste an der Eisenbahn sind zuallererst die Schienen. Nicht umsonst heißt dieses Verkehrsmittel „Eisenbahn“, es ist eine Bahn, die auf Eisen fährt. Genauer gesagt: auf Stahl, und zwar aus ganz besonders hartem und hochwertigem Stahl, der dennoch gleichzeitig eine gewisse Flexibilität aufweist. In Kurven und an Weichen wird die veränderliche Form sichtbar. Für ein Gleis braucht man zwei exakt parallel geführte Schienen, die den Zug in Kombination mit besonders geformten Rädern14 in seiner Spur halten. Diese Schienen haben in Deutschland auf den allermeisten Bahnlinien eine einheitliche Spurbreite, deren Abstand genau 1435 mm beträgt. Das ist für mitteleuropäische Begriffe eine NORMALSPURIGE EISENBAHN. In anderen Ländern gibt es davon abweichende Maße mit der Folge, dass die Eisenbahnen nicht über bestimmte Grenzen hinausfahren können, oder sie benötigen eine besondere Umspurtechnik.15 Das Umspuren ist in Deutschland aktuell nicht von Bedeutung, aber wer mit dem Zug nach Spanien (dort fährt die Bahn überwiegend auf 1668 mm Spurbreite) oder Russland (1520 mm) unterwegs ist, kommt damit in Berührung. Im Güterverkehr hingegen spielt das Thema der Spurbreite z. B. im Rahmen des neuen Seidenstraßenprojekts künftig eine wichtigere Rolle, doch das soll hier nicht weiter Thema sein.16
Je nach Beanspruchung verwendet man im Bahnbau Schienen unterschiedlicher Qualität. In der Regel wiegt ein Meter Schiene zwischen 49 und 60 kg.17 Von überragender Bedeutung ist natürlich die Stabilität, jedoch ebenfalls die Fehlerfreiheit und die möglichst glatte und ebene Oberfläche. Wenn die Oberfläche einer Schiene abgenutzt oder fehlerhaft ist, wirkt sich das auf die Laufruhe bei der Fahrt negativ aus, und die Räder der Schienenfahrzeuge können Schaden nehmen oder sich zumindest schneller und unregelmäßig abnutzen.
Abbildung 6: Neu verlegte Schiene auf neuen Betonschwellen im Schotterbett: Diese drei Bestandteile des Fahrweges tragen und verteilen die großen Gewichte der Eisenbahnfahrzeuge. Jede Schiene besitzt ein Walzzeichen, hier mit folgenden Informationen: Produktion: 2017, Material: Kohlenstoff-Mangan-Stahl, Gewicht: 54 kg pro Meter, Herkunft: Walzwerk Huta Katowice (Polen). Es handelt sich somit um das Standard-Schienenprofil der Bahn auf Hauptstrecken und im Bahnhofsbereich. [Copyright Frank Hole]
1.1.2 Der Oberbau und Unterbau
Nach den Schienen wird Ihnen vermutlich die besondere Bauweise der Gleisanlagen auffallen. Die hängt mit den Belastungen zusammen, denen eine Schienenstrecke ausgesetzt ist. Die Schienen halten auf Hauptstrecken oft Achslasten von 22,5 Tonnen aus.18 Auf Nebenstrecken sinkt dieser Wert zwar auf 16 Tonnen, doch zum Vergleich: Der Lkw hat ca. 8 Tonnen Achslast, der Pkw höchstens 1 Tonne.
Um die enormen Kräfte zu stemmen, brauchen die Schienen einen sehr stabilen Untergrund. Sie sind auf querliegenden Schwellen aus Beton, Stahl oder Holz befestigt. Die Schwellen wiederum sind in den Eisenbahnschotter eingebettet, der aus harten Gesteinen wie Granit oder Basalt besteht.
Bei Hochgeschwindigkeitsstrecken fahren die Züge hingegen oft auf einer vollständig betonierten „festen Fahrbahn“, auf der die Schienen montiert sind. Diese ist nötig, da die Gleise, wenn sie auf klassische Weise im Eisenbahnschotter verlegt werden, den Kräften im Hochgeschwindigkeitsverkehr nicht lange standhalten. Gleislagefehler mit Langsamfahrstellen und Streckensperrungen zur Reparatur sind die Folge. Die feste Fahrbahn verhindert auch, dass die Schottersteine angesichts der hohen Geschwindigkeiten durch den Luftzug aufgewirbelt werden und Schäden verursachen.
Abbildung 7: Der Bau der festen Fahrbahn19 ist Präzisionsarbeit im Zehntelmillimeterbereich. Die Schwellenblöcke werden in den Gleistrog eingebaut und justiert, es folgt anschließend die Fixierung mittels Füllbeton. Das Bild zeigt die Neubaustrecke zwischen Stuttgart und Ulm. [Copyright mit freundlicher Genehmigung Arnim Kilgus]
Der Unterbau liegt, wie der Name schon ausdrückt, unter dem Oberbau und ist üblicherweise nicht oder nur bei Bauarbeiten sichtbar. Er kann aus mehreren Schichten bestehen: Erdplanum, Planum, Planumsschutzschicht und Frostschutzschicht. Wichtig ist hier, dass alle Schichten die nötige Stabilität und eine gute Entwässerung garantieren und das Pflanzenwachstum nicht fördern.
Schienen sind in aller Regel recht robust, d. h. sie halten auch bei höherer Beanspruchung viele Jahre, bei geringerer auch Jahrzehnte. Defekte entstehen manchmal bei extremen Temperaturen, denn Stahl dehnt sich bei Hitze aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Es kann in extrem heißen Sommern zu Verwerfungen kommen: Dann dehnen sich die in der Regel fugenlos verschweißten Schienen trotz sehr guter Verankerung mit den Schwellen so sehr aus, dass sie insbesondere in Kurven nicht mehr ganz parallel liegen. Umgekehrt können bei extremer Kälte Schienenbrüche entstehen.20
1.1.3 Energieversorgung
Weiterhin fällt bei der Eisenbahn an vielen Strecken die besondere Art der Energieversorgung auf. In einer Zeit, wo das Wort Elektromobilität in aller Munde ist, hat die Eisenbahn einen jahrzehntelangen Vorsprung gegenüber dem Straßenverkehr.21 1895 wurde in Deutschland erstmals eine Eisenbahnstrecke elektrisch betrieben. Heute gibt es bei der Eisenbahn in Deutschland rund 60 % elektrifizierte Strecken, der Anteil soll auf 70 % steigen.22 Generell sind elektrifizierte Strecken leistungsfähiger, da die Fahrzeuge mit Elektromotor schneller beschleunigen können und höhere Geschwindigkeiten erreichen. Auch aus Umweltgründen wird in Deutschland die Elektrifizierung sukzessive vorangetrieben.23 Große Projekte sind beispielsweise die Elektrifizierung der Strecke Geltendorf–Lindau auf über 150 km Streckenlänge durch das Allgäu, um die Lücke zwischen München und Zürich zu schließen24, oder die Strecke Ulm–Lindau auf 120 km25.
Die Bahnstrom-Versorgung erfolgt in der Regel über Oberleitungen mit 15.000 Volt Wechselstrom.26 Nur bei den S-Bahnsystemen in Hamburg und Berlin gibt es Stromschienen an der Seite des Gleises, die Fahrzeuge fahren dort mit Gleichstrom – Berlin mit 750 Volt und Hamburg mit 1.200 Volt.27
Abbildung 8: Fahrdraht, Tragseile, Hänger, Stromverbinder, Isolatoren, Masten und Ausleger bilden eine Einheit, um elektrische Züge dauerhaft mit der nötigen Energie zu versorgen. [Copyright Frank Hole]
Elektrifizierte Strecken tragen die Hauptlast des Bahnverkehrs und sind vorwiegend in, um und zwischen Ballungsräumen und Großstädten zu finden: dort also, wo die Zugfrequenz hoch ist und auch schwere, schnelle Züge fahren. Auf dem nicht elektrifizierten Rest fahren dann Züge mit Dieselantrieb. Dabei handelt es sich häufig um Nebenstrecken, die oft in dünn besiedelten Regionen verlaufen. Versuche mit Hybrid-, Batterie- und Wasserstoffantrieben laufen ebenfalls, haben aktuell jedoch noch keine weite Verbreitung. Ziel dieser Testbetriebe ist es, die Umweltbilanz der Bahn weiter zu verbessern und die teuren Investitionen in Oberleitungen zu sparen. Die größte mit Wasserstoff betriebene Zugflotte weltweit wird ab 2023 in Hessen fahren: Dort sollen 27 Triebfahrzeuge vom Typ Coradia iLint 54 die alten Dieselfahrzeuge auf vier Linien ablösen.28 Die ersten Tests dieser Züge in Niedersachsen im Echtbetrieb verlaufen sehr positiv, dort sollen 2021 insgesamt 14 Fahrzeuge verkehren.29 Geeignete Tankstellenstandorte vorausgesetzt, scheint die Brennstoffzellentechnik das Potenzial zu haben, die derzeit noch weitverbreiteten Dieselfahrzeuge abzulösen und völlig emissionslos einen großen Beitrag zur Luftreinhaltung zu leisten.
Die filigranen Oberleitungen sind anfällig gegenüber äußeren Einflüssen. Nicht allzu selten werden sie von Buntmetalldieben gestohlen, mal reißen Bäume die Leitungen durch Schneebruch oder Sturm nieder, auch sorgen metallbeschichtete Luftballons für Kurzschlüsse. In allen Fällen ist die Reparatur aufwendig und die Folgen sind immer stunden- bis tagelange Streckensperrungen.
1.1.4 Streckenführung und Kunstbauten
Auch die zahlreichen, oft sehr aufwendig errichteten Bauwerke und die besondere Art der Streckenführung sind typisch für das Netz der Bahn. Ganz allgemein haben Eisenbahnen sehr viel geringere Höhenunterschiede und Neigungen als Straßenverläufe. Dementsprechend aufwendiger sind Planung und Bau: Wegen der geringen Reibung zwischen dem Metallrad und den Metallschienen und der hohen Masse der Züge versucht man bei der Planung, Bahnstrecken möglichst eben und gerade anzulegen, sodass trassierungsbedingte Geschwindigkeitsänderungen idealerweise nicht oder möglichst selten nötig sind.
Abbildung 9: Über die mächtige, sechsgleisige Hohenzollernbrücke, die in Köln über den Rhein führt, fahren jeden Tag weit über 1.000 Züge. [Copyright Frank Hole]
So weist beispielsweise die 500 km lange Neu- und Ausbaustrecke zwischen Nürnberg und Erfurt eine maximale Steigung von nur 1,25 % auf, obwohl sie den Thüringer Wald quert und dort einen Höhenunterschied von etwa 300 Metern bewältigt.30
Wenn Höhenunterschiede nicht zu vermeiden sind, geht es darum, diese möglichst gering und gleichmäßig zu halten. Um das zu erreichen, sind viele Bahnstrecken insbesondere in den Mittelgebirgen völlig anders geführt als die Straßen. Über 1.000 Tunnel mit bis zu knapp 11 km Länge31 und 25.000 teils richtig spektakuläre Brücken mit bis zu 8,6 km Länge32 gibt es in Deutschland bei der Bahn. Riesige Stützmauern, tiefe Einschnitte und hohe Dämme sind im Bahnbau Standard. Manchmal windet sich die Bahn in zahlreichen Kurven den Berg hinauf. Ein Beispiel dafür ist die Schwarzwaldbahn bei Triberg, die Strecke der Bayerischen Waldbahn von Plattling nach Bayerisch Eisenstein oder zwischen Sonneberg und Neuhaus im Thüringer Wald.
Abbildung 10: Aufwendige Stützmauern in den steilen Weinbergen oberhalb von Dernau (Ahr) an der (nie fertiggestellten) Bahnstrecke der Ruhr-Mosel-Entlastungslinie. [Copyright Frank Hole]
Um Steigungen zu vermeiden und so Baukosten zu sparen, wurden früher viele Mittelgebirgs-Eisenbahnen in Tälern gebaut. Sie schlängeln sich förmlich an den Flussufern entlang und sind oft richtig schön zu befahren.
Dadurch sind sie jedoch nicht besonders schnell und erschließen die anliegenden Städte und Dörfer nicht immer optimal. Häufig sind diese Strecken jedoch hochwassersicherer angelegt als die parallelen Straßen und benötigen deswegen ebenfalls große Stützmauern und Brückenbauten, die landschaftsprägend sein können. Beispiele dafür sind die Mittelrheinbahn zwischen Bingen und Koblenz, die Moselstrecke Trier–Koblenz oder die Eifelstrecke zwischen Trier–Ehrang und Gerolstein. Welche Dimensionen so ein Streckenverlauf in einem Tal annehmen kann, zeigt das Beispiel der Bahnstrecke Nürnberg–Cheb zwischen Hersbruck und der Stadt Pegnitz: Auf rund 40 km verläuft die Bahnstrecke durch das enge, gewundene Tal des Flusses Pegnitz. Dabei führt die Strecke siebenmal durch Tunnel und überquert auf 25 Brücken den Fluss.
Abbildung 11: Das Pündericher Viadukt – seit 1880 fahren dort die Züge gute 25 Meter über dem Moseltal. [Copyright Rolf Krahl/CC BY 4.0 via Wikimedia Commons33]
Die heutigen großen Hochgeschwindigkeits-Neubaustrecken hingegen sind eher so angelegt, dass sie möglichst viel Zeit einsparen. Sie verlaufen in den Mittelgebirgen kaum in Tälern, stattdessen teils auf den Höhen oder geradlinig mitten hindurch und benötigen sehr viele und lange Tunnel und Brücken.
So ist die Neubaustrecke Frankfurt–Köln nur zu 20 % ebenerdig gebaut, der Rest verläuft im Tunnel, auf Brücken, Dämmen und in Einschnitten.34 Diese Strecken werden nach Möglichkeit auch parallel zu Autobahnen angelegt, damit die Zerschneidung von Flächen minimiert wird. Außerdem ergibt ein Zug, der die Autos auf der Autobahn überholt, einen erstklassigen Werbeeffekt zugunsten der Bahn.35 Schöne Beispiele dafür sind die Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen Köln und Frankfurt, Ingolstadt und Nürnberg oder teilweise zwischen Erfurt und Nürnberg.
Abbildung 12: Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Nürnberg–Ingolstadt, hier mit einem ICE 1, verläuft parallel zur Autobahn. Gut zu erkennen, dass die Trasse mit einer sehr geringen Neigung und einem Tunnel angelegt ist, während die Autobahn den Bergrücken vollständig überquert. [Copyright Deutsche Bahn AG/Claus Weber]
Ein weiterer Aspekt der Streckenführung: Nicht immer, aber häufig führen Bahnstrecken mitten in die Innenstädte oder zumindest an deren Ränder. Sie wurden zu einer Zeit gebaut, als die Bahn einen großen Stellenwert innehatte und die Städte noch eine geringere Ausdehnung besaßen. So ist es möglich, dass etliche Großstadt-Hauptbahnhöfe sehr citynah liegen, wie beispielsweise Frankfurt (Main) Hbf, Köln Hbf, Stuttgart Hbf und München Hbf, was bedeutet, dass Sie mit dem Nah- und Fernverkehr direkt in die Stadtmitte fahren können.
Abbildung 13: In Frankfurt (Main) führt die Bahnstrecke direkt in die Stadtmitte. [Abbildung mit freundlicher Genehmigung Hessische Landesbahn/Gerhard Hohl]
Das ist ein großer Vorteil gegenüber dem Auto, zumal die Verkehrsdichte größer wird, je weiter man sich dem Zentrum nähert. Wenn Sie hingegen mit dem Flugzeug unterwegs sind, geht ein Großteil der gesamten Reisezeit damit verloren, dass Sie von dem häufig weit abseits gelegenen Flughafen noch eine halbe oder ganze Stunde in die Stadt fahren müssen. Alles Probleme, die Sie mit der Bahn nicht haben.
1.1.5 Die zulässige Höchstgeschwindigkeit
Nicht alle Bahntrassen sind für die gleichen Geschwindigkeiten ausgelegt, auch wenn die Schienen auf den ersten Blick identisch aussehen mögen. Je schneller und schwerer die Züge, desto höher sind die Anforderungen an die Qualität und Bauweise der Gleiskörper: Beispielsweise spielen die Art und der Abstand der Schwellen eine Rolle, das verwendete Material bei den Schienen und bei zweigleisigen Strecken der Abstand der Gleise. Das ist durchaus vergleichbar mit der Straße, wo es z. B. zwischen einer schmalen Gemeindestraße und einer Autobahn ganz unterschiedliche Standards gibt.
Je schneller die Züge, desto größer sind beispielsweise die Kurvenradien der Trasse: Über 4000 m36 für Züge mit 300 km/h kommt zum Beispiel auf der Schnellfahrstrecke Ingolstadt–Nürnberg vor, aber nur 200 m37 Radius für Züge mit maximal 60 km/h. Bei Hochgeschwindigkeitsstrecken wird noch ein weiterer Effekt eingesetzt – die Gleise liegen in Kurven unterschiedlich hoch. Bis zu 18 cm Höhendifferenz liegt zwischen den beiden parallelen Schienen.38 Kommt ein Zug in einer dermaßen überhöhten Kurve zum Halten, dann stehen Sie als Fahrgast im Zug auf einer schiefen Ebene und müssen sich schon beinahe festhalten.
Die Bahnstrecken besitzen unterschiedliche Geschwindigkeitsgrenzen. Wie auf der Straße ist jeder Meter ganz exakt reglementiert und keinesfalls kann ein Zug immer seine Höchstleistung ausfahren. In Kurven, im Bahnhofsbereich, bei Steigungen, in Tunneln und bei Abzweigungen gelten oft niedrigere Geschwindigkeitsgrenzen als auf freier Strecke.39
Hochgeschwindigkeitsstrecken erlauben 200 km/h und aufwärts. Auf manchen Schnellfahrstrecken beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Regelbetrieb 300 km/h, auf anderen nur 250 km/h oder 200 km/h.40 Das hängt von mehreren Faktoren ab: Je höher die Geschwindigkeit, desto aufwendiger die Kunstbauten wie Tunnel und Brücken, und desto höher die Investition. Auch der Energieverbrauch der Züge steigt exponentiell an. Nicht zuletzt muss die Strecke auch fahrplantechnisch in das Gesamtnetz passen – es nützt eine Zeitersparnis von 5 Minuten wenig, wenn im folgenden Bahnhof dann die Anschlüsse alle schlechter erreicht werden. Die 300 km/h bleiben in Deutschland eher die Ausnahme.
S-Bahnstrecken sind oft für maximal 120 oder 140 km/h ausgelegt. Diese Geschwindigkeit wird jedoch nur an wenigen Stellen wirklich erreicht, weil die Haltestellenabstände zu gering sind.
Abbildung 14: Abzweigungen bei der Bahn verlaufen immer als Kurven, bei denen klare Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten. In diesem Beispiel im Bereich des Bahnhofs Kreuzstraße in Oberbayern zweigen die Strecken der S-Bahn München (eingleisig nach links oben führend, Höchstgeschwindigkeit 120 km/h) und die Mangfalltalbahn nach Rosenheim (nach rechts unten führend, in eine eingleisige Strecke mit 80 km/h – Begrenzung übergehend) voneinander ab. [Copyright Frank Hole]
Nebenbahnen mit engen Kurvenradien und nicht mit Schranken gesicherten Bahnübergängen haben häufig nur 100 km/h als zulässige Höchstgeschwindigkeit, und nicht selten deutlich weniger wie beispielsweise die Bahnstrecke Brand-Erbisdorf–Langenau mit ihren 50 km/h.41
Es gibt allerdings auch Strecken mit engen Kurvenradien, die mit Geschwindigkeiten von 160 km/h befahren werden. Das funktioniert mit Neigetechnikzügen. Dabei handelt es sich oft um nicht elektrifizierte und sehr kurvenreiche Strecken in den Tälern der Mittelgebirge, z. B. im nordbayerischen Raum, im Allgäu oder im Schwäbischen.
Wenn Sie die Kurven bei den Bahntrassen mit denen auf der Straße vergleichen, so sind die bei der Bahn eher so angelegt wie bei großzügig bemessenen Autobahnausfahrten: sanft, langgezogen und kaum spürbar. Enge Kurvenradien wie an einer Straßenkreuzung beim Rechtsabbiegen sind bahntechnisch unmöglich.
Bei Ihren Fahrten mit der Bahn wird Ihnen immer wieder auffallen, dass der Zug scheinbar oder tatsächlich ganz langsam fährt. Scheinbar deswegen, weil Sie die Geschwindigkeit im Zug systematisch unterschätzen, denn der Zug fährt wesentlich ruhiger als das Auto.
Und wenn der Zug tatsächlich sehr langsam fährt, hängt das in vielen Fällen mit Folgendem zusammen:
• Er fährt auf einer Strecke, auf der die zulässige Höchstgeschwindigkeit einfach generell niedrig ist. Beispielsweise fährt ein ICE 1 auf der Mittelrheinstrecke an manchen Stellen ganz regulär nur mit 90 km/h, obwohl der Zug selbst eigentlich technisch über 280 km/h hergeben würde. Aber die engen Kurven, die engen Abstände zwischen den Gleisen und die häufigen Bahnhofsdurchfahrten lassen nicht mehr zu.
• Aufgrund von Mängeln im Oberbau wurde eine Geschwindigkeitsreduzierung angeordnet. Im Bahnjargon spricht man von LANGSAMFAHRSTELLEN.
• Möglicherweise hat der Zug aufgrund der aktuellen Betriebslage ein Tempolimit bekommen. Beispielsweise fährt dann ein langsamerer Zug voraus oder es wurde gemeldet, dass sich – unerlaubterweise – ein Mensch auf dem Gleis oder in Gleisnähe befindet.
• Die Leit- und Sicherungstechnik gibt bei der Ausfahrt aus einem Bahnhof oder bei Wechsel des Gleises im Weichenbereich eine geringere Geschwindigkeit vor.
• Wenn Lokführerinnen und Lokführer ausnahmsweise einen Dienst übernehmen müssen und keine Streckenkenntnis besitzen, ist nur eine deutlich verminderte Geschwindigkeit erlaubt. Dieser Fall kommt jedoch sehr selten vor.
Die Geschwindigkeit des Zuges ist also nicht von einer Laune des Personals abhängig. Lokführerinnen und Lokführer werden immer versuchen, den Fahrplan einzuhalten, und dieser Fahrplan orientiert sich fast immer an den zulässigen Höchstgeschwindigkeiten der Strecke und des Fahrzeugs.
1.1.6 Eingleisige Strecken, mehrgleisige Strecken