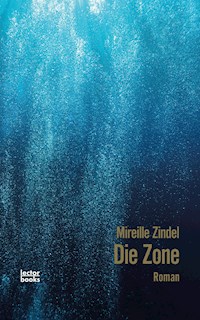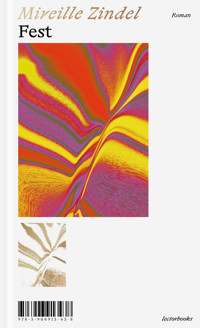Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Theologischer Verlag Zürich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Zwischen zwei Blicken in den Himmel sah ich auf mein Telefon. Keine weitere Nachricht. Auch mir fiel nichts mehr ein, das in Worte gefasst werden konnte. Ich stand von meinem weissen Stuhl auf und ging zum Friedhof.» Zwölf Tage, die alles verändert haben. So lange hat Zoé nach ihrer Geburt gelebt, bevor sie an einer unheilbaren Krankheit starb. Was, wenn ich ehrlich wäre?, fragt sich die Mutter – und dann schreibt sie darüber: ohne zu beschönigen, ehrlich eben, wie ahnungslos man ist, wie hilflos, wenn ein Mensch stirbt. Sie trauert und stellt fest, dass sie erschreckend wenig über sich und ihr eigenes Weltbild weiss. Zwischen Intensivstation, Friedhof, Schreiben und Alltag versucht sie, wieder Fuss zu fassen. Sie fragt sich, ob sie das Unglück vielleicht angezogen habe, weil es ihr immer schon leichter fiel, traurig statt glücklich zu sein. Und sie stellt fest, wie verrückt es ist, dass man trotzdem jeden Tag beginnt, als wäre man unsterblich. In «Bald wärmer» erzählt die Schweizer Schriftstellerin Mireille Zindel, warum Zoé gehen musste und wie sie als Mutter das Weiterleben lernte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mireille ZindelBald wärmer
Mireille Zindel
Bald wärmer
Pano – Ein Imprint von TVZ
Der Theologische Verlag Zürich wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
Bibliografische Informationder Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Umschlaggestaltung
Doris Grüniger, Zürich
www.buchundgrafik.ch
Bild: Adobe Stock Premium
Layout und SatzWeiß-Freiburg GmbH – Grafik und Buchgestaltungwww.weiss-freiburg.de
Druck
CPI Books GmbH, Leck
ISBN 978-3-290-22073-0 (Print)
ISBN 978-3-290-22074-7 (E-Book: PDF)
© 2024 Pano – Ein Imprint von TVZ
www.pano.ch
Alle Rechte vorbehalten
Publiziert mit der freundlichen Unterstützung von Stadt Zürich Kultur und der Kulturförderung des Kantons Zürich.
Meinen Kindern
7
1
Das ist alles. Was, wenn ich ehrlich wäre? Ein Mensch stirbt, und nichts ist mehr wie früher.
Ein Mensch stirbt. Versuchen Sie, sich das zu verge-genwärtigen. Sechs Jahre ist es her, dass meine Tochter gestorben ist. Sie starb am 2. August. Sie war zwölf Tage alt.
«Zwölf Tage, die ein Leben sind», sagte Psychiater S.
Zoé bedeutet auf Griechisch Leben. Als Wim und ich den Namen wählten, waren wir ahnungslos.
Auf der Intensivstation des Züricher Kinderspitals brach-ten sie uns in ein leeres Zimmer, wo wir allein waren; Zoé, Wim und ich. Wir waren in diesem Raum, damit sie sterben konnte. Sie würden das Beatmungsgerät ab-stellen. Ich hielt sie in meinen Armen.
Wir sind zu zweit, als wir das Spital gegen zehn Uhr abends verlassen, und doch werden Wim und ich kei-nen Tag mehr ohne sie sein. Sie bleibt anwesend, indem sie uns verwandelt.
8
Es ist eine warme Sommernacht. Der Mond scheint und alles wirkt friedlich. Nicht einmal der geparkte Rettungswagen vor dem Haupteingang kann daran etwas ändern. Ich wundere mich, wie idyllisch die Welt aussieht, trotz des Leids, das in ihr ist. Alles existiert gleichzeitig: das Schöne und das Traurige. Was trivial tönt, ist eigentlich unglaublich, und ich begreife das in eben diesem Augenblick.
Warum stehen wir vor dem Haupteingang, obwohl unser Wagen in der Tiefgarage steht? Wollten wir an die frische Luft? Den Aufbruch hinauszögern? Wie konn-ten wir jemals ohne sie nach Hause fahren?
Wir schieben das Ticket in die automatische Schranke an der Ausfahrt und während wir im Auto darauf warten, dass sich die Barriere öffnet, denke ich: Nie wieder kann mir etwas derart Schlimmes zustos-sen, ab jetzt kann ich alles tun, ich habe nichts mehr zu verlieren. Dann fahren wir aus der Tiefgarage hinaus in die sternenlose Nacht.
Auf dem Nachhauseweg müssen wir auf Verord-nung der Ärzte ein Medikament für schnelles Abstillen besorgen. Die Gefahr, vom Spital direkt nach Hause fahren zu müssen, ist somit abgewendet. Ob die Ärzte genau das beabsichtigt haben, frage ich mich einen Augenblick. Und gleich darauf: Wer hätte uns denn nachempfinden können?
Jedenfalls ist es eine von vielen glücklichen Fügun-gen, denen Wim und ich es vielleicht verdanken, dass wir nicht an unserem Unglück zerbrochen sind. Wie konnten
9
wir jemals ohne sie nach Hause fahren? Aberwir sind nach dem Tod unserer Tochter eben nicht ohne sie vom Spital nach Hause gefahren, Wim und ich sind einen Umweg gefahren, das ist die Antwort auf die Frage.
Nur die eine Apotheke in der Stadt ist vierundzwan-zig Stunden geöffnet. Wim hält in der Nebengasse im Parkverbot und bleibt im Wagen. Ich steige aus, biege um die Ecke und sehe mich plötzlich vor einem Riesen-rad und Marktbuden mit bunten, blinkenden Lichtern auf dem menschenvollen Sechseläutenplatz stehen. Ich staune, wie ausgelassen die anderen leben, obwohl auch sie sterblich sind. Wie können die Menschen sich wohl-fühlen, obwohl es ihre Bestimmung ist, zu sterben? Ich bin überzeugt, mich nie mehr über eine laue Sommer-nacht mit Marktbuden und Musik freuen zu können, zumal ich es bisher schon nie konnte. Ob ich das Un-glück deshalb angezogen habe? Gibt es so etwas wie eine Veranlagung zum Leid, die weiteres Leid anzieht? Es ist mir schon immer leichter gefallen, traurig als glücklich zu sein, werfe ich mir plötzlich vor. Als ob ich einen Gendefekt durch das, was ich ausstrahle, fühle oder denke, hätte anziehen können. Als ob ich nicht genau wüsste, dass es angeboren war.
In unserem leeren Zuhause essen Wim und ich eine Gemüsesuppe, die seine Mutter am Morgen zubereitet hat. Im Lauf des Tags ist sie zu sich nach Hause zurück-gekehrt, um uns am aussichtslosesten aller Abende in Ruhe zu lassen oder vielleicht auch nur, um sich selbst zu schützen.
10
Und jetzt greife ich vor:
Nach Zoés Tod wurde mein Leben zu einer zusam-menhanglosen Aneinanderreihung von Ereignissen, die sich alle um einen blinden Fleck gruppierten. Jeder übergeordnete Sinn war verloren gegangen. Zeitweise war ich insgeheim verrückt und glaubte, dass sie zu-rückkehren würde.
Ich bekam zwei Söhne.
Ich wurde wieder glücklich, ich wurde wieder fröh-lich und ich wurde wieder unverbesserlich oberfläch-lich und undankbar. Aber ich habe mir nie wieder Illu-sionen darüber gemacht, wohin das alles führen wird: Wir sind sterblich. Es ist eine banale Einsicht, aber es handelt sich um ein Wissen, das mit dem Tod meiner Tochter plötzlich schmerzhaft greifbar wurde.
Das Absurde aber ist: Obwohl ich die Augen vor dem Tod nicht mehr schliessen kann, fange ich jeden Tag von vorne an, als wäre ich unsterblich. Mehr kann ich nicht tun, als lebendig und tätig zu leben. Das ist alles. Das ist es, was zu tun ist.
11
2
Snackautomat. Ich weiss noch genau, wie sie aus-sieht. Ihre Augen, ihr Lächeln. Ich sehe sie vor mir und schliesse sie in meine Arme. Das ist es, was mir am meisten fehlt: sie an mich zu drücken. Die Trauer um mein Kind ist oft körperlich: Ich will mich um sie kümmern, aber es gibt nichts, das ich für sie tun kann.
«Das Leben geht weiter», sagte mein Schwager zu mir, als wir erfahren hatten, dass ihre Krankheit in den Tod führen würde. Es war im gelben Gang der Intensiv-station A. Vor Kinderzeichnungen und Tierfotografien an den Wänden. Er legte seinen Arm um meine Schul-tern und sagte es.
Ich wusste schon damals: Das ist zu einfach. Aber ich sagte nichts. Heute weiss ich es mit Gewissheit, und deshalb sage ich es: Das Leben geht nicht einfach weiter, es verändert sich. Der Tod ist einschneidend. Er trennt alles in ein Vorher und ein Nachher. Deshalb fürchten wir uns vor ihm. Das Leben wird wirklicher, echter, realer. Grausame wie schöne Facetten kommen
12
hinzu. Schönere, als man sich jemals zu hoffen erlaubt hätte, als man noch nichts von dieser Art von Leid wusste. Man weiss mehr als zuvor. Man ist nicht mehr dieselbe Person. Man ist im Besitz eines Wissens, das die Menschen in zwei Gruppen teilt. Wer den Tod noch nicht kennt, lebt an einem anderen Ort und in einer anderen Zeit als diejenigen, die ihn kennen. Man kann niemandem einen Vorwurf machen. Man wünscht nie-mandem, einen geliebten Menschen zu verlieren. Man wünscht keinem, dieses Wissen zu erwerben.
Bekannte von uns, Caspar und Fiona, haben ihre Tochter Sara im Alter von fünf Wochen verloren. Was hat Caspar gemacht, als er das Spital verlassen hat? Was am nächsten Tag? Am übernächsten? Schien die Sonne? Traf er Freunde? Wollte er allein sein? Fuhr er im Auto vom Spital direkt nach Hause, nachdem sein Kind ge-storben war? Gab es Musik im Auto? Welche? Zu sei-nen Gefühlen stelle ich mir nicht viele Fragen, weil zu erwarten ist, dass es ihm schlecht ging. Wie schlecht? Auf welche Art schlecht? Ich möchte nicht im Schmerz anderer wühlen.
Gab es einen Snackautomaten im Spital? Hat er dort etwas gekauft? Was waren seine Gedanken? Gedanken würden mich interessieren. Welche Verbindungen stellt der Trauernde her? Ging seine Frau schwimmen? Weshalb schwimmen? Es scheint mir zwar eine nahe-liegende Tätigkeit zu sein, nachdem man sein Kind ver-loren hat: schwimmen. Hat er seine Kleidung vernach-lässigt? Seine Körperpflege? Kam ihm alles unnütz vor?
13
Ging er wieder arbeiten? Wann? Wie viele Tage nach dem Verlust? Wann hat seine Frau wieder zu arbeiten begonnen?
Ich stelle fest, dass man sich als Aussenstehende vor-sichtig und behutsam an einen Verlust herantastet. Man klammert sich an Snackautomaten, Wetter und Musikstücke, die im Auto liefen.
Jetzt, wo ich dies schreibe, sind Wim und ich seit elf Jahren zusammen. In ein paar Monaten wird Zoé sechs Jahre tot sein. Wir haben zwei gesunde Söhne, Joachim und Antonìn.
Ich wollte dieses Buch nicht schreiben. Ich schrieb an einer anderen Geschichte, die mir jedoch plötzlich unbedeutend vorkam. Egal, was ich schrieb, ich war damit nicht zufrieden. Erst als dieser Satz plötzlich aus dem Nichts auftauchte – Was, wenn ich ehrlich wäre?–, wusste ich, welches Thema wirklich drängte. Offenbar kann ich es mir jetzt erlauben, über sie zu schreiben. Offenbar muss ich die Gedanken an sie nicht mehr bei-seiteschieben. Offenbar ist das Gegenteil der Fall: Ich muss diese Geschichte zuerst erzählen, damit ich nicht mit dem Schreiben aufhöre. Sie würde mir und jedem weiteren Buch im Weg stehen. Sie hat sich vor meinen Augen abgespielt und sie muss raus, damit ich sie be-greifen kann und aus meinem Kopf kriege.
Ich weiss nicht, ob es ein aufrichtiges Buch werden wird, ob wir die Wahrheit erzählen können, oder ob nicht schon allein unsere Erinnerung uns täuscht. Ob wir nicht umso mehr zu verdrängen beginnen, je mehr
14
wir die Wahrheit zu sagen versuchen, aus dem einfa-chen Grund, um uns selbst und andere zu schützen.
Also erzähle ich, was ich weiss.
15
3
Hektik. Die Diagnose Spinale Muskelatrophie, SMA, erhielten wir, als Zoé zehn Tage alt war. SMA Typ 0. Obwohl ich dabei gewesen bin, obwohl ich die Krank-heit gesehen habe, benötige ich Hilfe aus dem Internet, um sie an dieser Stelle zu beschreiben. Nicht nur, weil mir das medizinische Vokabular fehlt. Auch weil ich zu umgehen versuche, mir die Krankheit in Erinnerung zu rufen. Weil es mir leichter fällt, Worte zu übernehmen, die bereits für diese Krankheit verwendet wurden, als sel-ber neue in die Welt zu setzen. Weil ich der Welt keine neuen Worte über diese Krankheit hinzufügen möchte, weil ich sie insgeheim noch immer ungeschehen ma-chen möchte, indem ich nicht über sie rede.
Was ich finde, ist in etwa folgende Erklärung: Bei der Spinalen Muskelatrophie handelt es sich um eine Mus-kelerkrankung, die mit dem fortschreitenden Rück-gang von Nervenzellen im Rückenmark zusammen-hängt. Damit können Impulse vom Gehirn nicht mehr an die Muskeln weitergeleitet werden, woraus Muskel-
16
schwund entsteht. SMA beeinträchtigt alle Muskeln und wird in vier Kategorien eingeteilt. Die einzelnen Formen werden je nach Erkrankungsbeginn und Schweregrad unterschieden. Bei der neonatalen Vari-ante 0 der Krankheit versterben die Kinder manchmal schon im Mutterleib. Wird das Kind lebend geboren, wird es höchstens zwei Wochen alt. Die Hautsensibilität und die Sinneswahrnehmungen sind nicht betroffen. Es gibt also keine Empfindungsstörungen oder Prob-leme mit dem Sehen oder Hören. Auch die Funktion der inneren Organe sowie von Blase und Darm bleibt erhalten. Die geistige Leistungsfähigkeit ist ebenfalls nicht beeinträchtigt, es gibt sogar Hinweise, dass Pa-tienten mit spinaler Muskelatrophie als Gruppe leicht überdurchschnittliche kognitive Leistungen erbringen, ungewöhnlich geistig wach und kontaktfreudig sind.
Während ich Informationen sammle, um diesen Ab-schnitt zu verfassen, werden Bilder lebendig, die mich den Text aus dem Internet verstehen lassen. Mit meinem eigenen Text verhält es sich ein wenig anders. Seltsamer-weise fürchte ich, er könnte unverständlich sein. Als wäre es nicht mir passiert. Nicht meiner Tochter.
Tatsächlich habe ich ihre Krankheit streckenweise nicht gesehen. Ich habe nur sie gesehen. Auch wenn mir nichts entging. Zoé kam lebend zur Welt und musste wiederbelebt werden, weil sie nicht atmete. Ohne medi-zinische Hilfe wäre sie gestorben. Sie konnte Arme und Beine nicht bewegen, nicht schlucken und keinen Laut von sich geben. Ihre Mimik aber war umso lebhafter.
17
Intensivstation. Beatmungsgerät. Das Piepsen der Maschinen. Die Alarmsignale. Das Gurgeln in den Schläuchen. «Diese Soundkulisse», hat Caspar dazu ge-sagt, als wir kürzlich über unsere Erfahrungen auf der Intensivstation sprachen. Sechs Jahre ist es her, dass wir unsere Töchter dort zurücklassen mussten, aber erst heute tauschen wir hie und da und völlig unerwartet Erlebnisse aus dieser Zeit untereinander aus. Seine Tochter war auf der Intensivstation B. Ich rede von der Intensivstation A. Kinder jeden Alters, von null bis sechzehn. Kinder, die schreien. Kinder, die sich nicht bewegen. Es gibt diejenigen, für die Hoffnung besteht, und es gibt die anderen. Alle sind im selben Raum. Alle sind vergänglich.
Was ist an einem Ort, an dem einem die Vergäng-lichkeit so vor Augen geführt wird, noch von Bedeu-tung? Nicht einmal die Ärzte sind es. Wenn man ein Kind verliert, weiss man es auch ohne Ärzte, Bild-schirme und Diagnosen. Wenn man es nicht verliert, weiss man es auch. Ich wusste, dass ich Zoé verlieren würde, unmittelbar nachdem sie geboren war. Nicht vorher. Keine Sekunde früher. Die ganze Schwanger-schaft, neun Monate lang, war alles bestens gewesen. Nach der Geburt aber schrie sie nicht.
«Warum schreit sie nicht?», fragte ich Wim. Da war Zoé bereits in ein anderes Zimmer verlegt und ein Notfallteam aus dem Kinderspital alarmiert worden. Kurz vor der Geburt hatte die Hebamme nach wie-derholtem Blick auf den Herzton- und Wehenschrei-
18
ber telefonisch eine Ärztin dazu geholt. Die Ärztin, die kam, hatte nach einem Blick auf die Herzton- und Wehenkurve sofort eine weitere Ärztin gerufen. Die beiden Ärztinnen entschieden zusammen, sie müssten das Baby jetzt schnell auf die Welt holen, und taten das mithilfe einer Saugglocke. «Ein Sterngucker», sagte die Hebamme fröhlich, kurz bevor Zoé auf der Welt war. «Eine Hand liegt neben ihrem Kopf», sagte eine Ärztin erstaunt. Als Zoé da war, brach Hektik aus.
Die grössten Erinnerungslücken, die ich habe, be-treffen die Momente unmittelbar nach der Geburt. Ich hob meinen Kopf und sah ein kleines Wesen mit blauer Haut. Ich erschrak ab der blauen Färbung der Haut und liess mich wieder auf das Kissen zurücksin-ken. Warum schreit sie nicht?
Man hatte Zoé hinausgebracht. Kam jemand zu mir und sagte: «Ein Notfallteam aus dem Kinderspital ist jetzt bei ihrer Tochter»? Und falls ja: Wer sagte es mir?
Einige Minuten, nachdem Zoé aus dem Gebärsaal hinausgebracht worden war (waren es fünf Minuten? Dreissig?), überreichte mir eine Pflegerin, die Anteil nahm und sich nützlich machen wollte, ein Polaroid-foto, das sie von meiner Tochter gemacht hatte, als das Notfallteam übernommen hatte. Auf diesem Foto sah ich zum ersten Mal ihr Gesicht. Dieses wunderschöne, lebendige Gesicht meines Mädchens. Ich sah ein dünnes Baby mit schwarzen Haaren, geschlossenen Augen und bläulicher Haut, eine Sauerstoffmaske über dem kleinen Antlitz, die von einer grossen Hand gehalten wurde.
19
Nochmals später kamen ein Arzt und zwei Pflege-rinnen, die mir alle drei sehr jung vorkamen und die ich noch nie gesehen hatte (das Notfallteam aus dem Kinderspital, wie mir klar wurde), mit einem Rollbett zu mir hinein, darin lag sie, mein Kind, meine Tochter, Zoé.
Das Erste, das ich an ihr bemerkte, war ihr lebhafter Blick. Sie lag auf dem Rücken und schaute zur Decke und nach links zu mir. Sie hatte die Augen weit offen und sah mich freundlich und neugierig an. Das war der erste Anblick, den ich von ihr hatte, das erste eigene Bild, das ich mir von ihr machen konnte, während das Notfallteam ihr Bett aus durchsichtigem Plexiglas durch den Raum bis nahe an mein eigenes Bett schob, damit ich sie sehen konnte.
Während ich das schreibe, wird mir bewusst, dass ich bloss die Augen zu schliessen brauche, um diese Bilder wachzurufen: Zoé, wie ich sie das erste Mal in ihrem Bettchen sah, und Zoé auf dem Polaroidfoto, das erste Bild, das ich von ihr sah, aber das ich mir nicht von ihr machen wollte, weil es nicht mein eigenes Bild von ihr war. Ich war nicht einmal bei ihr gewesen, als dieses Foto gemacht worden war. Ich wollte keine Auf-nahme von meiner Tochter, die in einer Situation ge-macht worden war, in der ich nicht bei ihr hatte sein können. Dieser unnatürliche Umstand, dass ich nicht bei ihr gewesen war, war mindestens so nachteilig für das Bild wie die Sauerstoffmaske, die ich darauf sah, aber seltsamerweise weitgehend zu ignorieren schien.
20
Dann drängte das Notfallteam zum Aufbruch.
Zoé wurde im stabilen Zustand ins Kinderspital Zürich überführt. Im stabilen Zustandwar die einzige Information, die ich bekam. Vielleicht erfuhr ich noch, dass sie auf die Intensivstation verlegt werden würde, ich habe keine Erinnerung daran. Ich wusste auch, dass sie reanimiert worden war, weil sie nicht geatmet hatte. Aber ich erfuhr keine Details, weder darüber, was sie mit ihr gemacht hatten, nachdem sie aus dem Zimmer gebracht worden war, noch Prognosen für die Zukunft. Vermutlich, weil sich zu diesem Zeitpunkt noch keine Prognosen stellen liessen. Die Entwicklung der Situa-tion schien noch in alle Richtungen offen.
In keiner Phase zweifelte ich am Können der Ärzte. Bis heute habe ich das Gefühl, dass alle alles richtig ge-macht und ihr Bestes gegeben haben. Auch wenn ich jetzt die Situation zu rekonstruieren versuche: Ich sehe nirgends einen Fehler; niemand trägt Schuld.
Ich erhielt nur wenig Informationen (aufgrund der gebotenen Eile, Zoé intensivmedizinisch zu versorgen), aber das Bild mit der Sauerstoffmaske, die Tatsache, dass sie nicht geschrien hatte, und das Notfallteam des Kinderspitals waren auch Hinweise. Als diese Leute in weissen Kitteln mit ihr zum Kinderspital aufgebrochen waren, sagte ich zu Wim: «Wir werden sie verlieren.»
Da lag ich noch auf dem Entbindungsbett. Ich wusste es, noch bevor ich sie zum ersten Mal in den Armen gehalten hatte.
Ist der Rettungswagen mit Blaulicht ins Kinderspital
21
ans andere Ende der Stadt gefahren? Mit Sirenen? Ich weiss es nicht und ich habe aus Angst vor quälenden Bildern auch nicht gefragt.
Lag es am Adrenalin, das man ihr verabreicht hatte, dass sie so hellwach um sich geblickt hatte? Ich glaube, einmal gelesen zu haben, dass man bei Reanimationen Adrenalin gibt. Ich könnte im Kinderspital nachfragen oder die Protokolle anfordern. Und tue es nicht.
22
4
Geburt. Am Morgen der Geburt wachte ich früh auf, ging in die Küche, um wie gewohnt (auf Anraten meiner chinesischen Ärztin) Tee und Porridge zuzu-bereiten, und war über das Ziehen im Bauch nicht sonderlich beunruhigt, da nur noch fünf Tage bis zum errechneten Geburtstermin fehlten. Danach ging ich unter die Dusche, fühlte mich auf einmal nicht ganz wohl und übergab mich noch unter der Dusche.
Ich legte mich wieder ins Bett und wurde kurz dar-auf von einem lauten und mir unbekannten Geräusch aufgeschreckt. Wasser floss schwallartig über die Laken. Wim führte am anderen Ende der Wohnung ein Tele-fongespräch. Er besprach sich mit einem Kunden, den er drei Stunden später treffen sollte. Auf mein Rufen hin kam er herbeigeeilt. Wir fuhren ins Stadtspital, das Spital, das wir schon im Voraus für die Geburt ausge-sucht hatten.
Bevor ich in den Gebärsaal geführt wurde, wurde ich von einer Hebamme in selbstgestrickten Socken in
23
Empfang genommen. Ich erwähne die selbstgestrick-ten Socken, weil sie für mich der Inbegriff all dessen waren, was ich nicht war: bodenständig, unempfind-lich, selbstzufrieden. Die Hebamme grüsste mich kaum. Die Schmerzen der Wehen waren so unerträglich, dass ich nur noch gebückt stehen und gehen konnte, aber das schien ihr keinen Eindruck zu machen. Sie beein-druckte weder eine geplatzte Fruchtblase noch Erbre-chen noch ein Zustand, der nahe an Apathie kam.
Instinktiv wusste ich, dass dies nicht auf ihre Pro-fessionalität zurückzuführen war, sondern auf ihren Widerwillen, Anteil zu nehmen. Ich hoffte, dass ihre Dienststunden bald vorbei sein würden. Es war acht Uhr morgens, als ich im Spital angekommen war. Vielleicht hatte sie Nachtdienst gehabt und würde bald gehen.
Kommentarlos begann sie in einem Vorraum den Rhythmus der Wehen zu messen, prüfte die Öffnung des Muttermundes, legte mir einen Katheter. Wie sich herausstellte, blieb sie an meiner Seite und wurde nicht durch eine andere Fachkraft abgelöst. Ich sagte mir, dass ich Pech gehabt hatte mit der Personalbesetzung an diesem Tag.
Als das erste Mal eine Ärztin hinzukam und irritiert reagierte, dass sie nicht über den Katheter informiert worden war, glaubte ich zu bemerken, dass die Heb-amme nicht nur bei mir nicht besonders beliebt war. Leider verliess uns die Ärztin kurz darauf und ich war wieder allein mit den selbstgestrickten Socken. Sie führte mich in den Gebärsaal.
24
Der Gebärsaal war ein kahler Raum, der nach Spital roch und die Atmosphäre einer Abstellkammer hatte. Geräte überall. Hellgraue Vorhänge, die aus dem Tages-licht bleiernen Nebel machten.
Stunden später, als ich eine Periduralanästhesie ver-langte, sagte die Pflegerin, die am anderen Ende des Raums mit dem Rücken zu mir mit dem Aufräumen eines Schranks beschäftigt war: «Ach! So ein Wehchen können Sie doch einfach wegatmen.» Ich erinnere mich, am Wort «Sadistin» herumgedacht zu haben. Sie hatte sich nicht einmal umgedreht und mich angeschaut, sie hatte einfach weiter den Schrank aufgeräumt. Ich bat noch einmal um eine Periduralanästhesie. Diesmal igno-rierte sie es und ich erhielt gar keine Antwort mehr. Als sie kurz darauf in die Kaffeepause ging, fragte ich ihre Vertretung, eine freundliche, junge Hebamme, ob nicht sie bei mir bleiben könne, bis die Geburt vorüber sei. Sie regelte das, indem sie ein kurzes Telefongespräch führte, und ich sah die selbstgestrickten Socken nie wieder. Die neue, freundliche Pflegerin veranlasste, dass die Anäs-thesistin endlich kam. Als diese mir den Katheter legte, beugte sie sich zu mir runter und fragte: «Geht es Ihnen gut? Können Sie mich hören? Können Sie sprechen?» Da wurde mir klar, dass ich die ganze Geburt hindurch kaum gesprochen hatte. Ich hatte die Augen geschlossen und lag zusammengekrümmt auf dem Entbindungs-bett. Auf Fragen hatte ich nur mit Nicken und Kopf-schütteln geantwortet. Die Stille, sie war schon während der Geburt und inmitten der Hektik eingetreten.
25
5
Wie im Flugzeug. Am Abend der Geburt fuhr Wim ins Kinderspital, um Zoé zu besuchen. Ich hatte Bettruhe verordnet bekommen, da die Plazenta operativ entfernt worden war. Allein in einem Einzelzimmer der Wöch-nerinnenstation lauschte ich hinter geschlossener Tür den Schreien von Neugeborenen anderer Mütter. Es war totenstill in meinem Zimmer. Als dürfte ich am Leben nicht teilnehmen. Meine Gedanken waren bei Wim. Ich hoffte, dass er keine traumatischen Erlebnisse im Kinder-spital hatte. Ich dachte nicht daran, dass ich selber gerade traumatische Erfahrungen machte. Ich würde immer ir-gendwie zurechtkommen, dachte ich damals.
Heute weiss ich, dass ich verwundbar bin. Ich glaube nicht mehr, dass ich immer irgendwie zurechtkommen werde. Das ist vorbei. Ich weiss, dass mein Wohlerge-hen von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Damals aber, mitten in der Katastrophe und bis ich zwei ge-sunde Kinder zur Welt gebracht hatte, trug mich der Gedanke, ich sei unzerstörbar, über alles hinweg.
26
Eine Pflegerin hatte zwei Fotos von Zoé auf A4-Papier farbig ausgedruckt und mir in die Maternité gebracht. Es war nett gemeint, aber ich hatte Angst, mir die Bilder anzusehen, denn wie mir ein flüchtiger Blick darauf verraten hatte, war ihr Hinterkopf von der Saugglocke geschwollen, ihre Augen tränten, und ein grosser Schlauch, der mit weissem Klebeband an ihrer Wange befestigt war, kam aus ihrem Mund, ein anderer, dünnerer, aus ihrer Nase. Seit der Aufnahme mit der Polaroidkamera war sie intubiert worden. Die Schläuche waren mir nicht aufgefallen, als sie in ihrem Bett an mein Bett gebracht worden war. Ich hatte sie einfach nicht gesehen oder übersehen. War es Absicht oder nicht, dass ich die Schläuche nicht gesehen hatte? Man weiss nichts, nicht einmal über sich selbst.
Ein einziges Foto existiert von ihr, auf dem sie nicht durch einen Schlauch atmet: das Polaroidfoto mit der Sauerstoffmaske. Das Foto, das aufgenommen wurde, als ich nicht bei ihr war.
Auch bei den neuen Bildern, die man mir gebracht hatte, war ich nicht dabei gewesen. Ich wollte mein Kind nicht durch die Augen einer fremden Person sehen. Ich wollte selber bei meiner Tochter sein.
Die neuen Fotos lagen auf einem Gestell und ich ver-mied es, sie anzusehen, wenn ich vom Bett aufstehen musste, um ins Bad zu gehen. Und ich musste sie auch gar nicht anschauen, denn ich kannte sie nach einem einzigen Blick darauf schon auswendig. Noch heute kenne ich alle Fotos von Zoé, es müssen um die hundert sein, auswendig.
27
Nachdem sie gestorben war, hatte ich lange ein Bild von ihr aufgestellt, das sie besonders zufrieden zeigt. Eines Tages habe ich das Foto in eine Schublade gelegt, später wieder hervorgeholt und noch etwas später wie-der weggeräumt.
Kürzlich ist mir eine Karte in die Hände gefallen, die Wim und ich zum ersten Todestag an die beiden Patin-nen und Paten versandt haben. Darauf ist ein anderes Bild von ihr zu sehen. Ich habe die Karte in meinem Arbeitszimmer aufgehängt und später wieder herunter-genommen. Gegenwärtig ist kein Bild von ihr in der Wohnung aufgestellt. Um ihr nahe zu sein, sind Bilder hinderlich. Ich glaube, das ist das Kriterium, nach dem ich Fotos von ihr aufstelle und wieder verstaue.
In dieser ersten Nacht auf der Maternité kam ein Brief. Die junge Hebamme aus dem Gebärsaal. Sie schrieb, dass es ihr leidtue, Zoé auf der Intensivstation des Kinderspitals zu wissen. Ich legte den Brief weg. Es würde keine Antwort von mir geben. Insgeheim bereitete ich mich bereits darauf vor, nichts mehr mit diesem Spital zu tun zu haben. Schon bald würde ich mit Zoé nach Hause gehen und diese unglückliche Episode hier ungeschehen machen. Ungeschehen. Ein Wort aus der Zauberkiste.
«Sie können jederzeit ein Gespräch mit uns verein-baren und die Protokolle einsehen. Egal wann. Manch-mal tauchen die Fragen auch erst Jahre später auf …» Die Assistenzärztin, die das kurz vor der Entlassung zu mir sagte, schien meiner Aufgeräumtheit zu miss-
28
trauen. Oder sie spürte den undurchdringlichen Wall, den ich um mich herum errichtet hatte, und argwöhnte, dass dieser eines Tages einbrechen müsste. Tatsache ist, dass mir bis heute keine Frage unter den Nägeln brennt. Der Wall diente als Schutz vor diesem Spital, wo ich mich nicht wohl fühlte. Die vermeintliche Auf-geräumtheit war in Wahrheit vorwärtsgerichtetes Den-ken: Ich wollte zu Zoé, Zoé retten, Zoé kennenlernen. Ich interessierte mich schlicht und einfach nicht mehr für den Ort, von wo sie weggebracht worden war. Wo sie nicht war, da wollte ich auch nicht sein.
Es war ausserdem ein Zeichen meiner Abneigung gegen Selbstmitleid, dass ich mich ruhig verhielt, und ich hatte auch einfach keine Zeit, mich im Leid zu suh-len. Es gab viel zu tun.
Nachdem sie gestorben war, erhielten Wim und ich einen Brief aus dem Kinderspital. Dr. F., der leitende Arzt der Intensivstation, schrieb, wie sehr es ihn beein-druckt hatte, dass wir jederzeit gefasst, offen für die Rea-lität und gleichzeitig unserer Tochter zugewandtgewesen waren. Ihrer Tochter zugewandt, das konnte ich verste-hen. Gefasst? Das entzog sich meinem Verständnis. Was hätten wir denn sonst tun sollen?
Ich las ausserdem: Auf Ihr Kind fokussiert. Und trotz-dem die Tatsachen akzeptierend. Ich erinnerte mich, dass die Ärzte aus dem Kinderspital darauf hingewiesen hatten, wie interaktiv Zoé sei. Dass dies für ihr Alter ungewöhnlich sei. Dass sie noch nie eine Familie erlebt hätten, die so aufeinander ausgerichtet sei. Kaum wür-
29
den Wim und ich an ihr Bett treten, sei sie aufmerksam und auf uns fokussiert, genauso wie wir auf sie. Doch mir war auch klar, dass ich die Tatsachen damals nur scheinbar akzeptiert hatte. In Wirklichkeit hatte ich sie nicht anerkannt. In diesem Punkt täuschte sich Herr F.
Vielleicht war auch die Nähe und Verbundenheit zu Wim ein Grund, weshalb wir nicht an unserem Schick-sal zerbrochen sind. Ich schreibe unserem Schicksal, ob-wohl ich mir nicht sicher bin, ob wir dasselbe erlebt haben.
Oder ich verfüge über genug Resilienz, diese seeli-sche Widerstandskraft, von der Psychiater sprechen. Vordergründig konnte ich mich der neuen Situation tatsächlich gut anpassen. Auch wenn ich nicht auf der Maternité hätte frühstücken sollen, in einem Raum voller Mütter mit ihren Neugeborenen. Wie konnte ich überhaupt essen? Aber das Festhalten an Ritualen geschah ganz automatisch. Es ist mir auch nicht in den Sinn gekommen, nicht zu schlafen, um ständig bei meiner Tochter zu sein. Es muss instinktiv geschehen sein, als verlässlicher Ritus und Schutz in einer schwie-rigen Situation. Denn hätte ich nicht gegessen und geschlafen, wäre ich früher oder später zusammenge-brochen und damit wäre niemandem gedient gewesen, auch nicht meinem Kind.
So kam es, dass ich auf der Maternité frühstückte, obwohl ich nichts anderes wollte, als zu meiner Toch-ter zu gehen. Da sass ich im Frühstücksraum und strich mir ein Honigbrot. Es erinnerte mich an die Sauerstoff-
30
masken im Flugzeug: Zuerst muss man sich selber eine überziehen, bevor man anderen damit hilft. Das leuch-tete mir ein. Mein eigenes Verhalten aber befremdete und beschämte mich.
31
6
Die Frage nach dem Sinn. Mit dem Verlust eines geliebten Menschen kommt fast immer der Moment, an dem einem alles sinnlos erscheint. Das Riesenrad und die Marktbuden.
«Die Frage nach dem Sinn stellt man sich nicht, wenn man zufrieden ist», sagte Psychiater S. zu mir. «Die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt man sich nur, wenn es einem schlecht geht.»
Ich suchte Dr. S. auf, weil ich dachte, dass es das ist,