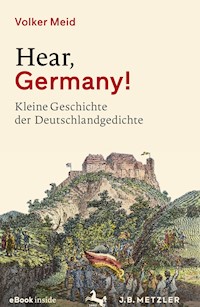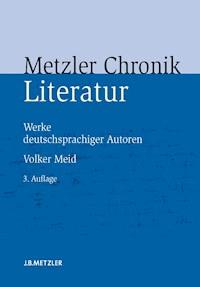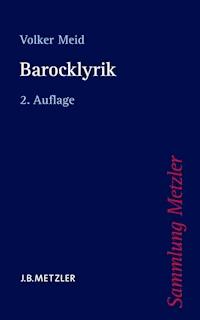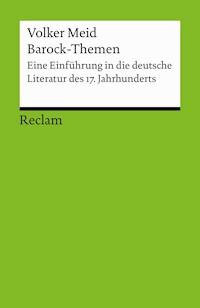
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Die deutsche Literatur des Barockzeitalters gehört zwar zum kanonischen Studienprogramm der Germanistik, aber dem ersten Anschein nach wirkt sie fremd und schwer verständlich. Volker Meid, einer der besten Kenner der Zeit und ihrer Dichtung, unternimmt in diesem eher kurzgefassten Buch einen dezidierten Neuansatz zur Einführung. Er geht von den großen Themen aus, die im 17. Jahrhundert das Leben bestimmten, die Geister schieden, die öffentliche Diskussion beschäftigten und die Literatur aller Gattungen so sehr faszinierten, dass ein heutiges Verständnis die formalen Hürden überwindet: Staat, Herrschaft und Widerstand, Religion und Konfession, der Krieg, die Gesellschaft und ihr Versagen, Welterfahrung in Reisen und Wissenschaft, die Sprache und der professionalisierte Literaturbetrieb.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Volker Meid
Barock-Themen
Eine Einführung in die deutsche Literatur des 17. Jahrhunderts
Reclam
Alle Rechte vorbehalten
2015 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2015
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-960856-3
Inhalt
I. Epoche
Geschichte
Diese Einführung behandelt die Periode von den ersten literarischen Reformbestrebungen um 1600 bis zum Durchbruch des aufklärerischen Denkens in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts. Es ist eine Epoche der konfessionellen Antagonismen, tiefgreifender politischer Veränderungen, verheerender Kriege und ökonomischer Krisen, eine Zeit der durch Seuchen, Katastrophen und Hexenwahn ausgelösten bzw. gesteigerten existentiellen Angst und der Erwartung der Endzeit, geprägt durch die Spannung zwischen den religiösen Vanitasvorstellungen und der Bewährung in der realen Welt, zwischen überlieferter christlicher Weltauffassung und modernen, von Humanismus und Renaissance zur Aufklärung tradierten Denkformen und neuen naturwissenschaftlichen Ansätzen.
Den äußeren Rahmen bildet dabei ein kaum definierbares politisches und verfassungsrechtliches System, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das der Staatsrechtler Samuel Pufendorf 1667 in einem häufig zitierten Wort als »einen irregulären und einem Monstrum ähnlichen Körper« bezeichnete.1 Dieses »Mittelding« zwischen beschränkter Monarchie und Staatenföderation war ein historisch gewachsenes Gebilde aus einigen hundert weltlichen und geistlichen Territorien, dessen Verfassung letztlich noch auf dem mittelalterlichen Lehnswesen beruhte, während sich in einzelnen Territorien schon Tendenzen zu modernen staatlichen Organisationsformen bemerkbar machten.
Der Prozess der Schwächung der kaiserlichen Zentralgewalt hatte bereits im Mittelalter eingesetzt. Er erhielt eine neue Dynamik durch die Erfolge der reformatorischen Bewegungen, die im Augsburger Religionsfrieden von 1555 bestätigt wurden und eine weitere Stärkung der Reichsstände und damit vor allem der Territorialfürsten bedeuteten. Der Religionsfrieden gewährte den Landesherren Religionsfreiheit und das ius reformandi, d. h. das Recht, in ihren Ländern allein über Religionsangelegenheiten zu entscheiden. Zugleich nutzten die größeren Territorien die Möglichkeit, sich selbständig weiterzuentwickeln und ihre politischen Spielräume zu erweitern.
Das vorläufige Ende der Kämpfe der Reformationszeit konnte die Konfessionalisierung der Politik der folgenden Jahrzehnte nicht verhindern. Zahlreiche Streitpunkte blieben ungelöst. Das galt nicht zuletzt im Hinblick auf das ius reformandi, das etwa bei Reichsstädten mit einer konfessionell gemischten Bevölkerung Konflikte innerhalb der Stadt und mit der sie umgebenden Territorialherrschaft geradezu herausforderte. Außerdem ergab sich künftiger Konfliktstoff auch daraus, dass die Zwinglianer, Calvinisten und Täufer vom Frieden ausgeschlossen blieben und ohnehin keine der Parteien bereit war, die andere in ihrem Besitzstand endgültig anzuerkennen. Luthertum und Calvinismus betrieben ihre weitere Expansion, wobei sich gerade die calvinistischen Territorien in der Folgezeit als Alternative zum Machtanspruch des Hauses Habsburg in Position brachten. Die katholische Kirche wiederum organisierte auf der Grundlage der 1564 vom Papst bestätigten Beschlüsse des Konzils von Trient die Politik der Rückgewinnung des verlorenen Bodens (›Gegenreformation‹ bzw. ›katholische Reform‹). Politik und Religion, politische bzw. dynastische und konfessionelle Interessen waren in diesem Prozess – auch über die Grenzen des Reichs hinaus – untrennbar miteinander verbunden.
Die durch den jeweiligen Ausschließlichkeitsanspruch der Konfessionen verschärften religiösen Auseinandersetzungen erreichten zu Anfang des 17. Jahrhunderts einen neuen Höhepunkt. Nach der Besetzung der mehrheitlich protestantischen Reichsstadt Donauwörth durch Truppen des bayerischen Herzogs Maximilian kam es zu einer formellen Blockbildung: 1608 schlossen sich lutherische und calvinistische Territorien und Reichsstädte zu einem Militärbündnis (›Union‹) zusammen, die katholische Seite reagierte 1609 mit der Gründung der ›Heiligen Liga‹, die ebenfalls ein Heer aufstellte. Die führende Rolle in der protestantischen Union übernahm die Kurpfalz, das erste Territorium des Reiches, in dem der Calvinismus eingeführt worden war (Heidelberger Katechismus 1563) und das enge Beziehungen zu den Protestanten in den Niederlanden, England, Frankreich und Böhmen unterhielt. Treibende Kraft in der katholischen Liga, der fast alle katholischen Reichsstände beitraten, war Bayern. Österreich beteiligte sich nicht an dem Bündnis, da es mit inneren konfessionellen Konflikten zu kämpfen hatte und in den Erblanden, aber auch in Böhmen und Schlesien den protestantischen Ständen mit Zugeständnissen entgegenkommen musste.
Zwar konnte eine militärische Auseinandersetzung zunächst vermieden werden – man schloss 1610 einen Vergleich –, doch mit dem Aufstand des protestantischen böhmischen Adels gegen die katholische habsburgische Landesherrschaft (›Prager Fenstersturz‹ 1618), dem Herrschaftsantritt Kaiser Ferdinands II. 1619 und der Wahl des calvinistischen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz zum böhmischen König im selben Jahr eskalierten die Konflikte zum ›großen teutschen Krieg‹, einem verheerenden deutschen und europäischen Krieg, in dem konfessionelle und machtpolitische Gesichtspunkte einander bedingten.
Als europäischer Konflikt gehört der Dreißigjährige Krieg zusammen mit den weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen des 17. und frühen 18. Jahrhunderts in den Kontext der Kämpfe um die Vorherrschaft in Europa, wobei auch konfessionelle Gesichtspunkte je nach Konstellation machtpolitischen Interessen weichen mussten. Es war letztlich ein Kampf zwischen Habsburg und Bourbon, in dem die französische Seite zunächst in der Defensive stand, bedroht durch die Einkreisungspolitik der habsburgischen Mächte Österreich und Spanien, die sich von den Pyrenäen über das vorderösterreichische Elsass und die besetzte Pfalz bis zu den Spanischen Niederlanden Frankreich entgegenstellten. Es gelang jedoch der französischen Politik, zusammen mit den Schweden, durch die Unterstützung der protestantischen deutschen Territorien die Umklammerung zu durchbrechen. Mit dem Frieden von Münster und Osnabrück 1648 und der Schwächung Spaniens im Pyrenäenfrieden von 1659 hatte sich Frankreich als führende europäische Macht etabliert. Ludwig XIV. nutzte in den folgenden Jahrzehnten den neugewonnenen und durch das Wiederaufleben der Türkenkriege – Belagerung Wiens 1683 – noch vergrößerten Spielraum für eine aggressive Expansionspolitik, wieder mit verheerenden Folgen für das Reich.
Im Rahmen des Deutschen Reichs war der Dreißigjährige Krieg ein Kampf um die Vorherrschaft zwischen Kaiser und Reichsständen, der aus den Unklarheiten der verfassungsrechtlichen Situation resultierte. Während es den Ständen darum ging, ihre seit dem Mittelalter erworbenen Rechte weiter auszubauen, versuchte Kaiser Ferdinand II. die zentrifugalen Tendenzen mit aller Macht aufzuhalten bzw. rückgängig zu machen. Nach anfänglichen Erfolgen scheiterte diese Politik am Widerstand der Stände und dem Eingreifen Schwedens in den Krieg. Die Bestimmungen des Westfälischen Friedens brachten dann die Auseinandersetzungen, soweit sie die Struktur des Reichs betrafen, zum Abschluss. Sie bedeuteten zugleich das Ende der absolutistischen Bestrebungen auf Reichsebene.
Der Friedensvertrag bestätigte die Rechte der Stände, ohne die in Reichssachen künftig kaum etwas geschehen konnte. Sie selbst erhielten jedoch Bündnisfreiheit. Damit war der Kampf zwischen Kaiser und Reichsständen zugunsten der Stände entschieden. Von einer Geschichte des Reichs lässt sich von nun an nur noch mit Einschränkungen sprechen; an ihre Stelle tritt die Geschichte der großen Territorien. In diesem Rahmen stiegen dann Österreich und Brandenburg-Preußen im Verlauf der weiteren europäischen Kriege des 17. und frühen 18. Jahrhunderts zu europäischen Großmächten auf.
Der Dreißigjährige Krieg hinterließ ein verwüstetes Land. Allerdings betraf er die verschiedenen Landschaften in unterschiedlicher Härte und Dauer. Die befestigten Städte konnten sich in der Regel vor direkten Kriegseinwirkungen schützen – zu den Ausnahmen gehörte die vielbeklagte Eroberung und Zerstörung Magdeburgs durch die kaiserlichen Truppen 1631 –, während die Menschen auf dem Land den Plünderungen und dem ruinösen System der Selbstversorgung der Heere schutzlos ausgeliefert waren. Geregeltes Wirtschaften war vor allem in den letzten Jahren des Krieges kaum noch möglich.
Die Bevölkerung im Reich ging, so die groben Schätzungen, von etwa 15 bis 17 Millionen vor dem Krieg auf 10 bis 11 Millionen im Jahr 1648 zurück. Dabei waren die unmittelbaren Kriegsverluste – Gefallene in Schlachten, Opfer in der Zivilbevölkerung durch Übergriffe der Truppen – nicht der entscheidende Faktor. Es war vor allem die Pest, die die Bevölkerung dezimierte; allerdings verstärkten die Kriegsbedingungen ihre Auswirkungen entscheidend. Große Städte wie etwa Hamburg oder Straßburg, beide neutral, waren von Flüchtlingen aus dem Umland überfüllt und boten einen idealen Nährboden für Seuchen.
Es dauerte bis ins 18. Jahrhundert hinein, ehe die Bevölkerungsverluste ausgeglichen und der Stand der Vorkriegszeit wieder erreicht wurde. Auch die wirtschaftliche Erholung ging nur langsam vonstatten, behindert nicht nur durch immer wieder neue kriegerische Konflikte, sondern auch durch eine Agrarkrise und eine Depression in Handel und Gewerbe in den Jahrzehnten nach dem Krieg. Um die Einnahmen und damit die eigene Macht zu stärken, griffen die Territorien bzw. ihre Herrscher aktiv in das Wirtschaftsgeschehen ein. Ziel dieser als Merkantilismus bezeichneten Wirtschaftspolitik war die Anhäufung von Reichtum. Dabei kam es darauf an, eine aktive Handelsbilanz zu erzielen, d. h. die Einfuhren zu beschränken und zugleich Handel und exportgeeignete Wirtschaftszweige so zu entwickeln, dass möglichst viel Gold und Geld ins eigene Land flossen. Da aber das zersplitterte Deutsche Reich keine geschlossene Volkswirtschaft bildete, waren nur einige der größeren Territorien in der Lage, eine derartige Wirtschaftspolitik mit dem Ziel der wirtschaftlichen Absicherung der Macht zu verfolgen.
Diese wirtschaftspolitischen Ideen besaßen eine enge Affinität zur politischen Doktrin des Absolutismus, wie sie sich in Frankreich als Reaktion auf die verheerenden religiösen Bürgerkriege im 16. Jahrhundert herausgebildet hatte.2 Der Weg aus der Anarchie, so die Überlegungen der Staatsrechtler zur Zeit Heinrichs III. und Heinrichs IV. von Frankreich, konnte nur über eine Stärkung der zentralen königlichen Gewalt und die Herausbildung eines von der Religion losgelösten staatlich-politischen Handlungsbereichs führen, um so die verschiedenen Religionsparteien der staatlichen Autorität zu unterwerfen. Ihre klassische Formulierung fanden diese Vorstellungen in den Six livres de la république (1577) von Jean Bodin mit der Lehre von der Souveränität des Staates bzw. des Monarchen, die er als »eine höchste, von Gesetzen ledige Gewalt über Bürger und Untertanen« definierte.3 Grenzen werden allein vom göttlichen Recht und vom Naturrecht, vor allem dem auf Eigentum, gesetzt. Im übrigen gilt: »Wer sich gegen den König wendet, versündigt sich an Gott, dessen Abbild auf Erden der Fürst ist.«4
Eine Annäherung an dieses Programm stellte am ehesten die Entwicklung zur absoluten Monarchie in Frankreich dar. Hier gelang es im Verlauf des 17. Jahrhunderts, den Adel zunehmend zu entmachten und vom König abhängig zu machen. Durch Ludwig XIV. und seinen Herrschaftsstil, der glanzvolle Repräsentation der Macht mit Selbsterhöhung und Verklärung der eigenen Person verband, erhielt das französische Königtum schließlich die Form, die für das monarchische Europa vorbildlich werden sollte. Die Schlossanlage von Versailles, erbaut 1661–89, wurde zum Symbol für diesen Herrschaftsstil.
Die geschichtliche Wirklichkeit blieb weit hinter den Forderungen der Theoretiker der Souveränität und des fürstlichen Absolutismus zurück. Abgesehen davon, dass sich die absolute Monarchie nicht in allen europäischen Staaten durchsetzen konnte, sorgten jeweils besondere geschichtliche und gesellschaftliche Bedingungen für höchst unterschiedliche Erscheinungsformen absolutistischer Herrschaft. Das gilt nicht zuletzt für das Deutsche Reich; hier konnte nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs Absolutismus nur noch Territorialabsolutismus bedeuten. Doch ungeachtet der jeweiligen verfassungsmäßigen Konstruktion gab es Gemeinsamkeiten in der Entwicklung des frühmodernen Staates: Das grundsätzlich Neue im Unterschied zum Mittelalter bestand darin, dass der Staat immer mehr Aufgaben und Kompetenzen an sich zog und so, indem er als Konkurrent älterer Gewalten auftrat, die auf dem Lehnswesen beruhenden alten Organisationsformen der Herrschaft unterminierte.
Im Deutschen Reich waren es die Territorialfürsten, die angesichts der Schwäche der zentralen Reichsgewalt neue Befugnisse an sich zogen, in ihren Territorien eigene Verwaltungsstrukturen schufen und nach Möglichkeit die Rechte der Landstände einzuschränken suchten, d. h. Landtage wurden nicht mehr einberufen, eigenmächtig Steuern erhoben und alte Privilegien aufgehoben. Dieses Vorgehen richtete sich nicht nur gegen den Adel, sondern auch gegen die Städte, die die Landesherrn mehr oder weniger gewaltsam zu unterwerfen suchten.
Doch von einer völligen organisatorischen Durchdringung des Territoriums durch die planende und ordnende Kraft der neuen Staatlichkeit konnte keine Rede sein. Die Theorie des Absolutismus bzw. der fürstlichen Souveränität und seine Durchsetzung in der politischen Realität waren zwei verschiedene Dinge. Zum einen stießen die Tendenzen zur größeren Konzentration der Regierungs- und Verwaltungsaufgaben bei den betroffenen Ständen natürlich auf – zuweilen durchaus erfolgreichen – Widerstand. Zum anderen ließ sich bei der unübersichtlichen Struktur der größeren Territorien mit ihren zahlreichen halbautonomen geistlichen und weltlichen Gebilden mit Sonderrechten (Städte, kirchliche und adelige Herrschaften, Universitäten usw.) ein striktes zentralistisches oder absolutistisches Regiment letztlich nicht konsequent durchsetzen.
Gleichwohl führte die ständige Zunahme der öffentlichen Aufgaben und des mit ihrer Umsetzung beauftragten Beamtenapparats zu einer wachsenden Einflussnahme der staatlichen wie der städtischen Organe auf die verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche. Recht und Erziehungswesen, öffentliche Wohlfahrt und Sicherheit, Wirtschaft und Kirchenwesen wurden in einer Fülle von Verordnungen reguliert. Kaum ein Aspekt des menschlichen Lebens blieb von dieser obrigkeitlichen Planung und Fürsorge ausgenommen, der die Kirchen dann noch die höheren Weihen verliehen. Der Erziehungs- und Regulierungsanspruch des staatlichen, städtischen oder kirchlichen Regiments, die Tendenz zur »Sozialdisziplinierung«5 der Untertanen kannte, jedenfalls in der Theorie, keine Grenzen.
Doch das Bild einer wohlgeordneten ständischen Gesellschaft, wie es die Verordnungsdichte suggeriert, trügt. Neben den zerstörerischen Einflüssen von außen in diesem Jahrhundert der Kriege bedrohten zahlreiche innere Konflikte die scheinbare bzw. erzwungene gesellschaftliche Harmonie (Kap. V). Wiederholt kam es auf dem Land zu Bauernaufständen, in den Städten erschütterten konfessionelle Auseinandersetzungen, soziale Unruhen als Folge wirtschaftlicher Krisenerscheinungen und Verfassungsstreitigkeiten den Frieden. Das Eskalationspotential derartiger innerstädtischer Konflikte zeigen die Auseinandersetzungen der Jahre 1612–14 in Frankfurt a. M., die in ein Judenpogrom mündeten. Während aber die Gewalt gegen Juden insgesamt nachließ, intensivierte sich die Verfolgung von sogenannten Hexen seit dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts und nahm in der Zeit von 1580 bis 1630 epidemischen Charakter an.
Deutsche Literatur im europäischen Kontext und die Literaturreform
Politisch und literarisch war Deutschland in der Frühen Neuzeit eine ›verspätete Nation‹, politisch im Hinblick auf den Prozess, der in anderen Ländern zur Herausbildung moderner Nationalstaaten führte, literarisch im Vergleich zu den volkssprachlichen Renaissanceliteraturen Süd- und Westeuropas. Anfang des 17. Jahrhunderts wurde die kulturelle und literarische Diskrepanz zum Problem: Der Dichtung der italienischen Renaissance, der französischen Pléiade, des spanischen und niederländischen ›Goldenen Zeitalters‹ oder der Elisabethanischen Ära hatte man in der eigenen Sprache nichts entgegenzusetzen. Die Erkenntnis der Defizite der deutschen Sprache und Dichtung löste schließlich, nicht ohne patriotische Emphase, zuerst vereinzelte, dann systematische Reformbestrebungen aus, die auch von den deutschen Sprachgesellschaften mit ihren Programmen der Tugend- und Sprachpflege aufgenommen und vorangetrieben wurden.
Man war sich in den engagierten späthumanistischen Zirkeln im Klaren, dass der Anschluss an das internationale Niveau nur gewonnen werden konnte, wenn man dem Beispiel der Italiener, Franzosen oder Niederländer folgte und wie diese die Dichtung in der eigenen Sprache auf humanistischer Basis reformierte. Es ging um die Aneignung des Formen-, Bilder- und Stilrepertoires der Dichtung der Antike und vor allem der Renaissance, um sprachliche und grundlegende metrische Reformen.
Voraussetzung der so verstandenen Nachahmung war neben der Beherrschung der rhetorischen und poetologischen Grundlagen Literaturkenntnis. Diese wurde, soweit es die klassischen antiken Schulautoren betraf, durch die Lateinschule und die Artistenfakultät der Universitäten vermittelt, einschließlich der Fähigkeit, auf dieser Materialbasis eigene lateinische Texte zu formulieren. Für ein Publikum ohne ausreichenden Bildungshintergrund lagen zahlreiche Übersetzungen vor, die allerdings bis zur Literaturreform – von Versuchen im Frühhumanismus des 15. Jahrhunderts abgesehen – in einer gleichsam ›vorhumanistischen‹ Sprache gehalten waren: Versionen der Epen Homers und Vergils in Knittelversen ließen sich kaum für eine sprachliche und verstechnische Weiterentwicklung in Anspruch nehmen.
Wünschenswert waren nun Übersetzungen, die über die Stoffvermittlung hinaus sich auch um die Wiedergabe des Formen- und Themenspektrums der Dichtung der Antike und der Renaissance bemühten. Die frühen Übertragungen und Nachdichtungen von Martin Opitz, Georg Rodolf Weckherlin, Diederich von dem Werder und anderen brachten – zusammen mit ihren eigenen Versuchen – die ersten Nachweise, dass in deutscher Sprache dichterische Leistungen auf der Höhe der europäischen Renaissancedichtung grundsätzlich möglich waren. Später, in der zweiten Jahrhunderthälfte, traten dann Beispiele manieristischer lyrischer Dichtung aus Italien und Spanien als Vorbilder hinzu. Insgesamt wurden so neben den literarischen Gattungen und Formen der Renaissance- und Barockdichtung auch ihre wichtigsten Themenbereiche in die deutsche Literatur eingeführt.
Obwohl Opitz weder der einzige noch der erste deutsche humanistische Literat war, der den Anschluss an die europäische Renaissanceliteratur suchte, verbindet die Literaturgeschichtsschreibung nicht zu Unrecht die Reform der deutschen Dichtung im 17. Jahrhundert mit seinem Namen. Zwar wäre Weckherlin von der dichterischen Leistung her gesehen am ehesten in der Lage gewesen, Opitz den Rang streitig zu machen, doch verlor er durch die Übersiedlung nach England 1619 seine Einflussmöglichkeiten. Opitz hingegen sorgte mit großem Organisations- und Kommunikationstalent und zahlreichen Publikationen zielstrebig für die Verbreitung seiner Vorstellungen unter den akademischen Eliten der protestantischen Territorien, die sie wiederum für ihr eigenes Werk fruchtbar machten und in der Lehre weitergaben.
Martin Opitz, Kupferstich von Jacob von Heyden, 1631. Nach einer Zeichnung Heydens, die im Herbst 1630 bei einem Aufenthalt von Opitz in Straßburg entstand. Inschrift: »Bild des Martin Opitz, des berühmten Mannes [v. c.: viri clarissimi], nach dem Leben wiedergegeben.«
Opitz’ Buch von der Deutschen Poeterey (1624) war die erste Poetik in deutscher Sprache. Außer den auf die deutsche Sprache und Verskunst bezogenen Partien enthielt das kleine Buch nichts, was nicht schon in den vorausgehenden Poetiken der Renaissance zu finden gewesen wäre. Entscheidend für die deutsche Entwicklung wurde der Abschnitt, der »Von den reimen / jhren wörtern vnd arten der getichte« handelt und die wesentlichen dichtungstechnischen Aspekte der Reform erläutert.6
Darin verpflichtete Opitz die deutsche Poesie auf alternierende Verse (Jamben und Trochäen) und formulierte im Unterschied zum quantitierenden Verfahren der antiken Metrik nach niederländischem Vorbild ein Betonungsgesetz. Es setzte sich gegen das freiere, silbenzählende französische Versifikationsprinzip durch, mit dem seit dem 16. Jahrhundert bis hin zu Weckherlin experimentiert worden war. Die Opitzschen Regeln hatten den wohl entscheidenden Vorteil der Simplizität, die der Ausbildung und Einübung einer neuen deutschen Verssprache durchaus förderlich war. Die Beschränkung auf alternierende Verse hatte allerdings nicht lange Bestand; experimentierfreudige Poetiker und Dichter durchbrachen seit den vierziger Jahren die engen metrischen Vorschriften, führten daktylische und anapästische Verse ein und versuchten sich in frei erfundenen Mischformen und Nachahmungen antiker Odenstrophen. Grundsätzlich jedoch blieb das von Opitz begründete metrische System bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts unbestritten.
Dafür traten seit der Mitte des 17. Jahrhunderts – die metrische Diskussion war im Wesentlichen abgeschlossen – andere Aspekte in den Vordergrund der poetologischen Überlegungen, die bisher nicht oder nur am Rande behandelt worden waren und die manieristischen Strömungen der zweiten Jahrhunderthälfte begleiteten. Es ging nicht zuletzt um die Bildlichkeit und um die Klangmöglichkeiten der Sprache, um ihre ästhetischen Qualitäten, aber auch um die den Lauten und Klängen innewohnende tiefere Bedeutung (Kap. VIII).
Maßstäbe setzten die Alten und die Dichter der europäischen Renaissance, nicht die deutsche Dichtung der unmittelbaren Vergangenheit mit ihren Meistergesangsgesetzen und holprigen Knittelversen, die mit Nichtachtung oder – wenn sie überhaupt ins Blickfeld kam – mit Verachtung gestraft wurde. Dass außerhalb der humanistischen Bildungsschicht ältere Dichtungstraditionen weiterlebten, blieb für sie ohne Bedeutung. Die neue Dichtung, verstanden als humanistisch fundierte Unternehmung, war wie die neulateinische Literatur der deutschen Humanisten weiterhin Reservat einer elitären Schicht, wenn auch jetzt in der Volkssprache. Das Deutsche trat an die Stelle des Lateinischen, doch das gelehrte Arsenal der Dichtersprache und die poetologischen Voraussetzungen blieben die gleichen. Damit gehört die neulateinische Literaturtradition ebenso wie die volkssprachlichen Literaturen der Renaissance zu den Voraussetzungen der neuen deutschsprachigen Kunstdichtung des 17. Jahrhunderts.7
Trotz der von Literaturreformern verbreiteten kulturpatriotischen Aufbruchstimmung, die der Dichtung in deutscher Sprache eine besondere Dynamik verlieh, nahm die neulateinische Literatur auch im 17. Jahrhundert noch einen breiten Raum ein. Für den katholischen Bereich gilt das ohnehin, da man sich hier dem Reformprogramm aus politischen und konfessionellen Gründen in der Regel nicht anschloss. Man hielt vielmehr am Vorrang des Lateinischen für den Diskurs unter den Gebildeten fest; zugleich führte man im Einklang mit der missionarischen Zielsetzung die Tradition einer nichtelitären Literatur für alle in der Volkssprache fort. Die lateinische Produktion der katholischen Seite umfasste neben der im engeren Sinn gelehrten Literatur einflussreiche Poetiken und Rhetoriken, das umfangreiche dramatische Schaffen der Jesuiten und Benediktiner, erzählende Prosa und eine bedeutende, im Werk Jacob Baldes, des ›deutschen Horaz‹, gipfelnde lyrische Dichtung.
Die Wirkung der katholischen neulateinischen Literatur ging über die konfessionellen Grenzen hinaus. Das gilt u. a. für die Poetiken und Rhetoriken, für das Jesuitendrama und nicht zuletzt für die Lyrik und die Satiren Jacob Baldes, die protestantische Dichter wie Andreas Gryphius oder Sigmund von Birken zu deutschen Bearbeitungen anregten. Aber trotz der grundsätzlichen Entscheidung für eine neue Kunstdichtung in deutscher Sprache brachen auch die protestantischen Gelehrtendichter keineswegs mit der neulateinischen Tradition. Sie schrieben und dichteten auch weiterhin in lateinischer Sprache; viele von ihnen hinterließen neben ihren deutschen Dichtungen ein zum Teil umfangreiches lateinisches Werk. Allerdings verlor das Lateinische im Verlauf des 17. Jahrhunderts insgesamt allmählich an Bedeutung.
Nachahmung und Originalität
Seit der Aristotelesrezeption in der Renaissance gehört der Begriff der Mimesis bzw. latinisiert imitatio zu den zentralen Kategorien der frühneuzeitlichen Poetik. Dabei geht allerdings die Vorstellung von der Nachahmung der Natur über die Darstellung des Empirisch-Faktischen hinaus. Denn Aufgabe des Dichters sei nicht, heißt es bei Aristoteles, »zu berichten, was geschehen ist, sondern vielmehr, was geschehen könnte und was möglich wäre nach Angemessenheit oder Notwendigkeit«.8 Dichtung gewinnt so durch die Darstellung des Allgemeinen und Exemplarischen Erkenntnischarakter. Zusammen mit den Ergänzungen in der Ars poetica des Horaz liegen diese Vorstellungen auch der normativen Barockpoetik zugrunde, allerdings in einer eher noch restriktiveren oder auch trivialen Form. Der Blick auf die nachzuahmenden Gegenstände und Handlungen wird durch religiöse, gesellschaftliche und poetologische Normen verstellt, und dem Dichter stehen nur Ausschnitte aus der geschichtlichen Wirklichkeit zur Verfügung. Dichtung zielt nicht auf die Schilderung der ›Wirklichkeit‹, sondern auf die »Darstellung einer ständisch geordneten, heilsgeschichtlich determinierten und ethisch idealisierten Welt«.9 Idealisierung und Naturnachahmung sind kein Widerspruch. In diesem Sinn gilt der Aristoteles nachempfundene Satz, dass »die gantze Poeterey im nachäffen der Natur bestehe / vnd die dinge nicht so sehr beschreibe wie sie sein / als wie sie etwan sein köndten oder solten«.10
In der dichterischen Praxis des 17. Jahrhunderts hat der Begriff der Nachahmung noch eine andere, folgenreiche Dimension: imitatio nicht als Nachahmung der ›Natur‹, sondern von literarischen Vorbildern und Mustern. In dieser Bedeutung ist Nachahmung ein Grundbegriff der humanistischen Renaissance- und Barockpoetik. Das Denkmuster geht auf die Antike zurück, die römische Nachahmung der griechischen Muster. Nun, in der Renaissance, erhält die gesamte Antike eine entsprechende Vorbildfunktion: »Lies also vor allen Dingen, und lies immer wieder (o zukünftiger Dichter) die griechischen und lateinischen Vorbilder, und blättere mit Nacht- und Tageshand in ihren Büchern«, heißt es in der Programmschrift der französischen Pléiade, Joachim Du Bellays Deffence et Illustration de la Langue Françoyse (1549) im Anschluss an Horaz.11
Die Übertragung des Prinzips der imitatio auf die volkssprachlichen Literaturen war die Bedingung für ihre Erneuerung im Geist der Renaissance und zugleich die Legitimation, mit den antiken Literaturen zu wetteifern. Den entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Ebenbürtigkeit der volkssprachlichen Dichtung vollzog der Italiener Pietro Bembo mit seinem nationalhumanistischen Programm: Er erhob Petrarca zum klassischen Muster der italienischen Versdichtung (für die Prosa war es Boccaccio) und übertrug das Prinzip der imitatio auf die Volkssprache. Damit erhielt das Italienische den Rang einer klassischen Literatursprache, ein Vorgang, der für die anderen europäischen Sprachen große Bedeutung erhalten sollte.
Das italienische Vorbild wirkte vor allem durch das Werk Petrarcas, des ersten neuzeitlichen ›Klassikers‹, dessen volkssprachliche Lyrik seines Rerum vulgarium fragmenta genannten Canzoniere (entstanden zwischen 1336 und 1374) die europäische Liebesdichtung auf Jahrhunderte hinaus prägte. Der Grundton der Liebeslyrik des Canzoniere ist der der Klage, der Resignation und der Melancholie, Folge der Hoffnungslosigkeit der Liebe und einer zutiefst gespaltenen Haltung des Liebenden zwischen sinnlichem Begehren und distanzierter Verehrung, Verfallenheit und Sehnsucht nach Befreiung, Leidenschaft und Sündenbewusstsein. Der Liebesklage steht der Preis der ohne Hoffnung geliebten Frau und ihrer unvergleichlichen Schönheiten und Tugenden gegenüber. Im Verlauf der Rezeptionsgeschichte (Petrarkismus) ging das Individuelle von Petrarcas Darstellung der ›bittersüßen‹ Liebe mit ihren psychologischen Schattierungen verloren. Erhalten blieben, zu Stereotypen erstarrt, die erotische Grundkonstellation, die zentralen Themen und Motive und v. a. die virtuosen sprachlich-rhetorischen Mittel.12
Auch durch die Wahl der Gattungsformen wirkte Petrarca traditionsbildend. Die überwiegende Mehrzahl der 366 Gedichte des Canzoniere sind Sonette (317) und Kanzonen (29); die anderen Formen – Ballade, Sestine, Madrigal – spielen nur eine untergeordnete Rolle. Das Sonett erhielt durch Petrarca seine klassische Form und blieb die vorherrschende Gedichtform der europäischen Renaissancelyrik. Dabei besteht ein Zusammenhang zwischen der Sonettform und den Antinomien der Liebesthematik: Die Konstellation der Figuren – der schwankende, hin und her gerissene Dichter-Liebhaber und die unnahbare Geliebte – wie die Unauflöslichkeit des Konflikts fordern eine antithetische Gestaltung geradezu heraus, für die die dialektische Form des Sonetts besonders geeignet erscheint.
Wie sich die Bildersprache Petrarcas mit ihren Antithesen von Feuer und Eis, Hitze und Kälte, Krieg und Frieden, Leben und Tod im Petrarkismus verfestigte, so erhielt das Bild der Frau fest umrissene Züge: Ihre einzelnen ›Schönheiten‹ – Goldhaar, Korallenlippen, die Hand von Elfenbein usw. – werden katalogisiert und in ihrer Kostbarkeit und Unvergleichbarkeit durch eine entsprechende Preziosenmetaphorik und mythologische Anspielungen hervorgehoben und zusammen oder einzeln zum Gegenstand von Gedichten. Darüber hinaus gehören zum petrarkistischen Repertoire die dichterische Vergegenwärtigung von Orten und Objekten bis hin zur Haarnadel, die mit der geliebten Frau verbunden sind.
Im Unterschied zu Italien konnte man in den anderen europäischen Ländern nicht auf bereits klassisch gewordene Vorbilder in der eigenen Sprache zurückgreifen, jedenfalls nicht in einer ›modernen‹ Sprachform. In dieser Situation bot sich das petrarkistische Repertoire mit seinen Formen und Formeln an, die sich in die eigene, noch auszubildende Literatursprache übertragen ließen.13 Zudem besaß die petrarkistische Liebessprache jenes Konventionelle und Nachahmbare, das sie zum idealen Medium gesellschaftlicher Unterhaltung und gesellschaftlichen Spiels geeignet machte, eines Spiels, das von Anfang an auch spielerisch-parodistische oder satirische Varianten einschloss (Antipetrarkismus).
Es ist kein Zufall, dass sich unter Opitz’ Gedichten zahlreiche Übertragungen und Nachdichtungen befinden. Zweck ist nach dem Bruch mit der Vergangenheit die Einübung einer neuen Literatursprache. Denn mit den Sonetten nach Petrarca oder Ronsard bzw. mit Liedern und Alexandrinergedichten nach dem Vorbild der Niederländer werden nicht nur ›neue‹ Inhalte vorgestellt, sondern auch die sprachlichen, verstechnischen und poetischen Mittel ihrer Bewältigung im Deutschen, die es sich durch das Studium vorbildlicher Werke und ihre Nachahmung allmählich anzueignen gilt, um so das Ziel einer neuen »Poesie in vnserer Muttersprach«14 zu erreichen. Dieses Verfahren basiert auf dem Gedanken, dass die imitatio von vorbildlichen Werken der Vergangenheit und Gegenwart zum Wettstreit mit den Vorbildern (aemulatio) und letztlich über die bloße Nachahmung hinaus zu etwas Neuem, Eigenem führt, »das zwar das Alte nicht verleugnet, aber doch den Wert einer künstlerischen Neuschöpfung hat«.15 Moderne Plagiats- oder Originalitätsvorstellungen haben hier keinen Platz.
Literatur und Gesellschaft
Die gesellschaftliche Bindung der Dichtung des 17. Jahrhunderts zeigt sich am auffälligsten in der alltäglichen Praxis der Gelegenheitsdichtung, der Casualcarmina: »Es wird kein buch / keine hochzeit / kein begräbnüß ohn vns gemacht; vnd gleichsam als niemand köndte alleine sterben / gehen vnsere gedichte zuegleich mit jhnen vnter«, schreibt Opitz über die Zwänge der Auftrags- und Gesellschaftsdichtung.16 Die vielfach von Poetikern und Satirikern geäußerte Kritik an dieser auf gesellschaftlichen Konventionen gegründeten Massenproduktion, häufig auch auf Bestellung und gegen Bezahlung, stellt allerdings nicht die Gelegenheitsdichtung selbst in Frage. Anspruchslose Vielschreiberei, nicht das Konzept einer im gesellschaftlichen Leben verankerten Dichtung schaden dem Ansehen der Poeten und ihren beruflichen Ambitionen, denn Dichtung im Barock ist weitgehend ›Gelegenheitsdichtung‹. Der später konstruierte Gegensatz von ›Gelegenheitsdichtung‹ und ›Erlebnisdichtung‹ ist dem 17. Jahrhundert fremd.
Aufträge und/oder Anlässe als Voraussetzung der Produktion, in der bildenden Kunst oder der Musik seit je selbstverständlich, sind nicht nur charakteristisch für die spezifischen Gelegenheitsgedichte zu Namenstagen, Hochzeiten, Begräbnissen und zahlreichen anderen familiären, gesellschaftlichen oder politischen Anlässen, sondern stehen ebenso hinter anderen Literaturgattungen. Das gilt z. B. für anlass- und zweckgebundene religiöse Dichtung, für das pädagogisch motivierte Schul- und Jesuitendrama, für höfische Festdichtung oder für lehrhafte Dichtungen aller Art, aber auch für von Verlegern in Auftrag gegebene unterhaltende, populärwissenschaftliche oder erbauliche Literatur. Hier wird zudem deutlich, dass die Spekulation auf den Markt, dass Publikumsinteressen oder -bedürfnisse eine wichtige Motivation der Produktion darstellten.
Eine institutionelle Bekräftigung des gesellschaftlichen Grundcharakters der Literatur stellt die Gründung von Sprachgesellschaften und Akademien dar. Dabei folgten die deutschen Gesellschaften dem Beispiel der italienischen Akademien, die seit dem 15. Jahrhundert in den Städten entstanden waren und dem geselligen literarischen Verkehr und der Pflege der Sprache dienten. Bedeutendstes Resultat dieser Arbeit an der Sprache ist das Wörterbuch der 1582 in Florenz gegründeten Accademia della Crusca (Vocabulario degli Accademii della Crusca, 1612). Diese Akademie wurde zum unmittelbaren Vorbild für die Fruchtbringende Gesellschaft, die erste und bedeutendste deutsche Vereinigung dieser Art. Fürst Ludwig zu Anhalt-Köthen, der ihr bis zu seinem Tod 1650 vorstand, war 1600 auf seiner Kavalierstour in die Accademia della Crusca aufgenommen worden. Einer späteren Darstellung zufolge beschlossen Angehörige der Fürstenhäuser Sachsen-Weimar und Anhalt-Köthen die Gründung der Fruchtbringenden Gesellschaft 1617 nach einem fürstlichen Begräbnis in Weimar.
Sieht man von den adeligen Frauengesellschaften im Umkreis der Fruchtbringenden Gesellschaft ab, so war die 1633 gegründete Aufrichtige Tannengesellschaft um Jesaias Rompler von Löwenhalt in Straßburg die zweite deutsche Sprachgesellschaft. Sie stellte in gewisser Weise einen Gegenentwurf zur höfisch-adeligen Fruchtbringenden Gesellschaft dar und knüpfte an stadtbürgerliche Traditionen an. Weitere Gründungen folgten, u. a. die Deutschgesinnte Genossenschaft Philipp von Zesens (um 1643) und der Nürnberger Pegnesische Blumenorden, der 1644 von Georg Philipp Harsdörffer und Johann Klaj ins Leben gerufen und dann von Sigmund von Birken und anderen bis ins 18. Jahrhundert hinein weitergeführt wurde. Beide Gesellschaften nahmen auch Frauen auf. Daneben entstanden – und vergingen – kleinere, oft lokal begrenzte und lockere Vereinigungen wie der Elbschwanorden Johann Rists oder die Isther-Nymphen um Catharina Regina von Greiffenberg.
Als Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen die Fruchtbringende Gesellschaft, zunächst eine weitgehend höfisch-adelige Veranstaltung, seit etwa 1640 zunehmend für Gelehrte und Literaten bürgerlicher Herkunft öffnete, stärkte er indirekt deren gesellschaftliche Position. Sie waren es auch, die im Unterschied zu den überwiegend unproduktiven adeligen Mitgliedern (Ausnahmen u. a. Fürst Ludwig selbst, Diederich von dem Werder, Friedrich von Logau) mit ihren literarischen und wissenschaftlichen Leistungen dem kulturellen Anspruch der Gesellschaft gerecht wurden. Unter Ludwigs Nachfolgern allerdings nahm die Fruchtbringende Gesellschaft immer mehr bzw. wieder das Gepräge einer Rittergesellschaft an.
Die größeren Gesellschaften besaßen überregionalen Charakter. Daher kommunizierten die Mitglieder in der Regel brieflich miteinander, wie umfangreiche Korrespondenzen bezeugen. Bei einer gewissen Konzentration von Mitgliedern an einem Ort – Beispiel Nürnberg – spielten engere persönliche Kontakte allerdings durchaus eine Rolle. Die Formalitäten bei der Aufnahme neuer Mitglieder vollzog das Oberhaupt der Gesellschaft, häufig eingeleitet durch Empfehlungsschreiben anderer Gesellschafter. In Zesens Gesellschaft konnte jedes Mitglied neue Gesellschafter werben.
Die Rituale folgten dem italienischen Beispiel. Jedes Mitglied bekam einen Gesellschaftsnamen, einen Wahlspruch und ein dazu passendes Bild. Dieses »Gemähl mit dem Namen und Worte« war, so heißt es in der Satzung der Fruchtbringenden Gesellschaft in der Fassung Georg Neumarks, »an einem sittig-grünen Seidenen Bande zu tragen; Damit Sie sich unter einander bey begebenen Zusammenkunften desto leichter erkennen / und dadurch dero hochrühmliches Vorhaben kundig gemacht werden möchte«.17 Das war bei den Pegnitzschäfern und den Deutschgesinnten nicht anders, wenn auch die Farben für das »Ordens-Band«, an dem der »Brustpfennig« zu tragen war, variierten.
Es ist umstritten, welche Bedeutung der Namensgebung in der vom Hochadel gegründeten Fruchtbringenden Gesellschaft zuzumessen ist, inwieweit sie als (auf das Kulturleben beschränkte) Aufhebung der Standesunterschiede gedeutet werden kann und damit die humanistische Konzeption der nobilitas litteraria wenigstens ansatzweise reflektiert. Jedenfalls benutzten das Oberhaupt (»der Nährende«) und die Mitglieder im brieflichen Verkehr mehr oder weniger konsequent die Gesellschaftsnamen (»der Mehlreiche«, »der Wohlriechende«, »der Schmackhafte«, »der Spielende« usw.).
Große Gemeinschaftsarbeiten der Sprachgesellschaften, wie sie die Accademia della Crusca mit ihrem großen Wörterbuch hervorgebracht hatte, kamen nicht zustande. Es blieb bei Einzelleistungen der produktiven Mitglieder, die ihre Veröffentlichungen häufig mit ihren Gesellschaftsnamen oder Hinweisen auf ihre Mitgliedschaft versahen (»durch einen Mitgenossen der PegnitzSchäfer«). Zu den Verdiensten der Sprachgesellschaften gehört die ausdrückliche Förderung der Übersetzungsliteratur.
Die literarische oder philologische Produktion ihrer Mitglieder stellte jedoch nur einen Aspekt der Bedeutung der Sprachgesellschaften dar. Ebenso wichtig war ihre gesellschaftliche Funktion. Die Gesellschaften trugen wesentlich zur literarischen Kommunikation über die lokalen Gelehrtenzirkel hinaus bei und schufen wenigstens ansatzweise eine überregionale literarische Öffentlichkeit. Sie förderten das Bewusstsein einer einheitlichen Kulturnation – allerdings in einer ›kleindeutschen‹ protestantischen Version – als Gegenentwurf zur realen politischen Verfassung des Reichs. Man kann in den Gesellschaften die »eigentlichen literarischen Zentren des 17. Jahrhunderts« sehen.18
Barock, Barockbegriff, Rezeption
Für die Herkunft des Wortes ›barock‹ bieten sich zwei Erklärungen an, die beide auf spätere Wertungen vorausweisen. Die erste geht vom mittellateinischen baroco aus, einem mnemotechnischen Symbol zur Bezeichnung eines von humanistischen Kritikern der mittelalterlichen Scholastik als abstrus empfundenen Syllogismus, die zweite von dem portugiesischen Fachausdruck der Juweliere pérola barroca für eine Perle von unregelmäßiger, schiefrunder Form. In dieser Bedeutung ist der Begriff in Frankreich im 16. und 17. Jahrhundert häufig belegt, nahm aber dann allmählich – möglicherweise beeinflusst von dem negativen Sinn des scholastischen Merkworts – die Bedeutung ›seltsam‹, ›ausgefallen‹, ›bizarr‹ an. Barock entwickelte sich so zu einem allgemeinen Geschmacksbegriff; dabei entspricht dem französischen goût baroque der deutsche »Barockgeschmack« (Lessing 1750).19 In diesem meist pejorativen Sinn wurde das Adjektiv ›barock‹ im 18. und 19. Jahrhundert parallel zu ›bizarr‹, ›grotesk‹ oder ›schwülstig‹ auf eine Vielfalt von Gegenständen, auch literarischen, angewendet. Noch der Fremdwörterduden von 1966 nennt als Bedeutungen neben dem eher seltsamen ›verschnörkelt‹ auch ›überladen‹ und ›schwülstig‹ – populäre Vorstellungen, die einem adäquaten Zugang zur ›Barockliteratur‹ im Weg standen oder stehen.
Erst seit etwa 1860 erscheint Barock als Epochen- und Stilbegriff in der Kunstgeschichte, mit negativer Wertung bei Jacob Burckhardt (Der Cicerone, 1855), mit positiver Tendenz u. a. bei Cornelius Gurlitt (Geschichte des Barockstiles in Italien, 1887) und Heinrich Wölfflin (Renaissance und Barock, 1888). Eine der frühesten Anwendungen des Barockbegriffs auf die Literatur findet sich in Friedrich Nietzsches Aufsatz Vom Barockstile (1879), doch erst unter dem Einfluss von Wölfflins Kunstgeschichtlichen Grundbegriffen (1915) wurde er von der deutschen Literaturwissenschaft übernommen. Hier löste ›Barock‹ den bisher verwendeten Begriff ›Renaissance‹ ab und bezeichnete einerseits einen durch bestimmte Merkmale charakterisierten Stil (ausgeprägte Rhetorisierung der Sprache, gesteigerte Bildlichkeit, Artistik der Form), andererseits die Epoche zwischen Reformationszeit bzw. Renaissance und Aufklärung, in der dieser Stil dominant zu sein schien.
Während Barock als Stilbegriff heute kaum noch eine Rolle spielt, hat sich ›Barock‹ in der deutschen Literaturgeschichte als eher formaler Verständigungs- oder Ordnungsbegriff für die Periode von den literarischen Reformbestrebungen um 1600 bis zum endgültigen Durchbruch aufklärerischen Denkens in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts neben der neutralen Bezeichnung ›17. Jahrhundert‹ weitgehend etabliert. Es fehlt allerdings nicht an kritischen Einwänden, zumal ›barock‹ im allgemeinen Sprachgebrauch immer noch negative Assoziationen auslöst (›Schwulst‹). Doch keine der vorgeschlagenen Alternativen – u. a. Manierismus, Konfessionalismus oder wieder Renaissance – konnten den Barockbegriff verdrängen, ebenso wenig wie der umfassendere Periodisierungsvorschlag ›Mittlere deutsche Literatur‹.
Dass sich der Barockbegriff behaupten konnte, war allerdings nur möglich, weil seine frühere ideologische Überfrachtung und die selektive Wahrnehmung und Verabsolutierung einzelner Phänomene in der geisteswissenschaftlich orientierten Forschung sich inzwischen erledigt hatten. Neuere, an derartigen Spekulationen desinteressierte Forschungsrichtungen brachten zudem auch keine Lösung des Definitionsproblems. Vielmehr wurde in dem Maße, in dem etwa sozial- und traditionsgeschichtlich orientierte Arbeiten die Bedeutung der humanistischen Gelehrtenkultur und das im 17. Jahrhundert wirksame Traditionsgeflecht deutlich machten – Rhetorik, Poetik, neulateinische Dichtung, Stoizismus, Patristik, Emblematik, Petrarkismus usw. –, eine Antwort auf die Frage, worin die Einheit der Epoche bestehe und wo ihre Grenzen zu ziehen seien, eher noch schwieriger.
Die kritische Auseinandersetzung mit der Literatur des 17. Jahrhunderts begann in der frühen Aufklärung, vorbereitet durch die Rezeption des französischen Klassizismus und seines Stilideals im letzten Viertel des Jahrhunderts.20 Gegenstand des Anstoßes war die verstärkte Rezeption manieristischer Tendenzen der Literaturen Italiens und Spaniens und die damit verbundene Abkehr vom opitzianischen Klassizismus durch Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, Daniel Casper von Lohenstein und andere Schlesier. Begriffe wie Natur, Vernunft, Urteilskraft, Geschmack standen nun gegen Unnatur, Schwulst und fehlende Urteilskraft. Das hier angedeutete Wertungsmuster erwies sich als zählebig.
Es liegt auch dem Bild der literarischen Entwicklung zugrunde, das Johann Jakob Bodmer in seinem Lehrgedicht