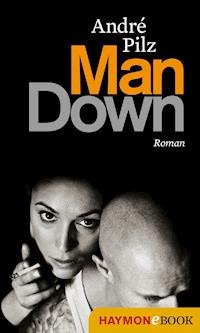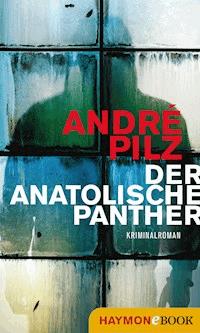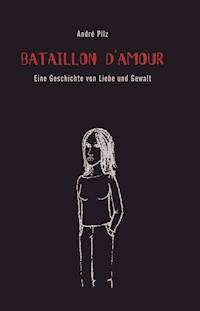
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirnkost KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Denk' an deine Tochter, und hast du keine, denk' an deine Schwester, und hast du keine, denk' an deine Freundin, deine Frau, deine Mutter, denk' an einen Menschen, den du über alles liebst. Und jetzt stell' dir vor, dieser Mensch wäre eingesperrt in einem Zimmer, Tag für Tag, Nacht für Nacht. An den Fenstern wären Gitter, in dem Zimmer gäbe es ein Bett, ein Waschbecken, einen Spiegel, einen Wecker und einen Stuhl. Sonst nichts. Denk', dass der Mensch weder weiß, wann, noch, ob er überhaupt jemals wieder herauskommen würde. Und dass er jeden Befehl befolgen müsste. Jeden. Ansonsten gäbe es Schläge, Essensentzug. Und am späten Nachmittag, da kämen die Männer. Einer nach dem anderen. Das schockierende Porträt einer jungen Kolumbianerin, die in Deutschland zur Prostitution gezwungen wird, wird nicht weniger Kontroversen auslösen als das Erstlingswerk des Autors André Pilz (34), "No llores, mi querida - Weine nicht, mein Schatz" (Archiv der Jugendkulturen 2005). Auch dieses Mal geht André Pilz an Grenzen, geht dorthin, wo es weh tut, und schont weder seine Figuren noch seine Leser. Mit seinem unverkennbaren Stil zieht uns "der deutsche Irvine Welsh" auch in "Bataillon d'Amour" in seinen Bann, erzählt abermals eine Geschichte, die brutal, kompromisslos und zugleich zärtlich-poetisch ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
André Pilz
Bataillon d‘Amour
Eine Geschichte von Liebe und Gewalt
André Pilz
BATAILLON D‘AMOUR
Eine Geschichte von Liebe und Gewalt
Originalausgabe
© 2007 Archiv der Jugendkulturen Verlag KG, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Herausgeber:
Archiv der Jugendkulturen e.V.
Fidicinstraße 3
10965 Berlin
Tel.: 030 / 694 29 34
Fax: 030 / 691 30 16
www.jugendkulturen.de
Vertrieb für den Buchhandel: Bugrim (www.bugrim.de)
Auslieferung Schweiz: Kaktus (www.kaktus.net)
Privatkunden und Mailorder: www.jugendkulturen.de
Lektorat: Klaus Farin
Titelzeichnung: Esther Bernhard
Layout: Conny Agel
Druck: werbeproduktion bucher
Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme
Der Titeldatensatz für diese Publikation ist bei
der Deutschen Bibliothek erhältlich
ISBN Print: 978-3-86546-046-2 (Tilsner)
ISBN E-Book: 978-3-943612-03-5
ISSN 1439-4316 (Archiv der Jugendkulturen)
Für Esther
000
„Spring!“
„Geh ins Haus, Miguel!“
„Spring doch!“
„Geh ins Haus, Windeln wechseln.“
„Stimmt es, dass du eine Schlampe bist?“
„Stimmt es, dass du in einer Zigarettenschachtel schläfst, Zwerg?“
„Warum willst du überhaupt springen?“
„Das kapierst du nicht!“
„Warum willst du springen?“
„Schau dir doch die scheiß Gegend an.“
„Was ist damit?“
„Ich komm da nie raus.“
„…“
„…“
„Ich schon! Ich werde Fußballer bei Real Madrid.“
„Keiner von uns kommt da raus.“
„Du wirst ja sehen, puta!“
Ich glotzte hinunter auf den Asphalt. Der alter Wichser auf dem Balkon zwei Stöcke tiefer schaute zu mir herauf und grinste. Er gaffte unter meinen Rock. Ich hätte große Lust gehabt, ihm auf den Kopf zu pissen, aber das hätte den wahrscheinlich nur noch mehr angeturnt.
„Meine Mama sagt, eure Mutter würd’s nicht mehr lange machen, so wie die hustet.“
„Lass mich endlich alleine!“
„Wenn sie stirbt, kriegt ihr dann eine neue?“
Ich lehnte mich vorsichtig ein wenig vor und schloss die Augen.
„SPRING, PUTA! SPRING!“
In der Wohnung nebenan war ein Poltern zu hören.
„MIGUEL!! WAS MACHST DU DA DRAUSSEN?! WAS REDEST DU MIT DER?! DU BIST ZU JUNG, UM DIR DIE TITTEN DIESER SCHLAMPE ANZUSEHEN! KOMM SOFORT HEREIN!“
Miguel zeigte mir den Mittelfinger und verschwand vom Balkon.
Ich schloss die Augen, drehte mich um und sprang vom Fensterbrett auf den Küchentisch.
Sommer
001
Jeder von uns lebt in seiner eigenen, kleinen Welt, einer Welt, in der wir wissen, was wir wissen, wir fühlen, was wir fühlen, wir sehen, was wir sehen, wir glauben, was wir glauben. All dies könnte man in ein Buch verpacken, das Buch des Lebens, jeder hat eines. Aber da ist auch das andere Buch, das all die Geheimnisse unseres Lebens birgt, das Buch, das sich uns niemals öffnen wird, die Parallelwelt, von der wir zwar manche Dinge erahnen, die meisten aber niemals erfahren.
Dein Vater ist nicht dein Vater. Dein Onkel ist dein Vater. Deine beste Freundin fickt deinen Freund. Jetzt gerade. Und in zwei Stunden noch mal. Ein Tumor wächst in deinem Kopf. Er fühlt sich pudelwohl. In einem Jahr wirst du mit Windeln im Bett liegen und deine eigene Mutter nicht wiedererkennen. Würdest du nicht in diesem Augenblick diese Zeilen lesen, würdest du deine große Liebe nicht übersehen, die gerade jetzt… gerade hier… dreh dich um!… zu spät… schon vorbei, schon verloren.
Würden wir verrückt, wenn wir wüssten, was im Buch der Geheimnisse steht? Würde uns die Wucht den Kopf abschlagen?
Hier ist das Buch, das neben Mechibels Buch des Lebens liegt, neben ihrer Geschichte. Hier stehen Dinge, von denen Mechibel nichts weiß, nichts sieht, nichts hört, vielleicht nicht einmal ahnt, Dinge, die ihr Leben, Denken und Fühlen verändern würden, wüsste sie davon. Hier steht die Geschichte nicht einer, sondern vieler Parallelwelten. Die Geschichte, die von Igor erzählt, der auf der Autobahn zwischen München und Lindau mit dem Handy am Ohr auf einer Raststätte stand. Er beobachtete dabei einen ungarischen Lkw-Lenker, der mitten auf dem Rastplatz einen Liegstuhl aufstellte, sich seines verschwitzten Hemdes entledigte und sich genüsslich hineinplumpsen ließ.
Igor versuchte nun schon zum fünften Mal an diesem Tag, Trulli zu erreichen, aber es antwortete abermals nur eine Computerstimme, die ihm auf Spanisch irgendwas erklärte, was er nicht wissen wollte. Igor verstand zwar ein paar Brocken Spanisch, wie jeder Deutsche, der im Sommer Urlaub auf Ibiza oder Mallorca machte, aber was die Stimme da laberte, verstand er nicht. Er stieg in sein Cabriolet, einen Audi A4, den er sich zwei Wochen zuvor in Düsseldorf gekauft hatte, warf das Handy auf den Beifahrersitz und überlegte. Vielleicht hatten sie Trulli in Bogotá geschnappt. Trulli war ein gottverdammter Psycho, der längst hinter Gittern wäre, hätten ihm seine Millionen nicht immer wieder den Arsch gerettet. Wenigstens schickte er regelmäßig ordentliches Frischfleisch. Ein Mädchen von Trulli brachte mehr Geld als zehn von Gregorijs magersüchtigen, blassgesichtigen Ostschlampen.
Igor umkurvte den ungarischen Lkw-Fahrer auf seinem Liegestuhl, warf einen verächtlichen Blick auf dessen fetten Bauch, spannte seine Oberarm- und Bauchmuskeln an und raste davon. Er drehte das Radio auf und sang mit Wolfgang Petri „Augen zu und durch“ und überhörte beinahe das Piepsen seines Handys. Er sah auf den Display: Kati ruft an. Er schnaufte tief und nahm ab.
„Igor, nicht böse sein.“
„Bloß keine schlechten Nachrichten, Kati, ich warne dich.“
„Nicht böse sein.“
„Red schon.“
Igor starrte auf die Frau am Steuer des Cabriolets, das er gerade überholte. Sie hatte blonde Locken, genau wie Marilyn. Sie trug eine Sonnenbrille und an ihrem Ohr baumelte ein großer silberner Ring. Igor drosselte das Tempo und blieb genau auf Augenhöhe mit Marilyn. Er lächelte sie an, aber sie schenkte ihm nur einen verächtlichen Blick und warf den Kopf in den Nacken. Er drückte aufs Gas und zischte vorbei.
„Na, was jetzt?!“
„Es ist wegen Brazza.“
„Was is’ mit Brazza?“
„Wir mussten sie ins Krankenhaus bringen.“
„Brazza?!“
Igor bremste Marilyn aus, wodurch ihr Auto kurz ins Schlingern kam und beinahe von einem nachkommenden Mercedes abgeschossen wäre.
„Haha! Du scheiß Fotze!“
„Igor?“
„Nutte!“
„Igor?!“
„Scheiße! Sag, dass das nicht wahr ist, Kati.“
„Wir mussten es tun, sie wäre draufgegangen.“
„Du verarscht mich, oder?“
„Sie war bewusstlos! Die war weg, ich hatte Angst, sie könnte … du hättest sie sehen müssen …“
Igor ließ Marilyn wieder herankommen. Die zeigte ihm den Vogel. Er schickte ihr einen Handkuss.
„Irgendwas stinkt hier, Kati, irgendwas ist da faul. In den letzten beiden Monaten sind uns fünf Mädchen entwischt! Fünf! Ohne Brazza können wir den Laden dichtmachen! Weißt du, wie viele Kunden nur wegen ihr kamen?“
„Genau das ist das Problem. 15 Freier pro Tag … das ist zu viel!“
„Weißt du was? Das war unsere letzte Südamerikanerin! Unsere letzte! Warum hab ich meinen gottverdammten Puff d’Amour genannt? Warum hab ich ihn nicht Russenpuff genannt? Warum? Weil ich eine Alternative zu den Russenbordellen sein wollte!“
„Ich weiß, Igor, aber …“
„Was, wenn die Bullen bei ihr aufkreuzen?“
„Die hat viel zu viel Angst. Die haben alle ’ne scheiß Angst vor dir, das weißt du doch.“
„VERDAMMT NOCHMAL!“ Igor warf das Handy auf den Rücksitz, drückte aufs Gaspedal und schaltete in den höchsten Gang. Er fuhr bis auf wenige Zentimeter auf den Vordermann auf. „Dieses Nuttenpack macht mich krank.“
Er suchte eine Lücke und fuhr auf die linke Spur. Er beschleunigte auf 190 km/h, touchierte beinahe einen BMW mit italienischem Kennzeichen, der ebenfalls überholen wollte, zeigte dem Fahrer den Mittelfinger und schoss nach etwa 200 Metern wieder nach rechts, um die Ausfahrt nicht zu verpassen.
Es gab ein uraltes Gesetz im d’Amour, und das lautete: Ohne Begleitung kam ein Mädchen nur als Leiche raus.
Am Ende der Ausfahrt wartete ein Polizist mit Kelle, Igor fuhr rechts ran. Der Beamte, dessen Kopf einen enormen Umfang hatte und die Sonne verdunkelte, stank aus dem Mund nach Döner. „Papiere und Zulassungsschein, bitte.“
Igor reichte ihm seinen Führerschein und kramte in seiner Jackentasche nach dem Zulassungsschein. Der Polizist ging zu dem Einsatzfahrzeug, in dem sein Kollege den Pass scannte. Igor wusste, was er finden würde. Igor Bajevic, geboren am 18. August 1972 in Banja Luka, wohnhaft in 88131 Lindau, vorbestraft wegen Trunkenheit am Steuer, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Nötigung, Verstoß gegen das Suchtmittelgesetz, Zuhälterei, gefährliche Drohung.
Der Polizist kam zurück.
„Ist Ihnen klar, dass Sie durch einen Baustellenbereich anstatt der vorgesehenen 60 mit 174 km/h gefahren sind?“
Igor zuckte mit den Achseln. Welche Baustelle? Er hatte keine Baustelle gesehen. Also hatte es auch keine Baustelle gegeben.
„Da war keine Baustelle.“
„Steigen Sie bitte aus!“
Igor löste den Gurt und sah auf die Uhr. Es war viertel vor sieben. Er wusste nicht, wen er mehr hassen sollte – Trulli, Kati, Brazza oder die Bullen. Igor entschied sich für die Bullen. Er stieg aus, die Sonne machte ihn blind, es war der letzte Tag im Juli und zugleich der heißeste des Jahres. Der Beamte funkte die Zivilstreife an, die in der Nähe des Baustellenbereichs stand. Die Kollegen würden gleich zur Stelle sein. Inzwischen stieg der zweite Polizist aus dem Auto. Der Zwerg kam Igor bekannt vor. Er hatte sich immer gefragt, wie dieser Typ mit seinen 1,65 überhaupt in der Polizeischule aufgenommen werden konnte.
„Sieh an, sieh an“, sagte Igor und schnalzte mit der Zunge. „Die kurzen Beine kenne ich doch!“
Elmar wäre am liebsten schreiend davongelaufen.
„Ey, ich habe nix von einer Baustelle gesehen, Elmar. Warum machen wir ein Problem, wo kein Problem ist?“
Elmar verwünschte den Tag, an dem er Bekanntschaft mit diesem Abschaum geschlossen hatte. Aber Igor hatte ihn in der Hand, seitdem er sich in dessen Puff eine junge Negerin genehmigt hatte. Das Scheißding, das ausgesehen hatte wie 25, war laut ihrem Pass erst 15 gewesen.
„Wie viel war er zu schnell?“
„110.“
„110?!“ Elmar fluchte. Er flüsterte etwas zu seinem Kollegen, der entrüstet protestierte. Er nahm ihn beiseite, die beiden diskutierten, und es blieb Igor nicht verborgen, dass es eine ziemlich heftige Auseinandersetzung gab. Fünf Minuten später durfte er davonfahren. Als wäre nichts gewesen.
„Tüdelü!“ sang Igor aus dem Fenster und winkte den beiden. Er drehte die Musik laut und drückte auf die Tube. „Verficktes Bullenpack.“
002
An einem Freitagnachmittag schleppte mich Mama zu einem Psychotherapeuten.
„Der wird dir deine Selbstmordgedanken austreiben“, sagte sie.
„Wir haben kein Geld für solche Späße!“
„Er ist noch Student, er kostet nichts.“
Student? Der Typ war mindestens 40 Jahre alt und vor dem Haus stand ein Ferrari. Der Typ war völlig zugekokst, aber Mama merkte das nicht. Er gab mir ein Anti-Depressivum, irgendwelche Pillen, die wie Zäpfchen aussahen und auch so schmeckten, als wären sie für den Hintern bestimmt. Die Schachtel war angebrochen, das Haltbarkeitsdatum sieben Jahre überschritten.
Ich kannte die verfluchten Tabletten. Wenn man die schluckte, war man nicht weniger traurig, aber man konnte nicht mehr weinen. Man konnte einfach nicht mehr weinen. Scheiße, ich hatte keine Depressionen, ich war nur angepisst von meinem Leben. Außerdem weinte ich gerne. Man konnte sich selber so schön bemitleiden, wenn man weinte. Und man konnte jede Diskussion im Keim ersticken. Gegen ein weinendes Mädchen waren die besten Argumente machtlos.
Der Bus, der uns nach Hause bringen sollte, war so überfüllt, dass der Fahrer einige Fahrgäste bitten musste, auszusteigen, aber keiner wollte auf den nächsten warten, denn es gab keinen nächsten. Also blieben alle an Bord. Irgendein Kerl presste sich an mich, legte eine Hand auf meine Brust und grinste. Mamita stand mit dem Rücken zu mir, ich hoffte, sie würde die Fahrt überstehen, ohne einen ihrer Asthmaanfälle zu bekommen. Ich drehte meinen Kopf zur Seite und sagte: „In Cali war alles besser.“
„Nichts war besser in Cali. Du warst ein Kind, das war besser.“
„Papa war da.“
„Der war fast nie da.“
„Ich hatte Freunde, Mamita. Erinnerst du dich an den Geburtstag, als so viele Leute kamen, dass wir die Tische auf die Straße stellen mussten?“
„Du hast deine Schwester.“
„Ich möchte wieder ausgehen, wie früher.“
„Irgendwann bekommt die Polizei das Viertel wieder unter Kontrolle.“
„Bis das geschieht, bin ich alt und hässlich. Dann lädt mich keiner mehr auf einen Drink ein.“
„Ich bin froh, dass ihr nicht mehr in diese verrauchten, lauten Drogenlokale geht. Man kann auch Leute am Tag kennen lernen. Hier im Bus zum Beispiel!“
Oh ja, Mamita. Hier im Bus. Ich sah den Grapscher an. Dem war der Grinser ins Gesicht gemeißelt. Wow, was für ein heißer Typ. Ein Urwald wuchs aus seinen Nasenlöchern und seinen Ohren und er hatte zwei Zahnlücken in den oberen Reihen. Geduscht hatte er das letzte Mal an Ostern.
Bei der vorletzten Haltestelle stieg ein Großteil der Fahrgäste aus. Mamita setzte sich auf einen frei gewordenen Platz. Der Typ aber stand immer noch da mit seiner Pfote auf meiner Brust.
„Du kennst doch Esteban“, hauchte ich in sein Ohr.
„Hm?“
„Esteban, den Bullen“, sagte ich mit meiner besten Sex-Hotline-Stimme. „Den kennst du doch!“
„Claro.“
Er wich ein wenig zurück und sah mich unsicher an.
„Ist mein Onkel. Esteban Méndez. Mi tio.“
Er nahm seine Hand weg und musterte mich.
„Du lügst“, sagte er. „Estebans Nichte würde niemals alleine in so einer scheiß Gegend herumziehen.“
„Lass es darauf ankommen. Du hast bestimmt gehört, was Esteban mit den beiden Typen machte, die das Mädchen in der Parkgarage vergewaltigt haben.“
„Beweis mir, dass du seine Nichte bist.“
Ich zog meinen Ausweis aus meiner Handtasche und hielt ihn dem Typen vor die Nase. „Roswitha Isabel Mendéz.“
„Mierda“, sagte er, und sein Grinsen verschwand aus seinem Gesicht.
„Mit Esteban lege ich mich nicht an. Dabei bist du doch so was von feucht, du kleine Nutte, ich kann deine Muschi riechen.“
„Verpiss dich!“ zischte ich. „Sonst bricht dir Esteban jeden Knochen einzeln.“
„Ich hätt’s dir besorgt, Kleine, den Fick hättest du nicht so schnell vergessen.“ Er ging vor zum Fahrer, und als der Bus von einer Demonstration aufgehalten wurde, stieg er aus. Als er draußen vorbeiging, zeigte ich ihm den Mittelfinger, und er donnerte seine Faust gegen die Scheibe.
Esteban Méndez war der bekannteste Bulle des Landes. Esteban war mehr als ein Bulle, Esteban war ein Popstar. Du konntest kaum den Fernseher einschalten, ohne ihn in einer Talkshow zu sehen. In den Armenvierteln sprayten sie seinen Namen auf die Hauswände, Jugendliche liefen mit T-Shirts herum, auf denen sein Kopf war. Eine Ska-Punk-Band widmete ihm einen Song, ein Boxer ließ sich seinen Namen in großen Buchstaben auf den Rücken tätowieren.
Und ein 21-jähriges Mädchen schlug mithilfe seines Namens einen Grapscher in die Flucht.
Esteban war Kult. Weil er sich nicht von den Reichen schmieren ließ. Nicht von den Reichen, nicht von den Drogenbossen, nicht von den Politikern.
Für Esteban zählte nur die Gerechtigkeit.
Der Bus steckte fest. Demonstranten zogen an uns vorbei, ich sah mir die Gesichter an, suchte das von Onkel Pablo. Er war immer in der ersten Reihe marschiert. Nachdem die Tabakfirma ihn entlassen hatte, wurde er Funktionär bei der Gewerkschaft. In kürzester Zeit wurde er einer ihrer Anführer. Ich weiß nicht, wie oft sie Onkel Pablo verprügelt haben. Sie schlugen ihm die Zähne ein, sie brachen ihm das Schlüsselbein, die Finger, aber niemals den Willen. Im Gegenteil. Der Schmerz machte ihn stärker. Als die Konzerne Killer auf ihn ansetzten, zog er in unser Haus.
Mama hat getobt, aber für uns war Onkel Pablo ein Glück. Mit ihm kam das Lachen ins Haus. Das Lachen und die Bücher. Er brachte einen Lastwagen voller Bücher mit. Er belohnte uns mit Taschengeld, wenn wir die Bücher lasen, die er uns schenkte. Und er schenkte uns viele Bücher. Manchmal war das Essen knapp, aber wir hatten immer was zu lesen. „Das ist die beste Nahrung, das ist die stärkste Waffe“, sagte er und tippte sich an die Stirn. „Das ist unsere Waffe. Die Waffe der Armen.“
Einer der Demonstranten mit vermummtem Gesicht blickte zu mir. Durch die Schlitze sah ich seine blauen Augen. Ich hatte mir immer einen Mann mit blauen Augen gewünscht. Und jetzt sahen mich diese verfluchten blauen Augen unentwegt an. Ich lächelte. Ich winkte. Der Typ winkte zurück. Ich sprang auf und schrie aus der Fensterluke. „Zieh die Maske runter“, rief ich und lachte, aber bei all dem Krach konnte er mich nicht verstehen. Mama packte mich und drückte mich zurück in den Sitz.
Er schickte mir einen Handkuss. Ich schickte ihn zurück.
„Was will der Kerl von dir?“
„Ich will was von ihm, Mamita!“
„Wie heißt du?“ brüllte er.
„Mechibel!“
„Steig aus, Jibell!“
„MECHIBEL!“
„Steig aus, Jibell!“
„Ich weiß doch gar nicht, um was es hier geht.“
„Das Militär will die Obdachlosensiedlung auflösen! Aber wo sollen die Menschen hin? Nur weil es ein paar von den Bonzen ekelt, wenn sie mit ihren Porsches an den Bettlern vorbeifahren müssen, dürfen wir nicht zulassen …“
Weiter kam er nicht. Aus einer Seitengasse stürmten Polizisten und schossen aus dicken Gewehren in die Menge. In kürzester Zeit waren die Demonstranten in Rauch gehüllt. Sie versuchten zu flüchten, aber die meisten von ihnen gingen zu Boden und hielten sich die Hände vors Gesicht. Ich schloss das Fenster, damit das Tränengas nicht in den Bus drang. In dem Moment fand unser Busfahrer eine Lücke und drückte aufs Gas. Ich wurde in den Sitz gepresst, stand auf und stolperte zur hintersten Sitzbank. Ich wollte seine Telefonnummer, aber draußen war nur mehr Chaos, nur noch Rauch. Polizisten prügelten mit Schlagstöcken auf Demonstranten ein. Die revanchierten sich mit Flaschen und Steinen und einem Schweinekopf.
003
Igor saß im Clubraum des d’Amour vor seinem Laptop und öffnete den Outlook-Express. Nebenbei lud er sich einen Amateur-Pornoclip aus dem Internet. Er wichste ein bisschen, aber immer, wenn der Arsch der geilen Sau gut im Bild war, stoppte die Übertragung, weil die Internetverbindung zu langsam war. „Fuck!“
Er tippte die E-Mail mit seinen Zeigefingern:
From: Igor Bajevic
To: Trulli
Sent: Monday, July 10, 2006 3:47 PM
Subject: Latina-Girls
Hey Trulli, you ugly fat man! We need some girls. The best latinas you can find in your town. Amateurs, no professionals! Don’t you dare to send us any fucked up drug-whores! I need beautiful, young, innocent faces with perfect bodies. Age under 18, if possible, but not younger than 14! Good tits, firm asses. We need them soon. Send us some photos.
Igor wichste noch ein bisschen, dann überlegte er sich, ob er eine von den Nutten besteigen oder ins Fitnesscenter fahren sollte. Er warf eine Münze.
Die Münze sagte Muschi.
Sein Herz sagte: Muschi und H.
Oh ja, eine Muschi und ein kleiner Schuss, das würde den sinnlosen Tag retten.
004
Zu Hause empfing uns Donna in Hochstimmung. Das Radio lief auf voller Lautstärke, es duftete nach Haarspray und Parfum und ihr nackter Hintern wackelte im Takt zu „Hips don’t lie“ durch die Gegend.
„Hola, chica!“ trällerte sie und gab mir einen nassen Schmatz auf die Wange. „Na?! Gehst du mit?“
„Wohin? Du musst doch arbeiten!“
„Eben! Komm mit! Komm mit zu den Velazquez!“
„Soll ich dir beim Kloputzen zuschauen?“
„Oye! Ich putze keine Klos! Mamita, wie oft muss ich es dieser Tussi noch sagen: Ich putz die Sa-ni-tär-an-la-gen.“
„Scheiße bleibt Scheiße und Scheiße stinkt, egal, wie du sie nennst. Ich bleib jedenfalls hier.“
„Na gut. Dein Pech. Die Herrschaften sind nämlich ausgeflogen. Juan will mir die Villa zeigen.“
„Scheiße, Velazquez’ Villa?!“
„Komm mit!“
„Scheiße, scheiße.“
Wir konnten es uns nicht leisten, zwei Bustickets zu kaufen, aber Donna hatte eine Idee. „Du gehst voraus, bückst dich vor dem Fahrer, zeigst ihm deine Titten, und der merkt garantiert nicht, wie ich hinter dir vorbeiflitze.“
Der Trick mit den Titten klappte, aber Donna war so aufgeregt, dass wir in den falschen Bus einstiegen. Im richtigen Bus gelang der Trick nicht mehr. Wir mussten beide zahlen.
„Morgen gibt’s gekochte Mäuse“, sagte ich zu Donna.
Das Anwesen der Velazquez war von einer hohen Mauer umgeben. Als das Eingangstor sich wie von Geisterhand öffnete, standen Donna und ich ehrfürchtig da. Wir wagten es nicht, uns zu rühren.
„Buenos días!“ ertönte eine Stimme aus der Sprechanlage. „Hereinspaziert!“
Links von dem Tor stand ein Container, der aussah wie ein Gartenhäuschen, weil er völlig mit Efeu bewachsen war. Die Tür stand offen und wir traten ein. Juan saß vor mehreren aufgetürmten Computerbildschirmen, an der Wand hing eine Alarmanlage mit vielen blinkenden grünen, gelben und roten Lämpchen.
„Die Villa ist besser gesichert als jede Bank in Bogotá“, sagte Juan. Wir spazierten zum Haus, das etwa 100 Meter vom Eingang entfernt war. Ich musste Juan ständig anglotzen. Er war furchtbar dick und furchtbar groß, hatte eine Haut, die so dunkel war, dass man die Nase in seinem Gesicht kaum finden konnte. Sein Gesicht war ein schwarzes Loch mit zwei weißen Perlen.
„Hör auf, so zu starren“, zischte Donna in mein rechtes Ohr. „Das ist ja peinlich.“
Die Velazquez lebten in einer Märchenwelt. Auf dem Weg zur Villa kamen wir an einem Teich mit Wasserfall, an Wiesen, auf denen uralte Bäume standen und zwei Pferde grasten, an Steinskulpturen und einem riesigen Swimming Pool mit zwei Sprungbrettern vorbei. Alles war so unwirklich. Ich war mittendrin in einer dieser bekloppten MTV-Reportagen, in denen aufgestylte Tussis auf Koks die Villen und Schlösser von Popstars, Schauspielern oder Millionären präsentierten.
Meine verschwitzten Hände hielten verkrampft meinen kleinen Rucksack, als Juan uns in die Villa führte. Die Zimmer waren groß und hell und sauber. Es gab nur wenige Möbel, dafür jede Menge Kunst. Vasen, Skulpturen, Glasmalereien und so Zeug. Ich war völlig von den Socken, Donna ließ das alles kalt.
Juan öffnete eine Tür. Der Raum war finster. Wir konnten nichts erkennen. Dann gab es einen Knall und die Red Hot Chili Peppers hampelten auf einer Leinwand herum. Der Bass fuhr mir in den Magen und ließ mein Herz im Takt des Songs schlagen.
Es war, als stünden wir mitten auf der Bühne.
Juan schaltete wieder aus.
„Noch mal“, sagte Donna.
„Scheiße“, sagte ich. „Die haben ein Kino im Haus!“
„NOCH MAL!“
Im Schlafzimmer durften Donna und ich uns in das Bett der Velazquez legen. Es war riesig. Die Bettwäsche duftete nach Lavendel und Rosen. Die Zimmerdecke war eine Koppel aus Glas, man konnte den Himmel sehen.
„Wenn die Nacht klar ist, sieht man den Mond und die Sterne. Man glaubt, in einem Raumschiff zu sitzen und durch das Weltall zu düsen.“
„Dios mío“, sagte Donna und seufzte. „Hier zu leben muss das Paradies sein.“
Ohne Vorwarnung ließ sich Juan aufs Bett fallen, Donna und ich wurden in die Höhe katapultiert, und Donna landete mit einem Schrei auf dem Boden.
„Glaubt ihr das? Glaubt ihr, die Familie Velazquez wäre glücklicher als ihr?“ sagte Juan, streckte seinen Arm aus, um Donna zurück ins Bett zu hieven.
„Das glaube ich nicht, das weiß ich“, sagte Donna mit schmerzverzerrtem Gesicht, weil sie sich bei der Aktion das Steißbein geprellt hatte und für zwei Wochen ziemlich idiotisch durch die Gegend watscheln musste.
„Señora Velazquez geht dreimal die Woche zur Psychiaterin.“
„Das tut sie aus Langeweile.“
„Sie ist todunglücklich, Mechibel. Die Dinge, die einen wirklich glücklich machen, kann man nicht kaufen.“
„Ahy Juan, por favor“, sagte Donna und klatschte in die Hände. Das Licht ging an. Sie klatschte nochmals. Das Licht ging aus. „Das will man den Armen nur einreden, damit sie nicht auf die Straße gehen. Du würdest sofort den Container verlassen und in die Villa ziehen, wenn du könntest!“
„Natürlich würde ich tauschen! Aber daran zu denken, bringt mir nichts. Ich muss mir den Arsch nicht mit Klopapier abputzen, das feucht ist und nach Vanille duftet. Ich brauche keine drei Autos, ich brauch keinen Swimming Pool, keine Designer-Möbelgarnitur, kein Licht, das ich mit Händeklatschen …“
Ich klatschte zweimal in die Hände, da machte es Klick und Klack und Musik kam aus den Boxen, die ich nirgends sehen konnte. Die Musik kam von oben und von unten, von vorne und von hinten. „Du lügst, Juan! Du lügst!“
„Ein Streichholz, ein Kanister Benzin und alles ist futsch“, sagte Juan.
„Du hast Donna, du hast deine Mutter, Mechibel. Das ist mehr wert als der ganze verdammte Plunder hier. Das ist unbezahlbar.“
„Du liest zu viel Coelho!“
„Solange ich was zu futtern habe, solange ich was zum Anziehen habe und ein Dach überm Kopf, solange werde ich die Velazquez nicht beneiden. Die Sonne scheint für mich gratis, die Bäume im Garten blühen für mich gratis, das Radio spielt Musik für mich gratis …“, Juan versuchte sich aufzurichten, aber es gelang ihm nicht. Er ruderte mit den Armen und versank wieder, „… und euer Lächeln ist gratis, das Lächeln der beiden schönsten Mädchen Bogotás. Scheiße, was will ich mehr?“
„Ahy, Juan!“ Ich schlug mich mit der Hand auf die Stirn.
„Ein Lächeln von dir, Mechibel, das ist mehr wert als dieses blöde Kino.“
„Ich verkauf dir mein Lächeln. Ich tausch es gegen das Kino.“
„Du weißt nicht, was du da sagst. Sagt mir, warum die Señora nicht glücklich ist?“
„Vielleicht ist sie glücklich. Keiner kann in einen anderen Menschen hineinsehen.“
„Ich kann ihre Tränen sehen. Jeden Tag.“
„Juan! Du weißt nicht, wie das ist, wenn man in der Nacht wach liegt, weil einen die Gedanken auffressen, wo man Geld für den Strom und die Miete auftreiben könnte, ohne zu stehlen oder einem Kerl den Schwanz zu lutschen. Du weißt nicht, wie das ist, wenn deine Mutter vor Schmerzen schreit, weil du die Medikamente nicht bezahlen kannst.“
„Eure Mutter ist krank?“
Donna und ich schwiegen. Wir erzählten nicht gerne von Mamita, weil die Leute sonst glaubten, wir wollten Mitleid schinden.
„Was ist mit eurem Vater?“
Über Papa redeten wir schon gar nicht.
„Ich muss mal“, sagte ich.
„Was ist mit eurer Mutter?“
„Ich muss ganz dringend.“
„Du kannst auswählen“, sagte Juan. „Es gibt vier Klos im ganzen Haus.“
„Klos? Donna sagt, bei den Velazquez gäbe es keine Klos.“
„So?“
„Nur Sanitäranlagen.“
„Halt’s Maul“, sagte Donna. „Pass besser auf, dass du sie nicht verdreckst, ich muss noch putzen.“
„Ich scheiß es von oben bis unten zu“, sagte ich und schnappte meinen Rucksack. „Ich will dort pissen, wo es das feuchte Klopapier gibt, das nach Vanille duftet.“
„Treppe runter, zweite Tür rechts.“
Auf dem Weg dorthin gab es so viele Türen, so viele Zimmer. Mamita, Donna und ich mussten seit Jahren in einem einzigen Raum leben. Dem Raum, in dem wir kochten, aßen, lachten, weinten, stritten, fluchten, liebten, schliefen.
So viele Türen. So viele Zimmer. Eines schöner, heller, größer als das andere. Und in jedem Zimmer gab es eine Heizung. Damit die Hintern der Reichen nicht froren.
Scheiße, ich konnte einfach nicht widerstehen.
Ich öffnete eine Tür.
Nachdem Donna und ich die Klos geschrubbt hatten und ich die verfluchten Tabletten des Studenten die Schüssel hinuntergespült hatte, tranken wir mit Juan Bier im Container. Wir stießen an, wir lachten und quatschten und vergaßen für einen Moment den Bus, der uns zurück in unsere Welt bringen würde.
„Wollt ihr in den Pool?“
„In den Swimming Pool?! Wir dürfen in den Swimming Pool?“
„Das Wasser ist beheizt und die Señora hat einen Kleiderkasten voll mit Badeanzügen und Bikinis. Sucht euch was aus!“
„Wir dürfen in den Pool!“ sagte ich und schon landete meine Jeansjacke und mein Pulli auf Juans Kopf. Ich war schneller nackt, als Donna schimpfen konnte, und lief aus dem Container, den Weg hoch zum Pool.
Nach dem Baden legten wir uns auf die Terrasse und hüllten uns in dicke Decken. Juan mixte uns Drinks und legte Salsa-Musik auf. Er tat so, als wäre er Señor Velazquez und wir taten so, als wären wir feine Damen. Dabei waren wir doch alle nur Hochstapler.
005
Es war bereits kurz vor Mitternacht, als sich Donna eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank holte und sich an den wackligen Küchentisch setzte, auf dem eine Schale mit verfaulten Bananen und eine zerknitterte Ausgabe der El Tiempo lag. Die Seiten waren bereits vergilbt, die Stellenanzeigen allesamt durchgestrichen oder abgehakt.
Das Baby in der Wohnung nebenan brüllte. Es brüllte schon seit Stunden, weil es Hunger hatte, es brüllte, weil der Hunger es wütend machte.
Irgendwann polterte es an die Tür. Nach einem Blick durch den Spion öffnete Donna. Miguels Mutter stand vor ihr, das schreiende Baby auf dem Arm.
„Weißt du, wie spät es ist?“ sagte Donna.
„Fick dich! Ihr füttert die Köter von der Straße und mein Kind verhungert. Dass ihr euch nicht schämt! Seht euch den Kleinen an! Er hasst mich! Er hasst seine Mutter, weil sie ihm nichts zu essen geben kann!“ Donna lief zur Spüle und holte unter dem Waschbecken einen Teller mit Essensresten hervor und brachte ihn Miguels Mutter. „Hier! Das füttern wir den Hunden. Stopf es deinem Kind ins Maul, bis es ihm zu den Ohren rauskommt!“ Donna schmetterte die Tür zu.
„Wer war das?“ rief Mechibel aus dem Klo.
„Die Hexe.“
„Welche Hexe?“, sagte ihre Mutter.
„Stell ihr bloß nie wieder was zum Fressen vor die Tür. Die Schlampe soll verhungern.“
„Sei nicht so gehässig. Das Baby kann nichts dafür. Und Miguel auch nicht.“
„Verfickte Hexe.“
Donna setzte sich zurück an den Tisch.
„Mechibel braucht einen Job“, sagte sie und öffnete das Bier an der Tischkante. „Ich will nicht, dass sie so endet wie diese Schlampe.“ Sie vertiefte sich in die Zeitung, las noch einmal jede Anzeige. Ihre Hände stanken nach Putzmittel, draußen fielen Schüsse.
Eins, zwei, drei.
„Sie schreiben, dass die Arbeitslosenzahlen zurückgehen, dass die Wirtschaft boomt und das Land sicherer wird, aber scheiße, was nützt uns das, wenn in unserem Viertel alles beim Alten bleibt?“
Vier, fünf.
„Was macht Mechibel so lange auf dem Klo?“
„Sie will alleine sein.“
„Sag ihr, sie soll rauskommen.“
„Ist dir lieber, sie steht am Fenster?“ Donna seufzte und trank aus der Flasche. Sie knallte sie auf den Küchentisch. „Findest du nicht, dass ich zu viel trinke, Mamita?“
„No. Was soll die Frage?“
Donna hätte sich gewünscht, ihre Mutter würde sich einmal auch Sorgen um sie machen. Aber sie war ja die „große“ Schwester. Die, die man ruhig mal auf den Boden werfen durfte, ohne Gefahr zu laufen, etwas kaputt zu machen. Alles drehte sich um Mechibel in dieser Wohnung, das war schon immer so. Dabei hatte sie doch auch ihre kleinen und großen Sorgen. Manchmal schloss sie sich im Klo ein, um zu weinen.
„Wir müssen Strom sparen“, sagte Señora Méndez und löschte die Lampe.
„Und wie soll ich jetzt lesen?“
„Musst du lesen?“
„Ich kann mich auch sinnlos besaufen“, sagte Donna und holte eine neue Flasche Bier aus dem Kühlschrank. Sie öffnete die Flasche mit den Zähnen und warf den Verschluss aus dem Fenster. Señora Méndez nahm zwei Kerzen aus der Küchenschublade und versuchte, sie anzuzünden. Ihre Hände zitterten so stark, dass sie mehrere Streichhölzer verbrauchte, ehe die Kerzen brannten. Sie stellte eine auf den Tisch, die andere aufs Fensterbrett. Während Donna an einen Typen dachte, der nichts von seinem Glück wusste, kreisten ihre Gedanken um ihren Ex-Mann, den letzten Mann, den sie geliebt hatte. Den einzigen Mann, den sie jemals geliebt hatte. Sie hätte Donna gerne von dem Besuch letzte Woche erzählt, sie hätte so gerne erzählt, dass ein Junge von einem Paketdienst hier gewesen war, ihr ein Päckchen von ihrem Ex-Mann übergeben hatte und wortlos verschwunden war. Sie hätte so gerne erzählt, so gerne … Nein, ihre Töchter würden nicht verstehen. Niemals würde sie das Paket anrühren, sie würde es auch nicht wegwerfen, aber anrühren, nein, niemals. Sie würde ihm nie verzeihen, nie, nie, nie, er hatte ihr Leben, ihr Glück zerstört. Wie war er damals angekrochen gekommen, wie ein Hund winselnd vor der Tür gestanden, aber sie hatte ihn weggejagt, sie würde ihn wieder wegjagen. Aber mehr aus Wut über sich selber als aus Wut über ihn. Denn in den letzten Wochen, da sie immer öfters in der Nacht wach lag vor Schmerzen, da malte sie sich aus, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn sie ihm verziehen hätte. Sie wäre nie in der Quecksilberfabrik gelandet, sie hätte zu Hause bleiben und sich um ihre Töchter kümmern können, sie hätte sich das Theater mit ihrem Stiefbruder Pablo erspart … und sie müsste nicht Tag und Nacht auf der Couch hinvegetieren und sich von ihren Töchtern pflegen lassen.
Sie war erst 41.
Und alles war vorbei.
Sie fühlte es.
Manchmal, wenn sie in der Nacht wach lag, überfiel sie ein unheimliches Gefühl. Dann wusste sie, dass sie jetzt sterben würde. Sie war sich ganz sicher, dass sie jetzt und hier sterben würde. Und dann musste sie nach Luft ringen, musste sie sich konzentrieren, musste sie das Gefühl und die Gewissheit abschütteln, weil es sonst kein Entrinnen gab.
Kein Zweifel, der Tod war nahe.
„Nimm Mechibel mit zu den Velazquez, hörst du? Sie kann nicht nur hier in der Wohnung rumsitzen. Nimm sie mit! Warum könnt ihr nicht zu zweit putzen?“
„Die Señora will das nicht.“
„Frag noch mal! Was kann sie dagegen haben? Ihr seid doppelt so schnell!“
Es klingelte an der Tür. Ehe Donna reagieren konnte, schoss Mechibel aus dem Klo und öffnete sie. Man konnte Stimmen tuscheln hören.
„Ich kann sie nicht mitnehmen“, sagte Donna.
„Warum nicht?“
„Ich nehme sie nicht mit.“
„Warum?!“
„Sie klaut!“
„Sie klaut?“
„…“
„Das ist billig, Donna.“
„Sie klaut!“
„Hör auf zu lügen.“
„Was ist dir lieber? Eine Tochter, die lügt, oder eine, die stiehlt?“
„Mechibel tut vieles, was ich nicht verstehe, aber Klauen tut sie nicht.“
„Oh, und mit wem steht sie gerade an der Tür?“
„Keine Ahnung!“
„Mit den Piratas.“
„Wer sind die Piratas?“
„Das ist die verfluchte Gang, die den scheiß Hof kontrolliert, den Hof und das Haus und die Straße. Da ist kaum einer über 18, aber wer sich mit denen anlegt, kann seinen Sarg bestellen.“ Donna ging mit der Flasche Bier zum Fenster und sah ihr Spiegelbild. Als Kind hatte man sie oft für einen Jungen gehalten, ja, sie selbst hatte sich für einen Jungen gehalten. Hatte im Stehen gepisst, böse geflucht, beim Fußball die Jungs über die Klinge springen lassen und niemals Röcke getragen. Irgendwie sah sie immer noch ein bisschen wie ein Junge aus.
Hinter ihrem Rücken versuchte Señora Méndez aufzustehen, sie setzte ein Bein auf den Boden, wollte das zweite nachziehen, da machte es einen Bums und sie lag auf dem Hintern. Donna sollte noch Wochen später anfangen zu zittern, wenn sie an den Schrei dachte, den ihre Mutter ausstieß.
„Oh Mamita! Qué pasa? Mechibel! Mechibel!“
„Ich kann jetzt nicht!“
„MAMITA! MAMITA! AHY DIOS!“
Mechibel kam angerannt und machte Licht. Mit vereinten Kräften brachten sie ihre Mutter zurück auf die Couch. Señora Méndez brüllte vor Schmerzen. Und Wut. „Meine Tochter stiehlt! Meine Tochter wird im Gefängnis landen!“
Es dauerte eine Zeit, bis sie sich wieder beruhigt hatte. Als Mechibel zurück zur Haustür rannte, war niemand mehr da. Niemand und nichts. Auch ihr Rucksack mit dem I-Pod, der Digi-Cam, dem Handy und dem Fotoapparat war verschwunden. Sie lief hinaus auf den Gang zum Lift. Niemand da. Die Schweine waren abgehauen.
„Weißt du, was es heißt, in Kolumbien in einem Gefängnis zu sein?“ hörte sie ihre Mutter. „Pablo war im Gefängnis, ich wünschte, er wäre jetzt hier und könnte dir ein paar Geschichten erzählen!“
„Onkel Pablo war immer stolz, im Gefängnis gewesen zu sein“, sagte Donna.
„Jedes Mal, wenn er raus kam, sagte er, die Tage im Gefängnis würden im Fegefeuer angerechnet. Jedes Mal, wenn er raus kam, hat er eine Woche kein Wort geredet. Ja, vor euch hat er den Starken gespielt. Vor euch und den Journalisten. Nur ich habe ihn weinen gesehen. Und ich will nicht, dass meine Töchter auch nur eine Nacht in einem Gefängnis verbringen müssen.“
„Das hier ist auch ein Gefängnis.“
„Hast du eine Ahnung“, sagte ihre Mutter und zog die Decke bis zum Kinn. Sie beobachtete ihre Tochter, die vor ihrem Handspiegel mithilfe eines Taschentuchs einen Pickel ausdrückte.
„Schau weg!“
„Warum hast du zugelassen, dass deine Schwester stiehlt?“
„Weil wir das Geld brauchen.“
„Bringt das Zeug zurück, aber schnell.“
„Dafür ist es zu spät.“
„Ich dachte, meine Töchter wären anständig.“
Donna zerknüllte das Taschentuch und warf es in den Müllkorb.
„Und was bringt dir deine Anständigkeit, Mamita? Gott lässt dich elend verrecken, Gott kümmert sich einen Scheiß um dich.“
„Hör auf, so zu reden. Das ist eine Sünde.“
„Es ist eine Sünde, was Gott mit dir anstellt. Mechibel stiehlt, weil es um Leben und Tod geht. Um dein Leben, Mamita. Um dein Leben.“
„Ich wähle den Tod. Wenn der Preis für das Leben eine Sünde ist, wähle ich den Tod.“
„Ich das Leben. Haben wir kein Recht auf Leben? Sind wir nur hier, um langsam zu krepieren?!“
„Das siebte Gebot, Donna! Das siebte Gebot!“
„Nein, Mamita, das wichtigste Gebot, das wichtigste: Du sollst leben! Leben! Wir haben ein Recht auf Leben! Wir sind nicht nur geboren, um zu sterben!“
Mechibel saß mit angewinkelten Beinen neben der Tür und starrte an die Wand gegenüber. Die Piratas hatten ihren Rucksack mitgenommen und sie würden ihn nicht wiederbringen.
Sie würde ihn sich wiederholen müssen.
006
Alvaro Hérnandez, der Armendoktor, sagte, Mama hätte nur noch ein Jahr zu leben. „Vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein wenig kürzer. Hoffnung gibt es leider nicht.“
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!