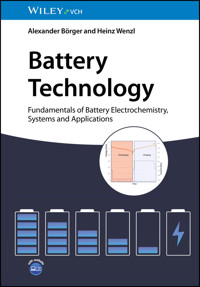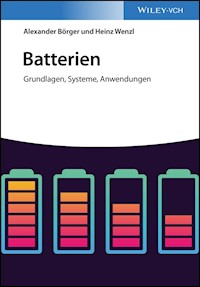
70,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH GmbH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Batterien
Für die Mobilität und Energieversorgung der Zukunft: Kompakte und praxisnahe Wissensvermittlung aller wichtigen Batteriegrundlagen und -systeme
Batterien sind in vielen Fällen die bevorzugte Lösung zur technischen und wirtschaftlichen Optimierung von Fahrzeugen und Energieversorgungsystemen und ermöglichen es, Emissionen zu verringern und die Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas zu reduzieren. In der Summe aller Eigenschaften erfüllen Blei-Säure-Batterien und Lithium-Ionen-Batterien die Anforderungen der verschiedensten Anwendungen am besten und dominieren deshalb den Markt. Lithium-Ionen-Batterien dringen in immer weitere Anwendungsgebiete vor, bzgl. Wert und Produktionsmenge in MWh dominieren aber immer noch Blei-Säure-Batterien. Aus Sicht der Autoren sind Kenntnisse beider Batterietechnologien wichtig, um das Verständnis für Batteriesysteme zu vertiefen und sie in den seltenen Fällen, in denen diese beiden Batterietechnologien technische oder wirtschaftliche Alternativen sind, gegeneinander abzuwägen.
Die Anforderungen an Batteriesysteme sind hoch. Sie müssen leicht und häufig ladbar sein und müssen thermisch, elektrisch und mechanisch stabil sein. In der Batterieforschung kommt materialwissenschaftliches, elektrochemisches und Ingenieurwissen zusammen.
Die Autoren Alexander Börger und Heinz Wenzl geben mit diesem Buch einen umfassenden und kompakten Überblick zu den Grundlagen, Systemen und Anwendungen der Batterietechnik. Es werden Hintergründe zum Aufbau von Batterien und grundlegende Prozesse anschaulich erläutert. Anhand vieler Beispiele wird gezeigt, wie das Wissen in die Praxis umgesetzt wird.
- Klarer Fokus: Das Buch legt den Schwerpunkt auf Batteriesysteme, ihre Eigenschaften im Betrieb und Anwendungen.
- Das Buch ist als Begleitlektüre zum Studium verwendbar.
- Wachstumsmarkt: Das Interesse an Elektromobilität und Batteriespeichern in der Stromversorgung wächst und damit auch der Bedarf an Batteriesystemen.
- Anwendungsnah: Fallbeispiele aus der aktuellen Batterieentwicklung setzen die Theorie in die Praxis um.
- Expertenwissen: Die Autoren verfügen über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Batterietechnik.
Batterien: Grundlagen, Systeme, Anwendungen richtet sich an Ingenieurinnen und Ingenieure zur Einarbeitung in die Materie und als Nachschlagewerk sowie an Studierende als Begleitlektüre zu Vorlesungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 803
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Batterien
Grundlagen, Systeme, Anwendungen
Alexander Börger und Heinz Wenzl
Autoren
Dr. Alexander BörgerVolkswagen AGAm Remenhof 17a38104 BraunschweigDeutschland
Prof. Dr. Heinz WenzlTechnische Universität ClausthalInstitut für Elektrische Energietechnikund EnergiesystemeLeibnizstraße 2838678 Clausthal-ZellerfeldDeutschland
Umschlag© iarti/Getty Images
Zusatzmaterial erhältlich unterwww.wiley-vch.de/ISBN9783527338832
Alle Bücher von Ernst & Sohn GmbH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Information derDeutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2023 Ernst & Sohn GmbH, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Satz le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Print ISBN 978-3-527-33883-2ePDF ISBN 978-3-527-69142-5ePub ISBN 978-3-527-69140-1
Gedruckt auf säurefreiem Papier.
Vorwort
Durch die Elektromobilität, die Energiewende, den steigenden Bedarf an unterbrechungsfreier Stromversorgung und die vielfältigen portablen Heimelektronikprodukte ist der Bedarf an elektrochemischen Energiespeichern in den letzten Jahren und Jahrzehnten rasant und geradezu explosionsartig angestiegen. Nach wie vor befindet sich die Branche in raschem Umbruch, allein die großen Automobilhersteller werden in den nächsten Jahren hohe Milliardenbeträge in neue Batterietechnologien investieren.
Ziel dieses Buches ist es, eine Brücke von der Elektrochemie als Basis aller Batterien zu den technischen Fragestellungen bei der Auswahl und Betriebsführung von Batterien in den verschiedensten Anwendungsgebieten herzustellen. Unser Anspruch ist dabei nicht, die hervorragenden Lehrbücher für Elektrochemie zu ergänzen, sondern vielmehr elektrochemisch Geschulten den Weg bis zum Einsatz einer Batterie aufzuzeigen und so das Wissen für die Nutzung von Batterien zu vermitteln, und einen „Blackbox‐Ansatz“ bei der Systemintegration durch ein grundlegenderes und elektrochemisch fundiertes Verständnis für das Verhalten vieler Einzelzellen in Reihen‐ und Parallelschaltung zu ersetzen.
Diese Brücke versucht das vorliegende Buch, in das Lehrerfahrungen an den Technischen Universitäten Clausthal und Braunschweig eingeflossen sind, zu schlagen. Zur Vertiefung der Materie und Überprüfung des Verständnisses werden auch Aufgaben angeboten. Zudem soll eine kurze Zusammenfassung am Anfang jedes Kapitels auch eine kursorische Lektüre ermöglichen.
Der allgemeine Sprachgebrauch verwendet das Wort Batterien pauschal für alle elektrochemischen Energiespeicher. Die sprachliche Unterscheidung in galvanische Primärelemente (nicht wiederaufladbar), galvanische Sekundärelemente bzw. Akkumulatoren (wiederaufladbar), Einzelzellen, Blöcke oder Module (mehrere Zellen in Reihe und/oder parallel geschaltet, teilweise in einem Gehäuse ohne Mess‐ und Anschlussmöglichkeiten an die Einzelzellen) und Batteriesysteme erfolgt in diesem Buch nur, wenn sie im Kontext wichtig ist.
Dieses Lehrbuch behandelt besonders intensiv die beiden wirtschaftlich wichtigsten Batterietechnologien Blei‐Säure‐Batterien und Lithium‐Ionen‐Batterien. Auch aktuelle Studien von Eurobat (www.eurobat.org) oder Avicenne (www.avicenne.com) zeigen, dass die absoluten Zuwächse bei Blei‐ und Lithium‐Ionen‐Batterien bezogen auf den Energieinhalt in Kilowattstunden nach wie vor in vergleichbaren Größenordnungen liegen – trotz der rasanten Zuwachsraten und der hohen auch industriellen und akademischen Aufmerksamkeit für Lithium‐Ionen‐Batterien. Die Autoren sind davon überzeugt, dass Blei‐Säure‐Batterien noch über viele Jahre eine wichtige Batterietechnologie bleiben werden und somit in einem Lehrbuch nicht ausgeklammert werden dürfen. Zudem sind wir der Meinung, dass die Kenntnis beider Batterietechnologien zu einem vertieften Verständnis führt.
Neben Blei‐ und Lithium‐Ionen‐Batterien gibt es eine Vielzahl weiterer Batterietechnologien, die in unterschiedlichen Nischenanwendungen ihre Bedeutung weiter bewahren werden. Die wichtigsten davon werden kurz in einem gemeinsamen Übersichtskapitel behandelt und es wird zur Verdeutlichung von Zusammenhängen in verschiedenen Kapiteln gelegentlich auf sie Bezug genommen. Daneben werden in diesem Übersichtskapitel einige neue Batterietechnologien kurz vorgestellt, die aus unserer Sicht in den nächsten Jahren den Sprung aus dem Labor in wirtschaftlich relevante Anwendungen schaffen könnten. Ob und wann die zu lösenden Material‐, Herstellungs‐ und Integrationsprobleme gelöst werden können, ist ungewiss. Der Weg von einer kleinen Laborzelle zu einem einsatzfähigen Batteriesystem ist lang und beschwerlich.
Nicht wiederaufladbare Batterien (sog. Primärzellen) werden in diesem Buch nur am Rande behandelt, was einerseits den Arbeitsgebieten der Autoren geschuldet ist, andererseits aber auch daran liegt, dass die zugrunde liegenden Konzepte von Ladung, Nebenreaktionen usw. für Sekundärzellen wesentlich andere sind, sodass eine tiefer gehende Behandlung von Primärzellen den Rahmen des hier Betrachtbaren sprengen würde. Brennstoffzellen sind keine Energiespeicher, sondern Energieumwandlungssysteme und werden deshalb auch nicht behandelt, obwohl ihre elektrochemischen Grundlagen weitgehend denen von Batterien entsprechen. Für dieses Teilgebiet existiert aber auch bereits eine umfassende spezifische Fachliteratur, auf die an dieser Stelle verwiesen sei.
Auf die Produktionsprozesse für Batterien wird nicht besonders eingegangen. Es werden aber an verschiedenen Stellen Anmerkungen zu produktionstechnischen Fragestellungen gemacht, wenn diese zur Verdeutlichung von Zusammenhängen und zum generellen Verständnis beitragen können.
Alle Batterietechnologien basieren auf den gleichen physikalischen und chemischen Grundlagen, auch wenn die meisten technisch relevanten Eigenschaften deutlich unterschiedlich sind. Auch die grundsätzlichen Anforderungen an den Aufbau und den Betrieb sind sehr ähnlich. Batterietechnik ist und bleibt ein interdisziplinäres Arbeitsfeld zwischen Elektrotechnik, Chemie, Verfahrenstechnik, Maschinenbau, Physik, Informatik und anderen Fachdisziplinen. Entsprechend heterogen sind die Vorkenntnisse und somit auch die Interessen von Studierenden und Fachleuten; wir haben in diesem Buch versucht, einen gesunden Ausgleich zwischen naturwissenschaftlicher Tiefe und technischer Funktionalität zu finden.
Das Buch ist in drei große Abschnitte unterteilt:
Grundlagen der Batterietechnologie,
Übersicht über unterschiedliche Batteriesysteme (inkl. detaillierter Beschreibung von Blei‐ und Lithium‐Ionen‐Batterien),
Anwendungen von Batterien.
Im Anhang ist eine Übersicht über die verwendeten Begriffe enthalten, eine Übersicht über Normen, technische Richtlinien und Merkblätter von Industrieverbänden, eine Übersicht über den sicheren und umweltverträglichen Umgang mit Batterien sowie weitere vertiefende technische Informationen zur elektrochemischen Impedanzspektroskopie.
Am Ende jeden Kapitels werden Literaturquellen angegeben, die die dargestellten Informationen vertiefen. Eine unmittelbare Quellenangabe erfolgt nur, wo diese aus urheberrechtlichen Gründen oder zum besseren Verständnis geboten erscheint.
Wir danken unseren Familien für die Unterstützung bei der Abfassung dieses Buches und allen, die in irgendeiner Weise zum Gelingen beigetragen haben, insbesondere auch den zahlreichen Studenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern des Instituts für Elektrische Energietechnik und Energiesysteme der TU Clausthal, deren Fragen, Auffinden von Informationen und Aufbereitung von Messdaten erheblich zu diesem Buch beigetragen haben.
September 2022, Lehre/OsterodeA. Börger und H. Wenzl
1Einführung
Batterien und andere Energiespeicher sind Optionen zur technischen und wirtschaftlichen Optimierung eines Energieversorgungssystems und in vielen Fällen unverzichtbar zur Sicherstellung der geforderten Funktionen. Sehr häufig stehen Batterien aber in Konkurrenz zu anderen Technologien, die bzgl. der Entwicklung und Marktchancen von Batterien mitberücksichtigt werden müssen.
Ein Vergleich von Batterien, insbesondere auch mit anderen Energiespeichertechnologien, hat ohne genaue Kenntnis des Anwendungsfalls und Beachtung vergleichbarer Systemgrenzen nur eine geringe Aussagekraft.
Fast alle Batterien basieren auf den gleichen physikalischen und chemischen Grundlagen. Unterschiedliche elektrochemisch aktive Materialien und Bauformen führen zu großen Eigenschaftsunterschieden, unter anderem auch bzgl. der für den sicheren und langlebigen Betrieb notwendigen Zusatzkomponenten.
Übliche Einteilungen für Batterien erfolgen nach der Überbrückungszeit und den Anwendungsbereichen portabel, mobil und stationär.
1.1 Energieversorgung allgemein
Energiespeicher sind eine Option zur technischen und wirtschaftlichen Optimierung eines Energieversorgungssystems, weil sie eine schnelle und effiziente Anpassung der Energieerzeugung1) auf den Energieverbrauch ermöglichen. Ohne Energiespeicher, die Energie sowohl aufnehmen als auch abgeben können, müssten sich Erzeugungs‐ und Verbrauchseinheiten immer mit sehr hoher zeitlicher Dynamik aneinander anpassen. Dies ist oft nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand möglich. Energiespeicher dienen fernerhin als Energiequelle für technische Systeme, die über keine eigene Energieversorgung aus Primärenergieträgern verfügen, sowie zum Anfahren von Anlagen, die in den meisten Fällen nicht ohne die Bereitstellung elektrischer Energie aus einem Energiespeicher oder dem elektrischen Netz gestartet werden können.
Die Nutzung von Batterien ist in vielen Fällen zur Sicherstellung der geforderten Funktionen unverzichtbar. Im Folgenden soll anhand der Beispiele Elektromobilität und Stromversorgungssystem dargestellt werden, dass bei Abschätzungen und Prognosen über die zukünftige Bedeutung von Batterien immer der technische und wirtschaftliche Gesamtzusammenhang sorgfältig zu beachten ist.
Abbildung 1.1 zeigt die Einbindung von Energiespeichern in das Gesamtsystem der elektrischen Energieversorgung und verdeutlicht insbesondere, dass Energiespeicher2) mit vielen technischen Alternativen zur Sicherstellung der geforderten Funktionen konkurrieren. Neben hochdynamischen Erzeugungseinheiten, die ihre Leistungsabgabe im Gegensatz zu konventionellen thermischen Kraftwerken sehr schnell an die momentane Last anpassen können, sind Alternativen zum schnellen Ausgleich zwischen Stromerzeugung und ‐verbrauch vor allem Lastmanagementsysteme und zuschaltbare Lasten, insbesondere Wärmeerzeuger (Power‐to‐Heat). Elektrochemische Energiespeicher stehen dabei auch in technischer und wirtschaftlicher Konkurrenz zu anderen Energiespeichertechnologien, siehe dazu [1].
Abb. 1.1 Elektrochemische Energiespeicher als Teil des Stromversorgungssystems.
1.2 Elektrochemische und nicht‐elektrochemische Energiespeichertechnologien
Grundsätzlich kann Energie auf sehr unterschiedliche Arten gespeichert werden, d. h. in unterschiedlichen Formen von Energien, nämlich
mechanisch, etwa in Form von potenzieller Energie in Pumpspeicherkraftwerken oder in Form von Rotationsenergie bei Schwungrädern,
magnetisch, etwa in Form von supraleitenden Spulen,
elektrisch, etwa in Form von Doppelschichtkondensatoren,
chemisch, etwa durch Speicherung in Form von Wasserstoff,
thermisch, etwa in Form von Warmwasserspeichern oder in Dampfkesseln,
elektrochemisch, d. h. durch Umwandlung elektrischer Energie in chemische Energie.
Die Tab. 1.1 fasst diese Technologien und die grundlegenden physikalischen Formeln für Sie zusammen.
Bei einigen Energiespeichertechnologien, insbesondere thermischen Speichern, kann die gespeicherte Energie nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand wieder als elektrische Energie dem Gesamtsystem zur Verfügung gestellt werden. Trotz dieser Einschränkung konkurrieren die verschiedenen Energiespeicher bei bestimmten Anwendungen. Strom aus einer Fotovoltaikanlage eines Einfamilienhauses, der nicht unmittelbar verbraucht wird, kann z. B. in einer Batterie gespeichert, über eine elektrisch betriebene Heizpatrone als thermische Energie für die Raumheizung oder Warmwasserversorgung verwendet, durch angebotsabhängiges Zuschalten von Haushaltslasten wie Waschmaschinen oder Kühlschränke genutzt oder in das elektrische Netz für andere Haushalte zur Verfügung gestellt werden. Aus Systemsicht sind diese Alternativen gleichwertig, sodass häufig von speicheräquivalenten Systemen oder funktionalen Speichern gesprochen wird. Bevor in den folgenden Kapiteln elektrochemische Energiespeicher ausführlich besprochen werden, hier einige Kommentare zu nicht‐elektrochemischen Energiespeichern.
Tab. 1.1 Verschiedene Energiespeichertechnologien im Vergleich.
Energieart
Prinzip
Beispiele
Potenzielle Energie
E
=
mg
Δ
h
Pumpspeicherkraftwerke
Druckenergie
E
=
p
Δ
V
Druckluftspeicher
Rotationsenergie
E
= 0,5
Jω
2
Schwungräder
Magnetische Energie
E
= 0,5
LI
2
Verlustfrei fließender Gleichstrom in einer supraleitenden Spule (sog. SMES)
Elektrische Energie
E
= 0,5
CU
2
Doppelschichtkondensatoren (Ultrakondensatoren, Elektrolytkondensatoren etc.)
Chemische Energie
E
=
n
Δ
r
G
Wasserstoffspeicher
Thermische Energie
E
=
Ci
Δ
T
Warmwasserspeicher
Elektrochemische Energie
E
= ∫
UI
dt
Batterien
a) Erklärung der Symbole: m: Masse, g: Erdbeschleunigung, h: Höhe, p: Druck, V: Volumen, J: Trägheitsmoment, ω: Drehgeschwindigkeit, L: Induktivität, I: Stromstärke, C: Kapazität (in Farad), U: Spannung, n: Stoffmenge, ΔrG: freie Reaktionsenthalpie, Ci: Wärmekapazität des Stoffes i, ΔT: Temperaturdifferenz, t: Entladungszeit.
Kondensatoren und Ultrakondensatoren
Der Energieinhalt von Kondensatoren ist sehr gering, das gilt selbst für die Gruppe der sog. Ultrakondensatoren oder Superkondensatoren3) (Ultracaps) mit sehr hohen Kapazitäten (Einheit: 1 F = 1 Farad). Bei einer Nennspannung von 2,5 V und z. B. einer Kapazität von 3000 F beträgt der Energieinhalt nur ca. 2,6 Wh, wovon normalerweise nur 75 % technisch entnommen werden können, im Vergleich zu ca. 9 Wh für eine kleine 2,5 Ah Lithium‐Ionen‐Zelle, die deutlich kompakter, leichter und preisgünstiger ist. Bezogen auf die spezifische Leistung (W/kg) können Ultrakondensatoren aber eine deutlich höhere elektrische Leistung abgeben und werden deshalb in besonderen Anwendungsnischen genutzt.
Ultrakondensatoren haben eine hohe Selbstentladung (sie sind oft innerhalb 24 h komplett entladen) und somit einen hohen Energieverlust im Stand‐by‐Betrieb. Sie benötigen eine ähnlich aufwendige Ladekontrolle wie Lithium‐Ionen‐Batterien.
Als Vorteil von Ultrakondensatoren wird ihre sehr hohe Zyklisierbarkeit genannt.
Andere Kondensatortypen wie die klassischen Elektrolytkondensatoren haben eine Kapazität nur im Bereich von Mikro‐ bzw. Millifarad und weniger und sind daher nicht in der Lage, größere Energiemengen zu speichern, auch wenn ihre Nennspannung sehr hoch ist.
Supraleitende Spulen
Das im Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule vorhandene Magnetfeld speichert nutzbare Energiemengen bei hohem Strom. Nur wenn durch Supraleitung der Widerstand der Spule minimiert wird, sind die Verluste ausreichend gering. Energiespeicher auf Basis der Supraleitung erfordern aber eine aufwendige Kühlung und haben deshalb hohe Stand‐by‐Verluste. In den 90er‐Jahren des 20. Jahrhunderts wurden zur Stabilisierung des Stromnetzes supraleitende magnetische Energiespeicher (SMES) gebaut mit einer Leistung im Bereich von 1 MW für 10 s und einem Energieinhalt von einigen Kilowattstunden.
Schwungräder
Der in Schwungrädern gespeicherte Energieinhalt hängt quadratisch von der Drehzahl ab und ist proportional zum Trägheitsmoment. Langsam drehende Schwungräder (mit bis zu ca. 4000 Umdrehungen/min) sind kommerzielle Produkte für den Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgungen mit einer Leistung von z. B. 1,6 MW für 15 s (Powerbridge, Fa. Piller), entsprechend 6,7 kWh Energieinhalt, von dem jedoch nur 75 % technisch entnommen werden können. Diese Schwungräder sind eine technische und wirtschaftliche Alternative zu Batterien für Überbrückungszeiten von wenigen Sekunden bis zum Start von motorischen Stromerzeugungsaggregaten.
Sehr schnell drehende Schwungräder (bis zu 100 000 Umdrehungen/min) sind leicht und sehr leistungsstark, wobei die Leistung eine Funktion des damit gekoppelten Generators ist. Anwendung gibt es zurzeit im Rennsport.
Alle Schwungräder sind durch sehr hohe Selbstentladung gekennzeichnet, auch bei Nutzung von Vakuum und Magnetlagern zur Minimierung der Reibung. Nach ca. 24 h ist die gespeicherte Energie i. d. R. verloren. Die Nutzung in Fahrzeugen als Ersatz für Starterbatterien ist somit nicht möglich.
Druckluft‐ und Pumpwasserspeicher
Existierende Systeme haben Energieinhalte von ca. 100 bis 10 000 MWh und sind relevante Energiespeicher in der Elektrizitätswirtschaft. Sehr große Batteriespeicher mit Energieinhalten im Bereich von einigen Hundert Megawattstunden, die zurzeit in einigen Regionen gebaut werden, könnten perspektivisch technische Alternativen dazu werden; generell lassen sich sehr große Energiemengen allerdings nur schlecht in Batterien aufgrund des vergleichsweise hohen Platzbedarfs speichern.
1.3 Grundlegende Eigenschaften von Batterien, Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Batterien sind elektrochemische Energiewandler. Die Grundlagen der allermeisten Batterietechnologien basieren auf ähnlichen physikalischen und chemischen Grundlagen. Auch die grundsätzlichen Anforderungen an den Aufbau und den Betrieb sind sehr ähnlich.
Batterien sind Gleichspannungsquellen, deren Spannung eine Funktion der verwendeten Materialien und ihrer lokalen Konzentrationen sowie des durch sie fließenden Stroms ist. In den meisten Fällen ist es notwendig, Einzelzellen in Reihe zu schalten und mittels Umrichtern (DC/DC‐ oder DC/AC‐Wandlern) in ein Energieversorgungssystem einzubinden und/oder einen großen Bereich für die Eingangsspannung der angeschlossenen Lasten vorzusehen. Die maximale Ladespannung beträgt oft ca. das 1,5‐fache der minimalen Entladespannung, bei manchen Batterietechnologien und Anwendungen auch noch mehr.
Es gibt sehr viele unterschiedliche Batterietechnologien, die sich abgesehen von ihrer Spannungslage in vielen weiteren Eigenschaften unterscheiden. Abbildung 1.2 zeigt eine Übersicht über das Funktionsprinzip und unterschiedliche Batteriesysteme.
Abb. 1.2 Übersicht über das Funktionsprinzip von Batterien und verschiedene Materialien. Details s. Kap. 14.
In allen Fällen erfolgt eine direkte Umwandlung chemischer Energie in elektrische Energie. Nur bei Akkumulatoren, d. h. wiederaufladbaren galvanischen Sekundärelementen, ist eine leichte und häufig wiederholbare erneute Rückumwandlung elektrischer in chemische Energie (und umgekehrt) möglich. Alle derartigen Systeme werden im Folgenden als Batterien bezeichnet.
Eine wichtige Unterteilung aller Batterien betrifft Systeme, bei denen das Aktivmaterial fester Bestandteil der Elektroden ist und damit Energieinhalt (Wh) und Leistung (W) konstruktiv gekoppelte Größen sind, und Systeme, bei denen die Aktivmassen extern in Tanks aufbewahrt werden und in den Elektrodenbereich gepumpt werden, sog. Flussbatterien oder Redox‐Flow‐Batterien. Bei diesen kann der Energieinhalt mittels großer Tanks beliebig vergrößert werden, ohne die Leistung, die durch den Reaktionsraum gegeben ist, zu erhöhen. Flussbatterien verwandt sind Brennstoffzellen, bei denen eine der Aktivmassen (Wasserstoff) aus einem Behälter zugeführt wird und die andere Aktivmasse (Sauerstoff) der Luft entnommen wird. Auch bei Metall‐Luft‐Systemen gibt es eine gewisse Verwandtschaft zu Flusssystemen und Brennstoffzellen, nur dass hierbei eine der Aktivmassen (das Metall) in fester Form vorliegt (und ggf. durch mechanischen Austausch erneuert werden kann), während der Sauerstoff wieder – ggf. unter Vorschaltung einer Reinigungsstufe – der Luft entnommen wird.
Batterietechnologien unterscheiden sich bzgl. des Innenwiderstands, des Energieinhalts, der auf das Gewicht bezogenen spezifischen Energie (Wh/kg) und der auf das Volumen bezogenen Energiedichte (Wh/l), der spezifischen Leistung (W/kg), der Leistungsdichte (W/l), des zulässigen Temperaturbereichs, der Möglichkeiten zur Überwachung des Batteriesystems, der kalendarischen und zyklischen Lebensdauer und der zum sicheren und wirtschaftlichen Betrieb unbedingt erforderlichen Systemkomponenten und ihren Einsatzbedingungen. Konstruktive und materialspezifische Veränderungen führen auch innerhalb einer Batterietechnologie zu erheblichen Eigenschaftsunterschieden.
Die meisten in Batterien verwendeten Materialien sind toxisch und/oder korrosiv. Werden Umweltbelastungen während der Produktion, Nutzung und Entsorgung sowie Investitionskosten und die Gesamtkosten des Betriebs mitberücksichtigt, so erweitert sich das für die Wahl eines Batteriesystems zu betrachtende Eigenschaftsspektrum beträchtlich. Die Dominanz von Blei‐Säure‐ und Lithium‐Ionen‐Batterien ist auf günstige Gesamteigenschaften für viele unterschiedliche Anwendungen zurückzuführen.
1.4 Überbrückungszeit
Eine häufige Einteilung von Batterien orientiert sich an der Überbrückungszeit, dem Verhältnis von Energieinhalt zu der Leistung, die konstant aus einer Batterie bis zur Entladeschlussspannung entnommen werden kann. Bei allen Batterien nimmt der entnehmbare Energieinhalt mit zunehmender Leistung ab. Die Darstellung der charakteristischen Kurve des spezifischem Energieinhalts (kWh/kg) bei verschiedenen spezifischen Leistungen (kW/kg) wird als Ragone‐Diagramm bezeichnet. Abbildung 1.3 ist ein auf Datenblattangaben beruhendes Ragone‐Diagramm für verschiedene Batterietechnologien, siehe [3] für Details der Berechnung.
Abb. 1.3 Ragone‐Diagramm verschiedener Batterietechnologien auf Basis von Datenblattangaben (Wenzl, H. 2009/Elsevier).
Abb. 1.4 Vergleich von Energiespeichersystemen auf Grundlage der jeweiligen Überbrückungszeit.
Für detailliertere Auslegungen und zur technisch‐wirtschaftlich optimalen Nutzung von Batterien wurde in [2] ein Verfahren vorgeschlagen, ein Ragone‐Diagramm auf Basis von Messungen von Entladekurven unterschiedlicher Leistung zu erstellen. Mittels des in [2] beschriebenen Verfahrens ergeben sich Abweichungen von den im Abb. 1.3 gezeigten Diagramm. Für Auslegungen von Batteriesystemen können diese bedeutsam sein.
Abbildung 1.4 zeigt eine andere Darstellung von Leistung und Energieinhalt. Die häufige Einteilung von Speichern in Kurzzeit‐ und Langzeitspeichern wird dadurch besonders klar. Die Geraden in der Abbildung stellen gleiche Überbrückungszeiten unabhängig vom Energieinhalt des betrachteten Energiespeichers dar. Überbrückungszeiten von wenigen Sekunden sind Anwendungen im Bereich der Versorgungsqualität zur Spannungsstützung des Stromnetzes bei Kurzunterbrechungen. Überbrückungszeiten von 15 min bis wenigen Stunden sind Anwendungen für die Sicherstellung der Stromversorgung bei Netzausfall (Notbeleuchtungsanlagen, unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen [USV‐Anlagen] für Rechner und Telekommunikationseinrichtungen etc.). Im Bereich erneuerbarer Energien werden Überbrückungszeiten von ca. einem Tag bis zu mehreren Tagen benötigt, je nach Systemauslegung, und für einen saisonalen Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch (Energiesysteme basierend überwiegend auf Wasserkraft, Windkraft oder Fotovoltaik) wäre eine Überbrückungszeit von mehreren Monaten erforderlich. In Aufg. 1.1 werden Überlegungen dargestellt, wie groß Stromspeicher für die Bundesrepublik Deutschland ausgelegt sein müssten, wenn das bundesdeutsche Stromerzeugungssystem ausschließlich auf Windkraft‐ und Fotovoltaikanlagen ausgelegt werden sollte.
Bei Batterien und vielen anderen Energiespeichertechnologien steht das Verhältnis von Energieinhalt und Leistung in einem bestimmten technisch und wirtschaftlich bedingten Verhältnis. Bei stofflich gespeicherter Energie kann dagegen Leistung und Energieinhalt in weiten Grenzen unabhängig festgelegt werden. Zum besseren Verständnis ist in Abb. 1.4 der Energieinhalt von 100 l Dieseltreibstoff dargestellt. Da es hier keine technische Kopplung zwischen Energieinhalt (proportional zur Größe der Tanks) und Leistung (Dimensionierung der Motoren) gibt, erstreckt sich der zugehörige Leistungsbereich über mehrere Größenordnungen und der Begriff Überbrückungszeit ist ohne weitere Angaben nicht mehr anwendbar.
Die eingezeichneten Punkte stellen verschiedene ausgeführte Energiespeicher dar und zeigen, dass die markierten Bereiche nur als Orientierungshilfe zu verstehen sind.
Abbildung 1.4 zeigt, dass für eine konkrete Anwendung (Überbrückungszeit und Leistung) nur jeweils wenige Energiespeichersysteme infrage kommen.
1.5 Vergleich von Batterietechnologien
Bei Vergleichen unterschiedlicher Batterietechnologien ist es notwendig, die konkrete Anwendung zu kennen, damit die in einem Vergleich dargestellten Daten auch für die Auswahl der am besten geeigneten Speichertechnologie genutzt werden können. Die folgende Liste gibt eine Übersicht über die wichtigsten Punkte, die zu beachten sind:
Definition des Systemumfeldes:
Energiespeicher benötigen unterschiedliche Zusatzkomponenten, um einen sicheren, zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb gewährleisten zu können. Beim Vergleich von großen Blei‐ und Lithium‐Ionen‐Batterien ist der Vergleich von Zellen häufig nur von geringer Bedeutung, weil bei einem Gesamtsystem Lithium‐Ionen‐Batterien aus Sicherheitsgründen mit diversen Überwachungs‐ und Schutzeinrichtungen versehen werden müssen, die bei Blei‐Säure‐Batterien nicht erforderlich sind. Alle Sicherheits‐ und Überwachungseinrichtungen, die für einen sicheren und langlebigen Betrieb notwendig sind, müssen eingeschlossen werden. Der Vergleich von Systemen mit unterschiedlichen Sicherheitsstandards und zu erwartender Lebensdauer ist nur bei sorgfältiger technischer und wirtschaftlicher Bewertung der Unterschiede aussagekräftig.
Beim Vergleich von Gesamtsystemen muss auf die Äquivalenz der Systeme geachtet werden (siehe Aufg. 1.2).
Kosten:
Es müssen die Kosten des Gesamtsystems bei vergleichbarer Systemabgrenzung betrachtet werden.
Energieinhalt:
Es darf nur der im Betrieb tatsächlich nutzbare Energieinhalt betrachtet werden, mit dem die angestrebte Lebensdauer auch tatsächlich erreicht werden kann. Bei vielen Batteriesystemen muss aus Betriebs‐ und/oder Lebensdauergründen der entnehmbare Energieinhalt im Vergleich zum Energieinhalt der vollgeladenen Batterie deutlich begrenzt werden.
Volumen und Gewicht:
Es muss das Gesamtsystem betrachtet werden.
Weitere technisch relevante Eigenschaften:
Reaktionszeit auf Leistungsanforderungen,
Temperaturbereich, innerhalb dessen das System betrieben werden kann,
Zusatzheizungen oder Kühlungen im System müssen berücksichtigt werden, weil sie Gewicht, Volumen und Kosten beeinflussen,
Wartungs‐ und Überwachungsmöglichkeiten.
Weitere wirtschaftlich relevante Eigenschaften:
Wartungsaufwand über die Lebensdauer,
Energieverbrauch im Stillstand und bei der Nutzung,
Wirkungsgrad.
Allgemeine Vergleiche von Energiespeichern, so wie in Abb. 1.4 dargestellt oder wie sie in vielen Studien in tabellarischer Form gezeigt werden, können nur zur Orientierung dienen. Detailvergleiche ohne Beschreibung der konkreten Anwendung ermöglichen oft keine verwertbaren Aussagen. Bei Beschreibung der Anwendungen und der zu berücksichtigenden Nebenbedingungen verringert sich die Zahl geeigneter Energiespeichertechnologien oft erheblich oder es gibt aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nur eine Energiespeichertechnologie, die für die betrachtete Anwendung infrage kommt. Pumpspeicherwerke konkurrieren nicht mit Schwungmassenspeichern!
1.6 Anwendungen und Einordnung von Batterien in Gesamtsysteme
Batterien sind üblicherweise parallel mit Erzeugungsanlagen und Verbrauchern gekoppelt. Diese Anordnung führt in vielen Fällen zu einer hochdynamischen Strombelastung der Batterie mit einem häufigen Wechsel zwischen Lade‐ und Entladeströmen. Dieses Verhalten ist bei Hybridfahrzeugen, deren Batterie ständig zwischen der Aufnahme von Bremsenergie und der Abgabe von Energie zur Unterstützung der Beschleunigung wechselt, unmittelbar klar. Aber auch Batterien für autonome Stromversorgungssysteme oder im Bereitschaftsparallelbetrieb unterliegen häufig einem schnellen Wechsel von Lade‐ zu Entladeströmen bedingt durch die Restwelligkeit und die Regelcharakteristik der Ladegeräte und Verbraucher. Messungen zeigen oft eine Überlagerung des Batteriestroms mit einem Wechselstrom, dessen Amplitude den Wert des Gleichstromanteils deutlich überschreiten kann. Ab Kap. 15 wird in der Übersicht der Anwendungen elektrochemischer Energiespeicher darauf ausführlicher eingegangen.
Häufig ist eine Unterscheidung in portable, mobile und stationäre Anwendungen sinnvoll, wobei bei stationären Anwendungen eine Unterscheidung zwischen netzgekoppelten und autonomen Energieversorgungssystemen hilfreich ist.
Mobile Anwendungen:
Bei Traktionsanwendungen wird die Batterie in einigen Anwendungen, z. B. Flurförderzeuge und Elektrofahrzeuge, während der Nutzung, nur unterbrochen von gelegentlichen Rückspeisevorgängen beim Bremsen etc., entladen, und danach in einem zeitlich getrennten Schritt wieder aufgeladen.
Bei Hybridfahrzeugen gibt es jedoch eine eigene Stromerzeugungseinheit (Verbrennungsmotor etc.) als Teil des mobilen Gesamtsystems, die die Batterie auch während der Nutzung aufladen kann. Der Batteriestrom und Ladezustand schwanken in Abhängigkeit von den Einsatzstrategien stark.
Bei mobilen Anwendungen außerhalb des Traktionsbereichs dient die Batterie oft nur zum von anderen Energiequellen unabhängigen Eigenstart (sog. Schwarzstart) des Gesamtsystems (Spannungsversorgung für die Motor‐ und Bordnetzelektronik, Starten des Verbrennungsmotors) und zur Stabilisierung des Bordnetzes.
Die Anforderungen an Energieinhalt, Gewicht und viele andere Eigenschaften unterscheiden sich sehr stark zwischen diesen Anwendungsgebieten.
Stationäre Anwendungen:
Bei autonomen, nicht netzgekoppelten Energiesystemen dient die Batterie als alleinige Energiequelle, wenn die primäre Energieerzeugung nicht zur Verfügung steht (kein Wind, keine Sonneneinstrahlung, Motor des Stromgenerators nicht in Betrieb), und zur Aufnahme von elektrischer Energie, wenn die Erzeugung den Verbrauch überschreitet. Es ist von einem ständigen Wechsel zwischen Lade‐ und Entladevorgängen auszugehen.
In netzgekoppelten Gesamtsystemen dient die Batterie meistens zur Sicherung der Stromversorgung bei Netzausfällen und Spannungsproblemen (Netzersatzanlagen, USV‐Anlagen) sowie zur Bereitstellung und Aufnahme von Leistungsschwankungen zur Stabilisierung des Stromnetzes. Mit zunehmender Stromerzeugung von Windkraft‐ und Fotovoltaikanlagen werden Energiespeicher auch genutzt, um Strom aus erneuerbaren Energien zwischenzuspeichern.
Portable Anwendungen:
Die Batterien in einem Gerät sind darauf ausgelegt, während der Nutzung nur entladen und danach an einem Ladegerät wieder aufgeladen zu werden. Die Nutzung während der Ladung ist eher eine Ausnahme. Offensichtliche Kriterien sind ein geringes Volumen und Gewicht.
Literatur
1
Energieforschungszentrum Niedersachsen(2016).
Potenziale elektrochemischer Speicher in elektrischen Netzen in Konkurrenz zu alternativen Technologien und Systemlösungen (ESPEN, Abschlussbericht)
.Goslar: EFZN.
2
Sarpal, I.,Bensmann, A.,Mähliß, J.,Hennefeld, D. undHanke‐Rauschenbach, R.(2018). Characterisation of batteries with
E
‐
P
curves: Quantifying the impact of operating conditions on battery performance.
International Journal of Electrical Power & Energy Systems
99: 722–732.
3
Wenzl, H.(2009). Power. In:
Encyclopedia of Electrochemical Power Sources
, (Hrsg. J. Garche), Bd. I, 559–565.,Amsterdam: Elsevier.
Aufgaben
Aufgabe 1.1 Auslegung von Stromspeichern bei ausschließlicher Stromerzeugung aus Fotovoltaik‐ und Windkraftanlagen
Der Stromverbrauch der Bundesrepublik Deutschland beträgt ca. 500 TWh pro Jahr. Mit dem Begriff Dunkelflaute werden Zeiten bezeichnet, bei denen es so gut wie keine Stromproduktion aus Windkraft‐ und Fotovoltaikanlagen gibt. Die maximale Dauer einer Dunkelflaute wird üblicherweise mit 21 Tagen angegeben.
Nehmen Sie an, dass die tägliche Erzeugungsleistung auch während einer Dunkelflaute 10 GW beträgt (Wasserkraft, Kraft‐Wärme‐Kopplungsanlagen, die wegen des Wärmebedarfs betrieben werden müssen, Sondermüllverbrennungsanlagen u. ä.).
Welche Energiemengen müssen in Stromspeichern vorgehalten werden?
Können Sie davon ausgehen, dass die Stromspeicher zu Beginn der Dunkelflaute vollgeladen sind? Welche Energiemengen sollten am Ende der Dunkelflaute noch in den Stromspeichern vorhanden sein, damit bei einer unmittelbar folgenden Unterdeckung des Strombedarfs durch die Erzeugungseinheiten die Versorgung gesichert bleibt?
Welche Sicherheitsmargen für die Dauer der Dunkelflaute nehmen Sie an (maximal zu erwartende Dauer in den kommenden Jahrzehnten)? Welcher Prozentsatz der installierten Stromspeicher wird über den betrachteten Zeitraum gar nicht oder nur einmal benutzt?
Welche Industrien oder Haushaltsgruppen werden als erste abgeschaltet, wenn die Speicher nicht ausreichend groß ausgelegt wurden?
Aufgabe 1.2 Systemvergleich von Antriebssträngen
Aufgabe Systemvergleich von Antriebssträngen Der Antriebsstrang eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs besteht aus einer Fahrzeugbatterie inkl. aller erforderlichen Komponenten wie Batteriemanagementsystem (BMS), Sicherungen etc., einem Elektromotor, ggf. mit einfachem zweistufigem Getriebe und Differenzial, Kabel und Umrichter. Der Antriebsstrang eines verbrennungsmotorisch betriebenen Fahrzeugs besteht aus einem Tank, Treibstoffleitungen und Förderpumpe, Anlasser, Lichtmaschine, Verbrennungsmotor, Kühler mit Gebläse und Wasserpumpe, mehrstufiges Getriebe, Kupplung, Differenzial, Abgassystem mit Abgasreinigung.
Schätzen Sie für vergleichbare Fahrzeuge (z. B. Tesla Model S und BMW 5er‐Reihe) für die gleiche Reichweite und Motorleistung das Gesamtgewicht der beiden Antriebsstränge ab. Verwenden Sie dafür 75 % der angegebenen Reichweite des angegebenen Fahrzeugs von Tesla und Gewichtsangaben aus dem Internet.
Ist dieser Vergleich zulässig? Welche Schlüsse können daraus gezogen werden und welche nicht?
Notes
1)
Die Wortwahl Energieerzeugung und Energieverbrauch entspricht dem allgemeinen Sprachgebrauch und wird deshalb hier verwendet. Im Wortsinn kann Energie natürlich nicht erzeugt und verbraucht, sondern nur umgewandelt werden.
2)
In
Abb. 1.1
ist zu beachten, dass stoffliche Speicher (Tanks für aufbereitete Energieträger) nur dann als Energiespeicher bezeichnet werden, wenn sie mittels Strom produziert werden, der nicht direkt für Energiedienstleistungen verwendet wird. Ohne diese begriffliche Differenzierung müssen sonst auch Rohöl‐, Heizöl‐ oder Benzintanks und unterirdische Salzkavernen für fossile Energieträger als Energiespeicher bezeichnet werden.
3)
In diesem Lehrbuch wird für diese Klasse von Energiespeichern immer der Begriff Ultra‐ oder Superkondensatoren verwendet und nicht der Begriff Doppelschichtkondensator, um eine klare Abgrenzung zu den für Batterien zentralen Begriffen „Doppelschicht“ und „Doppelschichtkondensator“ als Bezeichnung der Elektroden/Elektrolytgrenzfläche sicherzustellen.
2Elektrochemische Grundlagen
In diesem Kapitel werden die grundsätzlichen Prozesse, die in Batterien ablaufen, anhand von Beispielen aus dem Bereich Blei‐Säure‐ und Lithium‐Ionen‐Batterien erläutert. Die Herleitung und detaillierte Behandlung der elektrochemischen Grundlagen erfolgen dabei nur soweit, wie sie für das Verständnis von Batterien erforderlich erscheinen. Für weiterführende Darstellungen wird auf entsprechende Lehrbücher verwiesen, z. B. [1, 6, 9].
Batterien sind elektrochemische Systeme mit folgenden grundlegenden elektrochemischen Prinzipien:
Sobald ein elektronenleitendes Material in Kontakt mit einem Elektrolyt (also einem ionenleitenden Material) kommt, finden an der Grenzfläche eine oder mehrere Reaktionen statt, die zu einer Ladungsträgerseparation führen. Im elektronenleitenden Material verbleiben Elektronen ohne Gegenladungen, und im Elektrolyt verbleiben Ionen ohne das entsprechende Gegenion (Anode) oder umgekehrt, im Material fehlen Elektronen und im Elektrolyt fehlen Ionen (Kathode). Die Grenzfläche bildet einen Kondensator (Doppelschichtkondensator). Es entsteht unmittelbar eine Spannung. Batterien sind deshalb nie spannungslos und können auch nicht spannungsfrei geschaltet werden.
Die Spannung, die durch die Reaktion an der Grenzfläche gebildet wird, ist von den beteiligten Materialien sowie von den Eigenschaften des Elektrolyts abhängig. Die Spannungslage kann über die freie Enthalpie (Gibbs‐Enthalpie) der Reaktion berechnet werden und mittels der Nernst‐Gleichung in die Konzentrationsaktivitäten der Reaktanten umgerechnet werden (Nernst‐Spannung, Gleichgewichtsspannung). Die durch die Reaktion erzeugte Spannung kann in einem Ersatzschaltbild als Spannungsquelle modelliert werden.
Wenn gleichzeitig verschiedene elektrochemische Reaktionen an der Elektrodengrenzfläche ablaufen können, dann hat jede der Reaktionen ihre spezifische Nernst‐Spannung. Die Spannungslagen der Elektroden bzw. der Zelle verändern sich dann. Es liegt ein Mischpotenzial vor und es können auch bei unbelasteter Zelle Selbstentladeeffekte und Korrosion auftreten.
Wenn Strom durch die Batterie fließt, dann finden elektrochemische Reaktionen statt, deren Reaktionsgeschwindigkeiten direkt proportional zum Strom sind (faradaysches Gesetz). Eine Ladungsmenge von 96.480 As entspricht der Umwandlung von 1 mol des elektrochemisch aktiven Materials einer Elektrode, wenn die Reaktion nur ein Elektron überträgt.
Durch den Stromfluss wird die Spannung der Batterie verändert. Die durch die Reaktion verursachte Spannungsdifferenz wird als Ladungsträgerdurchtrittsspannung
η
T
bezeichnet und kann als elektrischer Widerstand mit einer sehr großen Stromabhängigkeit verstanden werden. Der Spannungsabfall kann mittels der BV‐Gleichung berechnet werden. Bei geringem Strom ist die Ladungsträgerdurchtrittsspannung die dominierende Spannungsabweichung von der Ruhespannung der Elektroden, bei sehr großen Strömen tritt dieser Spannungsabfall hinter den Spannungsabfall in den elektrisch leitenden Komponenten der Zelle (ohmscher Spannungsabfall
η
Ω
) und Restriktionen beim Massentransport, der Diffusionsüberspannung
η
D
, zurück.
Die Ladungsträgerdurchtrittsspannung bzw. den zugehörigen Widerstand kann man elektrisch als Innenwiderstand der durch die jeweilige Reaktion gebildeten Spannungsquelle verstehen.
Strom kann nur fließen, wenn positive (Kathode) und negative Elektrode (Anode) miteinander verbunden werden. Abgesehen davon sind die beiden Elektroden unabhängig voneinander.
2.1 Elektrochemische Grundbegriffe
2.1.1 Einige Definitionen
Im strengen Sinne ist eine Elektrode der Ort des Kontakts eines Elektronenleiters oder Halbleiters mit einem Ionenleiter. In der Praxis sind mit Elektroden1) zumeist die metallischen oder zumindest halbleitenden Feststoffe gemeint, an denen der Strom abgeleitet wird.
Ein Elektrolyt ist hingegen im strengen Sinne eine chemische Verbindung, die im festen, flüssigen oder gelösten Zustand in Ionen dissoziiert ist. In der Praxis spricht man zumeist von der gesamten Lösung als Elektrolyt.2)
Eine Halbzelle ergibt sich aus dem Zusammenbringen von Elektrode und Elektrolyt.
Eine (elektrochemische) Zelle entsteht durch eine ionenleitende Verbindung zweier Halbzellen, meist unter Nutzung eines Separators.
Die Anode ist der Ort der Oxidation. Bei wiederaufladbaren Batterien wird dabei immer die Entladereaktion betrachtet. Elektrisch ist die Anode der Minuspol einer Zelle.
Die Kathode ist der Ort der Reduktion. Bei wiederaufladbaren Batterien wird dabei immer die Entladereaktion betrachtet. Elektrisch ist die Kathode der Pluspol.
Ein Separator trennt den Elektrolytraum von Anode (Anolyt) und Kathode (Katholyt), erlaubt aber die Ionenleitung zwischen den Elektroden.
Eine Batterie ist der Oberbegriff für eine einzelne Zelle oder einen Zellverbund aus mehreren, elektrisch parallel und/oder in Reihe geschalteten Zellen.
Eine Primärzelle ist eine Zelle, die nur einmalig bei ihrer Entladung elektrische Energie abgeben kann.
Ein Akkumulator (auch Sekundärzelle genannt) ist eine Batterie, die entladen und danach wieder aufgeladen werden kann, um dann erneut für eine Entladung bereitzustehen. Typische Akkumulatoren erlauben viele Hunderte solcher Lade‐ und Entladezyklen.
Eine Flusszelle, meist Redox‐Flow‐Zelle genannt, ist eine Zelle, bei der die elektrochemisch aktiven Reaktanten als Bestandteil des Elektrolyts im Anodenraum (Anolyt) und Kathodenraum (Katholyt) zirkulieren, und nach oder während der Entladung in einen Vorratstank gepumpt werden. Die Wiederaufladung der Elektrolyte erfolgt üblicherweise auch im Anoden‐ bzw. Kathodenraum.
Bei einer Brennstoffzelle werden kontinuierlich Gase (meist einerseits Wasserstoff und andererseits Sauerstoff bzw. Luft) zugeführt und die Reaktionsprodukte (meist Wasser bzw. Wasserdampf) abgeführt. Brennstoffzellen sind konzeptionell mit Flussbatterien verwandt, können aber nicht geladen werden und sind somit keine Energiespeicher.
Die Kapazität (engl. capacity, Einheit meist Ah für Amperestunde) einer Batterie ist batterietechnisch die Ladungsmenge, die sie bei der Entladung unter genau festgesetzten Bedingungen freisetzt. Man beachte, dass diese keine Kapazität im physikalischen Sinne (engl. capacitance, Einheit Farad F = As/V) ist.
2.1.2 Spannung und Ladungsträgerverteilung
Eine Spannung entsteht durch eine inhomogene Verteilung von Ladungsträgern. Aus den maxwellschen Grundgleichungen der Elektrodynamik lässt sich herleiten, dass aus einer Ladungsträgerverteilung das elektrische Feld berechnet werden kann:
wobei die räumliche Ladungsträgerverteilung positiver und negativer Ladungen ist, das Integral über den gesamten Raum erfolgt und k eine Proportionalitätskonstante ist.
Die Potenzialdifferenz zwischen zwei