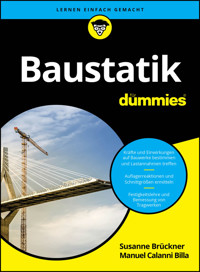
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
So bauen Sie solides Wissen auf
Tun Sie sich mit der Baustatik schwer, aber der Schein muss eben sein? Dann hilft Ihnen dieses Buch. Die erfahrenen Dozenten Susanne Brückner und Manuel Calanni Billa erklären Ihnen, was Sie über Baustatik wissen sollten. Sie lernen, wie Sie Lastenannahmen treffen, Auflagerkräfte und Schnittgrößen berechnen, Spannungen ermitteln, einfache Biegeträger zu bemessen und vieles mehr. Mit vielen Beispielen erläutern die Autoren so verständlich wie möglich auch kompliziertere Inhalte und so ist dieses Buch Ihr freundlicher Begleiter durch Ihre Baustatik-Veranstaltung.
Sie erfahren
- Welche Begriffe Sie unbedingt kennen müssen
- Was es mit Gleichgewichtsbedingungen auf sich hat
- Wie Sie Auflagerkräfte, Schnittgrößen und Spannungen ermitteln
- Was Sie über Widerstände von Bauteilen wissen sollten
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Baustatik für Dummies
Schummelseite
ZERLEGEN EINER SCHRÄGEN KRAFT F
RESULTIERENDE
Die Resultierende R ist die eine Kraft, welche die Einzellasten in
GrößeWirkungsrichtung undAngriffspunktMOMENTENSATZ
MOMENT
Der Hebelarm ist immer der kürzeste Abstand zwischen Drehpunkt und Wirkungslinie der Kraft.
Fachwerke
BILDUNGSGESETZE
An einem Einzelstab werden zwei weitere Fachwerkstäbe gelenkig angeschlossen, sodass ein »unverschiebliches Dreieck« (= Fachwerkdreieck) entsteht.Zwei unverschiebliche Fachwerke können mit drei weiteren Stäben miteinander verbunden werden. Werden zwei unverschiebliche Fachwerke an einem Knotenpunkt miteinander verbunden, wird nur noch ein zusätzlicher Stab benötigt.Bei einem unverschieblichen Fachwerk nach den ersten beiden Bildungsgesetzen dürfen Stäbe entnommen und an einer anderen Stelle wieder eingesetzt werdenSTATISCHE BESTIMMTHEIT
a = Anzahl der Auflagerreaktionen
s = Anzahl der Fachwerkstäbe
k = Anzahl der Knotenpunkte
n = 0 ⇒ Fachwerk ist statisch bestimmt
n > 0 ⇒ Fachwerk ist statisch unbestimmt
n < 0 ⇒ Fachwerk ist statisch unterbestimmt (= kinematisch, instabil)
NULLSTABREGELN
Sind an einem unbelasteten Knoten zwei Fachwerkstäbe angeschlossen, die nicht in gleicher Richtung wirken (also keine Gerade bilden), so sind beide Stäbe Nullstäbe.Sind an einem belasteten Knoten zwei Fachwerkstäbe angeschlossen, die nicht in gleicher Richtung wirken und greift die äußere Kraft in Richtung eines Stabes an, so ist der andere Stab ein Nullstab.Sind an einem unbelasteten Knoten drei Fachwerkstäbe angeschlossen, von denen zwei in gleicher Richtung wirken, so ist der dritte Stab ein Nullstab.Lastannahme
LASTKOMBINATION
oder
TEILSICHERHEITSBEIWERTE
ständige Lasten: γg = 1,35veränderliche Lasten: γq = 1,50außergewöhnliche Lasten: γA = 1,00BEMESSUNGSWERT
Bemessungswert = Teilsicherheitsbeiwert · charakteristischer Wert einer Einwirkung
für ständige Last: gd = 1,35 · gkfür veränderliche Last: qd = 1,50 · qkCharakteristische Lasten haben den Index »k«; Bemessungswerte (= Designwerte) der Lasten haben den Index »d«.
BERECHNUNG DER RESULTIERENDEN DURCH INTEGRATION DER LAST
Angriffspunkt der Resultierenden ist immer der Schwerpunkt der Last
Nutzlasten
DECKEN, TREPPEN UND BALKONE
Siehe Kapitel 7, Tabelle 7.1
WIND
Windzonenkarte Siehe Kapitel 7, Abbildung 7.2
Wind auf Außenflächen
SCHNEE
Schneezonenkarte Siehe Kapitel 7, Abbildung 7.7
Charakteristische Schneelast auf dem Boden
Charakteristische Schneelast auf dem Dach
LASTEN AUF SCHRÄGEN FLÄCHEN
Trägersysteme
AUFLAGERARTEN
Loslager – einwertiges AuflagerFestlager – zweiwertiges AuflagerEinspannung – dreiwertiges LagerSTÜTZWEITE
Die statische Länge respektive Stützweite ist die lichte Weite zuzüglich der halben Auflagertiefen zu jeder Seite:
Trägersysteme
GLEICHGEWICHTSBEDINGUNGEN
Statik ist die Lehre der Kräfte an ruhenden Körpern:
SCHNITTGRÖßEN
SCHNITTSTELLEN
an den Auflagern – bei Innenstützen rechts und links davonrechts und links von Einzellastenan LastwechselnStelle der maximalen Beanspruchung; NullstelleNULLSTELLE
Das maximale Moment tritt an der Nullstelle x0 der Querkraft auf
Einfeldträger
Die Querkraft an (je)der nachfolgenden Schnittstelle ergibt sich zu:
Die zuvor ermittelte Querkraft abzüglich der Last bis zur nächsten Stelle
Einfeldträger mit Kragarm
LASTFALLUNTERSCHEIDUNG
Verkürzte Methoden
QUERKRAFT
Arbeitsrichtung
Last
Stützkraft
→
−
+
←
+
−
MOMENTE
Die Fläche der Querkraftlinie bis zu einer Schnittstelle x entspricht dem Moment an dieser Stelle x.
Durchlaufträger
Tafeln in den Regelwerken
Sind die einzelnen Felder ungleich lang, die kleinste Länge beträgt aber mindestens 80% der größten Länge, so ist für »l« der Mittelwert der benachbarten Feldlängen einzusetzen.
Festigkeitslehre
SCHWERPUNKT
FLÄCHENTRÄGHEITSMOMENT AM ZUSAMMENGESETZTEN QUERSCHNITT
WIDERSTANDSMOMENT
FLÄCHENTRÄGHEITSMOMENT
Baustatik für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2026
© 2026 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This book is published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Dieses Buch wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Bevollmächtigte des Herstellers gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung ist die Wiley-VCH GmbH, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Deutschland, E-Mail: [email protected].
Alle Rechte bezüglich Text und Data Mining sowie Training von künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Technologien bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne die schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren –in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Der Verleger dankt Prof. Dr.-Ing. Karsten Tichelmann für die kreativen und konstruktiven Impulse seiner Vorlesungen an der TU Darmstadt, die den Anstoß zu diesem Buch gegeben haben.
Coverfoto: matho – stock.adobe.comKorrektur: Dr. Regine Freudenstein
Print ISBN: 978-3-527-72251-8ePub ISBN: 978-3-527-84997-0
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weiter geht
Teil I: Grundlagen der Baustatik
Kapitel 1: Was ist Statik?
Die Griechen haben's erfunden
Einfach machen
Statik in Theorie und Praxis
Statik in Technologie-Berufen
Ziel dieses Buches
Kapitel 2: Fachvokabeln und Sicherheitskonzept
Dichte und Wichte
Die Einheiten von Masse und Last
Griechisch für Statiker
Ordnung muss sein … die Eurocodes
Ordnung muss sein … das Koordinatensystem
Baustatik-Fachvokabeln
Nachweisformat und Sicherheitskonzept in der Statik
Teil II: Kräfte & Momente
Kapitel 3: Kräfte und Momente
Definition einer Kraft
Schräge Kräfte zerlegen
Kräfte sind Herdentiere
Das Kräftepaar und die Definition eines Moments
Der Hebelarm
Kapitel 4: Kraftsysteme
Das zentrale Kraftsystem
Das allgemeine Kraftsystem
Kapitel 5: Fachwerke
Fachwerke richtig entwerfen und konstruieren
Ermittlung von Stabkräften
Teil III: Erstellen von Lastannahmen
Kapitel 6: Grundlagen der Lastannahme
Vokabeln der Lastannahme
Handwerkszeug Bautabellen
Kapitel 7: Ständige und veränderliche Lasten
Aufbau der Bautabellen
Eigenlasten und veränderliche Lasten
Kapitel 8: Lasten auf Bauwerke
Letzte Hinweise vor dem Showdown
Beispiel Stahlbetondecke
Beispiel Holzbalkendecke
Beispiel Satteldach
Beispiel Wand
Beispiel Treppe
Beispiel Fundament
Teil IV: Bestimmen von Schnittgrößen
Kapitel 9: Grundlagen der Schnittgrößenermittlung
Statisches System
Grundprinzip Gleichgewichtsbedingungen
Kapitel 10: Der Einfeldträger
Einfeldträger mit Gleichstreckenlast
Kapitel 11: Einfeldträger mit Kragarm
Was ist neu?
Einfeldträger mit Kragarm ohne LF-Unterscheidung
Einfeldträger mit Kragarm mit LF-Unterscheidung
Verkürzte Methode
Kapitel 12: Durchlaufträger
Was ist neu?
Zweifeldträger mit gleicher Stützweite und Gleichstreckenlast
Zweifeldträger mit ungleicher Stützweite
Lastfallkombinationen des Dreifeldträgers
Dreifeldträger mit Gleichstrecken- und Trapezlast
Teil V: Festigkeitslehre
Kapitel 13: Grundlagen der Festigkeitslehre
Eine Frage des Durchhaltevermögens
Was man nicht sehen kann
Das Widerstandsmoment am Rechteckquerschnitt
Das Flächen(trägheits)moment I
Kapitel 14: Widerstandsmomente berechnen
Widerstandsmoment am zusammengesetzten Rechteckquerschnitt mit Symmetrieachse
Widerstandsmoment am zusammengesetzten Stahlprofil mit Symmetrieachse
Widerstandsmoment am beliebig zusammengesetzten Rechteckquerschnitt
Kapitel 15: Einführung in die Bemessung
Statisches System
Lastannahme
Schnittgrößen
Bemessung
Hilfe zur Vorbemessung
Teil VI: Top-Ten der Statik
Kapitel 16: 10 gute Werke zur Statik
Gute Regelwerke sind unverzichtbar
Tieferes Wissen und Verständnis
Tragwerke richtig entwerfen
Bauteileabmessungen sinnvoll abschätzen
Brücken schlagen
Tragwerke nach Eurocode bemessen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 2
Tabelle 2.1: Umrechnung von Masse und Kraft
Tabelle 2.2: Basis-Eurocodes der Tragwerksplanung
Tabelle 2.3: Fachvokabeln der Baustatik
Kapitel 3
Tabelle 3.1: Horizontale und vertikale Kraftkomponenten
Kapitel 4
Tabelle 4.1: Horizontale und vertikale Kraftkomponenten
Tabelle 4.2: In Kraftanteile zerlegte Kräfte
Kapitel 5
Tabelle 5.1: Vorbemessung von Fachwerkbindern aus Holz und Stahl
Tabelle 5.2: Zusammenfassung der Stabkräfte
Tabelle 5.3: Zusammenfassung der Stabkräfte
Tabelle 5.4: Zusammenfassung der Stabkräfte aus dem Cremonaplan
Kapitel 7
Tabelle 7.1: Nutzlasten für Decken, Treppen und Balkone
Tabelle 7.2: Vereinfachte Geschwindigkeitsdrücke für Bauwerke bis 25 m
Tabelle 7.3: Außendruckbeiwert für senkrechte Wände
Tabelle 7.4: c
pe
-Werte für das Satteldach
Tabelle 7.5: Formbeiwert für Schnee auf Satteldächern
Kapitel 8
Tabelle 8.1: Ausschnitt aus der Nutzlast-Tabelle
Tabelle 8.3: Nutzlasten für Wohnhausdecken
Tabelle 8.4: Kombinationsbeiwerte ψ
q,i
Kapitel 11
Tabelle 11.1: Arbeitsrichtungen bei der Querkraftbestimmung
Kapitel 12
Tabelle 12.1: Berechnungsformeln
Tabelle 12.2: Tafelwerte des Zweifeldträgers
Kapitel 14
Tabelle 14.1: Vorbereitung der Querschnittsdaten, die minimale Form
Tabelle 14.2: Vorbereitung der Querschnittsdaten maximal
Tabelle 14.3: Querschnittswerte der Stahlträger
Tabelle 14.4: Einzel-Querschnittswerte
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Statik als Teil der Mechanik
Abbildung 1.2: Wagen auf Brücke als idealisiertes Tragsystem
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Griechisches Alphabet
Abbildung 2.2: Überblick der Eurocodes
Abbildung 2.3: Räumliches und ebenes Koordinatensystem
Abbildung 2.4: Lagesicherung mit Dorn
Abbildung 2.5: Sicherheitskonzept nach EC0
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Wirkungslinie im Raum
Abbildung 3.2: Unterschiedliche Richtungen auf der gleichen Wirkung...
Abbildung 3.3: Unterschiedliche Ausrichtungen der am Dach angreifenden Lasten
Abbildung 3.4: Kraft maßstabsgetreu antragen
Abbildung 3.5: Hilfslinien antragen
Abbildung 3.6: Den horizontalen und vertikalen Kraftanteil bestimme...
Abbildung 3.7: Größen der Kraftanteile abmessen
Abbildung 3.8: Winkelfunktionen im Kraftdreieck
Abbildung 3.9: Drehrichtung von Winkeln
Abbildung 3.10: Koordinatensystem in der Statik
Abbildung 3.11: Schritte 1. bis 4. der zeichnerischen Lösung
Abbildung 3.12: Kräfte an einem Masten
Abbildung 3.13: Tauziehen
Abbildung 3.14: Die Personen werden durch Kräfte ersetzt
Abbildung 3.15: Resultierende der Einzelkräfte R
li
und R
re
Abbildung 3.16: End-Resultierende R
ges
Abbildung 3.17: Angabe zu den Einzelkräften
Abbildung 3.18: Den fehlenden Teilwinkel ermitteln
Abbildung 3.19: Lastanteile der Resultierenden
Abbildung 3.20: Richtung der Resultierenden R
Abbildung 3.21: Neigung der Resultierenden R
Abbildung 3.22: F
1
im Maßstab antragen
Abbildung 3.23: F
2
an F
1
anhängen
Abbildung 3.24: F
3
als letzte Kraft an F
2
anschließen
Abbildung 3.25: Die Resultierende als Summe der Einzelkräfte
Abbildung 3.26: Die Neigung der Resultierenden
Abbildung 3.27: Die Resultierende als stabilisierende Gegenkraft
Abbildung 3.28: Angreifende Kräfte
Abbildung 3.29: Eine Kraft wirkt auf einen Körper und verschiebt d...
Abbildung 3.30: Sich aufhebende Kräfte
Abbildung 3.31: Ein Kräftepaar erzeugt eine Verdrehung des Körpers
Abbildung 3.32: Eine Kraft wirkt mit Abstand auf eine Masse
Abbildung 3.33: Verschiedene Hebel erzeugen verschieden große Momente
Abbildung 3.34: Kürzester Abstand vom Drehpunkt zur Kraft
Abbildung 3.35: Kräftepaar mit Abstand a
Abbildung 3.36: Kräftepaar mit einem Drehpunkt D
Abbildung 3.37: Kräftepaar mit einem Drehpunkt D außerhalb
Abbildung 3.38: Drehsinn der Kräfte um den Drehpunkt
Abbildung 3.39: Richtungsänderung der Kraft und somit auch des Mom...
Abbildung 3.40: Bekanntes Moment an einem Bauteil
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Zentrales Kraftsystem – die Kräfte greifen an einem ...
Abbildung 4.2: Allgemeines Kraftsystem – die Kräfte greifen an unte...
Abbildung 4.3: Wie wirkt die Resultierende?
Abbildung 4.4: Zahlenbeispiel zentrales Kraftsystem
Abbildung 4.5: Skizze zur Ermittlung der Richtung der Resultierenden
Abbildung 4.6: Lage und Richtung der Resultierenden aus F
1
, F
2
und ...
Abbildung 4.7: Lage und Richtung der stabilisierenden Kraft F
4
Abbildung 4.8: Kräfteplan – Aneinandergehängte Einzelkräfte ergeben...
Abbildung 4.9: Allgemeines Kraftsystem mit Größenangaben
Abbildung 4.10: Kraftanteile R
V
und R
H
sowie die Resultierende R m...
Abbildung 4.11: Wo greift die Resultierende R an?
Abbildung 4.12: (Senkrechte) Hebelarme der Einzelkräfte
Abbildung 4.13: Bestimmung von a
2
am Dreieck
Abbildung 4.14: Kraftsystem ohne schräge Kräfte
Abbildung 4.15: Senkrechter Hebelarm auf der geneigten Resultieren...
Abbildung 4.16: Resultierende, in horizontalen und vertikalen Ante...
Abbildung 4.17: Waagrechter Hebelarm der Resultierenden
Abbildung 4.18: Blatteinteilung für das Seileckverfahren – Schritt 1
Abbildung 4.19: Seileckverfahren – Schritt 2
Abbildung 4.20: Seileckverfahren – Schritt 3
Abbildung 4.21: Seileckverfahren – Schritt 4: Polstrahlen der erst...
Abbildung 4.22: Seileckverfahren – Schritt 5: alle Polstrahlen des Kraftsystems
Abbildung 4.23: Seileckverfahren – Schritt 6: Schnittpunkt von PS ...
Abbildung 4.24: Mögliche Lagen des Polstrahls
Abbildung 4.25: Seileckverfahren – Schritt 7: Lage von PS 1
Abbildung 4.26: Seileckverfahren – Schritt 8: PS 2 kreuzt die Wirk...
Abbildung 4.27: Seileckverfahren – Schritt 9: den letzte Polstrahl...
Abbildung 4.28: (Kraft-)Dreieck der Resultierenden
Abbildung 4.29: Seileckverfahren – Schritt 10: Wirkungslinie der R...
Abbildung 4.30: Seileckverfahren – Schritt 11: Hebelarme der Resul...
Abbildung 4.31: Vollständiges Seileckverfahren
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Bezeichnung der Fachwerkstäbe
Abbildung 5.2: Beispiel zum 1. Bildungsgesetz
Abbildung 5.3: Beispiel zum 2. Bildungsgesetz mit drei Stäben
Abbildung 5.4: Beispiel zum 2. Bildungsgesetz mit einem Stab
Abbildung 5.5: Beispiel zum 3. Bildungsgesetz
Abbildung 5.6: Kontrolle der inneren statischen Bestimmtheit
Abbildung 5.7: Beispiel zur statischen Bestimmtheit
Abbildung 5.8: Anordnung der Diagonalstäbe
Abbildung 5.9: Parallelbinder inklusive der äußeren Einwirkung
Abbildung 5.10: Nullstäbe des Fachwerksystems
Abbildung 5.11: Fachwerkträger mit vertikaler Einzellast in Feldmitte
Abbildung 5.12: Fachwerkträger mit Beschriftung
Abbildung 5.13: Freigeschnittener Knoten k
1
Abbildung 5.14: Freigeschnittener Knoten k
2
Abbildung 5.15: Freigeschnittener Knoten k
3
Abbildung 5.16: Freigeschnittener Knoten k
4
Abbildung 5.17: Schnittverfahren nach Ritter
Abbildung 5.18: Fachwerksystem und Auflagerkräfte
Abbildung 5.19: Ritterschnitt
Abbildung 5.20: Fachwerksystem des Dachbinders
Abbildung 5.21: Fachwerksystem mit Beschriftung
Abbildung 5.22: Nullstäbe des Fachwerksystems
Abbildung 5.23: Ritterschnitt
Abbildung 5.24: Freigeschnittener Knoten k
1
Abbildung 5.25: Freigeschnittener Knoten k
4
Abbildung 5.26: Beispiel zum Cremonaplan
Abbildung 5.27: Freigeschnittener Knoten k
1
und Krafteck (Cremonaplan)
Abbildung 5.28: Ermittlung der Stabkräfte D
1
und U
1
Abbildung 5.29: Übertragung der Pfeilrichtung
Abbildung 5.30: Krafteck des zweiten Knoten k
2
Abbildung 5.31: Krafteck wird geschlossen
Abbildung 5.32: Vollständiger Cremonaplan
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Lastqualitäten am Wohnhaus
Abbildung 6.2: Last-Geometrien
Abbildung 6.3: Gleichstreckenlast
Abbildung 6.4: Teilstreckenlast
Abbildung 6.5: Ungleichmäßige Last-Geometrien
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Druck- und Sogwirkung auf ein Bauwerk
Abbildung 7.2: Windzonenkarte von Deutschland
Abbildung 7.3: Geländekategorien
Abbildung 7.4: Schnitt Satteldach
Abbildung 7.5: Anströmrichtungen am Satteldach
Abbildung 7.6: Charakteristische Schneelast s
k
auf dem Boden
Abbildung 7.7: Schneelastzonenkarte
Abbildung 7.8: Sheddach mit Kuhlen für Schneesackbildung
Abbildung 7.9: Unterschiedliche Bezugsflächen für Wind und Schnee
Abbildung 7.10: Bezugsfläche der Eigenlast
Abbildung 7.11: Senkrecht zur Trägerebene gedrehte Lasten
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Stahlbetondecke inkl. Fußbodenaufbau
Abbildung 8.2: Holzbalkendecke
Abbildung 8.3: Unterkonstruktion Gipskartonplatte
Abbildung 8.4: Schnitt durch das Dach
Abbildung 8.5: Ermittlung der Dachhöhe
Abbildung 8.6: Berechnete Winddruckverteilung am Satteldach
Abbildung 8.7: Lasteinzugsfläche eines Sparren
Abbildung 8.8: Wandaufbau
Abbildung 8.9: Belastung von Wänden
Abbildung 8.10: Stahlbetontreppe
Abbildung 8.11: Projizierte Grundfläche
Abbildung 8.12: Schnitt durch das Gebäude
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Einzuteilendes Bauwerk
Abbildung 9.2: Trägerarten
Abbildung 9.3: Auflagertiefe auf der Außenwand
Abbildung 9.4: Stützweiten der Decke
Abbildung 9.5: Loslager – einwertiges Auflager
Abbildung 9.6: Festlager – zweiwertiges Auflager
Abbildung 9.7: Dorn eines Dachbinders
Abbildung 9.8: Einspannung – dreiwertiges Auflager
Abbildung 9.9: (Unvollständiges) Statisches System der Decke
Abbildung 9.10: Vollständiges statisches System
Abbildung 9.11: Tragender Balken auf vier Stützen
Abbildung 9.12: Balkenträger als statisches System
Abbildung 9.13: Träger mit unsymmetrischer Belastung
Abbildung 9.14: Einstürzender Träger mit Drehmoment um Auflager B
Abbildung 9.15: Prinzipielle Anordnung der inneren Schnittgrößen
Abbildung 9.16: Größe und Angriffspunkt der Resultierenden
Abbildung 9.17: Grundprinzip der Lastdarstellung in Linienform
Abbildung 9.18: Die Darstellung der Graphen
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Statisches System inklusive Belastung
Abbildung 10.2: Statisches System inklusive der Auflagerkräfte
Abbildung 10.3: Schnitt an x-beliebiger Stelle
Abbildung 10.4: Schnitt am Auflager – abstrakt
Abbildung 10.5: Schnitt am Auflager – real
Abbildung 10.6: Schnitt am Auflager B – rechter Teilschnitt
Abbildung 10.7: Schnitt am Auflager B – linker Teilschnitt
Abbildung 10.8: Bezugslinie des Graphen mit Darstellung der gezoge...
Abbildung 10.9: Normal-, Querkraft- und Momentenlinie
Abbildung 10.10: Statisches System inklusive Belastung
Abbildung 10.11: Normal-, Querkraft- und Momentenlinie
Abbildung 10.12: Charakteristische Lasten erkennen
Abbildung 10.13: Lastanteil von g und q
1
mit Hebelarm der Resultierenden
Abbildung 10.14: Lastanteil von q
2
mit Hebelarm nach A bzw. B
Abbildung 10.15: Notwendige Schnitte am Träger
Abbildung 10.16: Zu untersuchendes Schnittteil
Abbildung 10.17: Alle Schnittteile am Träger
Abbildung 10.18: Schnitt-Skizze für das Moment bei 1,50 m
Abbildung 10.19: Schnitt-Skizze für das Moment bei 3,50m
Abbildung 10.20: Bereich, in dem die Nullstelle auftritt
Abbildung 10.21: Schnitt-Skizze für das maximale Moment
Abbildung 10.22: Vermaßte Querkraftlinie für die Flächenberechnung
Kapitel 11
Abbildung 11.1: Statisches System des Einfeldträgers mit Kragarm
Abbildung 11.2: Lastfallkombinationen
Abbildung 11.3: Biegelinien am Einfeldträger mit Kragarm
Abbildung 11.4: Wechsel von Zug- und Druckzone
Abbildung 11.5: Prinzipieller Momentenverlauf am Einfeldträger mit...
Abbildung 11.6: Schnitt für das Stützmoment über dem Auflager B
Abbildung 11.7: Extremwerte, die sich aus LF 1 ergeben
Abbildung 11.8: Extremwerte, die sich aus LF 2 ergeben
Abbildung 11.9: Extremwerte, die sich aus LF 3 ergeben
Abbildung 11.10: Einfeldträger mit Kragarm »nur mit ständiger Las...
Abbildung 11.11: Momentenwirkung der Lastanteile um B
Abbildung 11.12: Kragarmende mit und ohne Einzellast
Abbildung 11.13: Graphen von Querkraft- und Momentenlinie
Abbildung 11.14: Statisches System mit Belastung
Abbildung 11.15: Lastfall 1 (LF 1)
Abbildung 11.16: Am Träger vorhandene horizontale Kräfte
Abbildung 11.17: Schnitt für die Normalkraftbestimmung
Abbildung 11.18: Lastfall 2 (LF 2)
Abbildung 11.19: Normalkraft-, Querkraft- und Momentenlinie
Abbildung 11.20: Schnitt am Trägerende
Abbildung 11.21: Grenzwertlinie von Querkraft und Momenten
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Zweifeldträger mit (annähernd) gleichen Stützweite...
Abbildung 12.2: Auflagerkräfte des Zweifeldträgers
Abbildung 12.3: Lastfälle des Zweifeldträgers
Abbildung 12.4: Spiegelidentische Laststellungen am Dreifeldträger
Abbildung 12.5: Belastungsqualitäten der Durchlaufträgertafeln
Abbildung 12.6: Mittelwert an der Innenstütze
Abbildung 12.7: Prinzipieller Momentenverlauf (Grenzwertlinie) am Zweifeldträger
Abbildung 12.8: Zweifeldträger mit Gleichstreckenlast
Abbildung 12.9: Lastfall 1 (LF 1)
Abbildung 12.10: Lastfall 2 (LF 2)
Abbildung 12.11: Unvollständige Graphen
Abbildung 12.12: Zweifeldträger mit ungleicher Stützweite
Abbildung 12.13: Lastfall 1 (LF 1)
Abbildung 12.14: Lastfall 2 (LF 2)
Abbildung 12.15: Lastfallkombinationen für den Dreifeldträger
Abbildung 12.16: Momentenverlauf am Mehrfeldträger
Abbildung 12.17: Statisches System mit Belastung
Abbildung 12.18: Laststellungen für die Extremwerte
Abbildung 12.19: Schnittgrößen an einer beliebigen Stelle
Abbildung 12.20: Lastamplitude der Trapezlast bei 1 m
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Normalspannung
Abbildung 13.2: Biegespannung und Verformung – Dehnung und Stauchu...
Abbildung 13.3: Normal- und Biegespannung überlagert
Abbildung 13.4: Lage des Schwerpunkts
Abbildung 13.5: Zerlegung in Dreiecke und Rechtecke
Abbildung 13.6: Hauptachsen = Schwerachsen
Abbildung 13.7: Verwirrende wechselnde Bezeichnungen von Höhe und Breite
Abbildung 13.8: Normierte Darstellung
Abbildung 13.9: Beliebig zusammengesetzte Querschnitte
Abbildung 13.10: Sich verdrehender Querschnitt bei außermittiger ...
Abbildung 13.11: Schwerpunkt am zusammengesetzten Querschnitt gle...
Abbildung 13.12: Hilfsachsen an den Querschnittsrändern
Abbildung 13.13: (Gesamt-)Schwerpunkt mit Hauptachsen
Abbildung 13.14: Abstände e zu den Querschnittsrändern
Abbildung 13.15: Abstand der Schwerpunkte der Teilflächen zum Ges...
Kapitel 14
Abbildung 14.1: Bemaßte Querschnitte
Abbildung 14.2: Vermaßter Rechteckquerschnitt
Abbildung 14.3: Schwerpunkt mit Abstände y
is
und z
is
Abbildung 14.4: Abstände e zu den Querschnittsrändern
Abbildung 14.5: Zusammengesetzter Stahlträger
Abbildung 14.6: Schwerpunkt mit Randabständen
Abbildung 14.7: Hilfsachsen am beliebig zusammengesetzten Rechteck...
Abbildung 14.8: Gesamtschwerpunkt
Abbildung 14.9: Abstände e zu den Querschnittsrändern
Kapitel 15
Abbildung 15.1: Statisches System der Holzbalkendecke
Abbildung 15.2: Querschnitt der Holzbalkendecke
Abbildung 15.3: Querkraft- und Momentenverlauf
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
271
272
273
274
275
276
277
278
279
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
295
296
297
298
Einführung
Die Statik, die sich in großen Teilen mit dem Gebiet der Technischen Mechanik deckt, ist die Grundlage nahezu aller technischen Berufe. Demzufolge wird sie in jeder Ausbildung gelehrt: In den klassischen Lehrberufen in einfacher Form, in den Techniker- oder Meisterklassen anspruchsvoller und in den Ingenieursstudiengängen im großen Umfang. Durch unsere Lehrtätigkeiten als Dozenten für Statik, Tragwerkslehre, Stahlbetonbau und Bemessung von Tragwerken für Bautechniker und Architekturstudenten erfahren wir immer wieder, wieviel (Ehr-)Furcht viele Studierende vor diesen Fächern haben. In vielen Köpfen hat sich der Gedanke festgesetzt, Statik sei nur etwas für »Genies« und man wolle »einfach nur die Prüfung bestehen«.
Tatsächlich ist unseren Erachtens Statik (das schließt die Fächer Tragwerkslehre, Stahlbetonbau und Bemessung von Tragwerken mit ein!) ein Fach, das man sich nur schwer selbst beibringen kann, weil es zum einen sehr komplex ist und zum anderen wirklich »gute« Bücher zu diesem Thema nur schwer zu finden sind. Damit ist nicht gemeint, dass die Bücher schlecht sind, nein, nein. Oft sind sie fachlich herausragend, setzen aber im Niveau viel zu hoch an und erfordern ein hohes Maß an bereits vorhandenem Grundverständnis.
Über dieses Buch
Wir haben dieses Buch aus den eben genannten Gründen bewusst sehr einfach gehalten: Das gilt sowohl sprachlich als auch didaktisch - ohne dabei fachlich kürzer zu treten. Wir haben auch einfache Zusammenhänge erklärt und an den Stellen auf Kleinigkeiten hingewiesen, von denen wir aus unserer Erfahrung in der Lehre wissen, dass sie hilfreich sind. Wir haben die rein theoretischen Erklärungen auf ein Minimum reduziert und stattdessen zahlreiche Beispiele gerechnet. Statik ist der Mathematik sehr ähnlich, daher gilt: Haben Sie einen Aufgabentyp oft genug gerechnet, wissen Sie, wie's geht. An manchen Stellen haben wir die strengen Vorgaben der Norm außen vorgelassen und in der Erklärung den Fokus auf die Praxis gerichtet. Zum Beispiel sind Richtungen in Koordinatensystemen für tatsächliche Querschnittsabmessungen nicht wirklich von Bedeutung - Egal von welcher Seite ein Sparren betrachtet wird, Länge und Höhe bleiben immer gleich.
Konventionen in diesem Buch
Einheiten
werden bei den Eingangswerten angegeben und sind natürlich bei den Ergebnissen unentbehrlich. In den Rechnungen sind sie dagegen für unser Dafürhalten entbehrlich! Fällt es Ihnen leichter, durchgehend mit Einheiten zu rechnen, so werden wir Sie bestimmt nicht davon abhalten!
Dezimalstellen
sollten – vor allem in Ergebnissen – auf ein vernünftiges Maß reduziert werden. Das bedeutet, dass sich drei Ziffern als praxistauglich erwiesen haben. Zahlenwerte unter 10 haben damit zwei Nachkommastellen, Zahlen über 10 bis 100 haben eine Nachkommastelle und Werte größer 100 kommen gut ohne Nachkommastelle aus. Werden Ergebnisse in weiterführenden Rechnungen verwendet, kann es sinnvoll sein, mehr Nachkommastellen mitzunehmen.
Richtungen
für Kräfte und Momente folgen nicht immer der normativen Vorgabe und sind daher entweder klar mit Pfeilen gekennzeichnet oder sind für die folgende Berechnung nicht von Bedeutung.
Ein
Regelwerk
beziehungsweise
Tabellenbuch
Ihrer Wahl ist unverzichtbar, um dieses Buch verstehen und aktiv mitarbeiten zu können.
Törichte Annahmen über den Leser
Wir gehen davon aus beziehungsweise setzen voraus, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser …
technisch interessiert sind und grundsätzlich Freude daran haben, Lösungen für Aufgabenstellungen auszutüfteln (nicht nur, wenn es um Statik geht!);
die Grundkenntnisse der Mathematik, wie das Auflösen einer Gleichung nach einer Unbekannten, beherrschen;
vertraut sind mit den Winkelfunktionen von Sinus, Cosinus und Tangens;
ein gutes Vorstellungsvermögen haben und einfache Pläne lesen können;
dieses Buch gekauft haben, weil Sie die Weiterbildung zum Bautechniker durchlaufen respektive Architektur oder Bauingenieurwesen studieren;
gewillt sind, Papier und Bleistift in die Hand zu nehmen und die Rechnungen tatsächlich selbst (mit) zu rechnen.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Nach der Einführung in die Grundlagen der Statik in Teil I beschäftigen sich die weiteren Teile mit in sich abgeschlossenen Themen. Das erste Kapitel enthält dabei immer die theoretische Erklärung neuer Fachbegriffe und Berechnungsmethoden. In den weiteren Kapiteln geht es in der Regel ausschließlich um Beispiele. Demzufolge sollten Sie das erste Kapitel jeweils immer sehr genau lesen, da hier Erklärungen besonders detailliert und anschaulich gegeben werden. Für die weiteren Beispiele wird nach der Aufgabenstellung sofort die fertige Lösung präsentiert und erst im Nachgang wird unter der Überschrift »Wie kommt man drauf« der Rechenweg ausführlich aufgeschlüsselt. Fallen Ihnen bestimmte Gebiete leichter oder haben Sie bereits Vorkenntnisse, so können Sie diese Themen einfach überspringen.
Teil I: Grundlagen – Grundwissen
In Kapitel 1 finden Sie kurze Informationen darüber, was Statik grundsätzlich ist und welche Rolle sie in der Lehre spielt. In Kapitel 2 tauchen Sie tief in die Grundlagen der Statik ein: Einheiten, Normen, griechisches Alphabet, Nachweise, Sicherheitskonzepte und die Baustatik-Begriffe, die im Laufe des Buches verwendet und nicht explizit erklärt werden, werden vorgestellt. Tabelle 2.3 ist als eine Art Wörterbuch zu verstehen, in dem Sie immer nachschauen können, wenn im Buch ein Begriff vorkommt, für den Sie eine Beschreibung brauchen.
Teil II: Kräfte & Momente
Kernstück jeder Statik sind Kräfte, die über Hebel Momente erzeugen. Der zweite Teil beleuchtet intensiv das Wirken, Zerlegen und Zusammenfügen von Kräften. In Kapitel 3 lernen Sie, die Kraft grundsätzlich zu verstehen und Ihre »Wirkung« in der Statik zu erkennen. Kräfte werden zerlegt, zur Resultierenden zusammengefügt und mittels Hebelarmen zu Momenten. Im vierten Kapitel finden die Kräfte – und die Theorie aus Kapitel 3 – erste praktische Anwendung im allgemeinen beziehungsweise im zentralen Kraftsystem. Sie lernen das sehr alte und geniale Verfahren des Seileckverfahrens kennen, mit dessen Hilfe vor Einführung des Taschenrechners Kraftgrößen zeichnerisch zuverlässig ermittelt wurden. Kapitel 5 führt Sie in die Welt der Fachwerke, in der die Kenntnisse von zentralem und allgemeinem Kraftsystem aus Kapitel 4 nochmal aus einer anderen Blickrichtung betrachtet werden.
Teil III: Erstellen von Lastannahmen
Lastqualitäten, Sicherheitsbeiwerte, charakteristische Lasten und Bemessungslasten werden in Kapitel 6 grundsätzlich erklärt, während sich Kapitel 7 mit veränderlichen Lasten beschäftigt. Ab diesem Punkt ist Ihr Tabellenbuch ein unverzichtbarer Begleiter! Sie lernen Wind- und Schneelasten zu berechnen und wie man sie »auf's Dach hebt«. Kapitel 8 ist das Beispielkapitel, in dem Sie Lastannahmen für konkrete Bauteile wie Decke, Treppe oder Fundament aufstellen.
Teil IV: Bestimmen von Schnittgrößen an verschiedenen statischen Systemen
Kapitel 9 beschäftigt sich mit den Grundlagen der statischen Systeme: Dazu zählen Auflagerarten, die Stützweite und der Kerngedanke der Statik, die Gleichgewichtsbedingungen. In den weiteren Kapiteln lernen Sie die verschiedenen statischen Trägersysteme kennen und deren Auflagerkräfte und Schnittgrößen zu bestimmen und graphisch darzustellen. Anhand der Mehrfeldträger in Kapitel 12 erwerben Sie Kenntnisse zur statischen Bestimmtheit von Trägersystemen.
Teil V: Festigkeitslehre
In diesem Teil wechseln wir die Seiten und beschäftigen uns mit den Widerständen von Bauteilen. Kapitel 13 erklärt die Grundbegriffe Widerstands- und Flächenträgheitsmoment und die sich dadurch ergebenden Verformungen, beschäftigt sich mit auftretenden Spannungen und der Frage, wie damit statische Nachweise geführt werden. An konkreten, zusammengesetzten Querschnitten werden in Kapitel 14 die tatsächlichen Widerstandswerte ermittelt. Kleine Ausblicke auf Nachweisformate respektive die Bemessung von Bauteilen sollen Ihre Kenntnisse auf diesem Gebiet verbessern.
Teil VI: Top-Ten der Statik
Sie sind nun am Ziel angekommen und haben sich erste Grundkenntnisse zur Baustatik angeeignet! Wie geht es nun weiter? In diesem Teil stellen wir Ihnen 10 Bücher vor, die Ihr Studium der Baustatik sinnvoll ergänzen und erweitern. Vielleicht haben Sie noch weitere „Statik“-Fächer vor sich: Für auf den Grundlagen aufbauende Fächer und Module wie Bemessung von Tragwerken, Stahlbetonbau, Massivbau, Stahlbau etc. geben wir ebenfalls Empfehlungen für Ihre weitere Ausbildung.





























