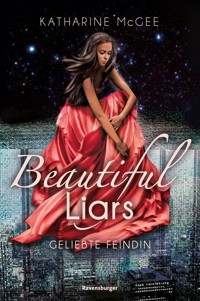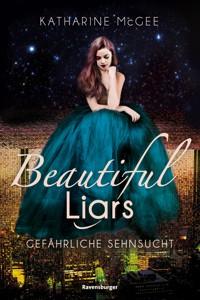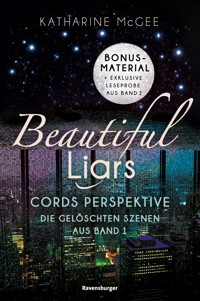9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Beautiful Liars
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Manhattan, 2118: Im Penthouse des höchsten Gebäudes der Welt feiern die Reichen und Schönen eine rauschende Party. Für fünf von ihnen wird nach dieser Nacht nichts mehr so sein wie zuvor. Die wunderschöne Avery, die intrigante Leda, die verführerische Eris, die verzweifelte Rylin, der ehrgeizige Watt - einer von ihnen wird den Abend nicht überleben. Soghaft. Herzzerreißend. Skandalös. Die süchtig-machende Bestsellerreihe von Katharine McGee: Band 1: Verbotene Gefühle Band 2: Gefährliche Sehnsucht Band 3: Geliebte Feindin
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 614
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2017Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH© 2017 Ravensburger Verlag GmbHCopyright © 2016 by Alloy Entertainment and Katharine McGeePublished by arrangement with Rights People, LondonDie englischsprachige Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Thousandth Floor« bei HarperCollins Children’s Books.
Produced by Alloy Entertainment, LLCÜbersetzung: Franziska JaekelUmschlaggestaltung: Carolin Liepins, MünchenVerwendete Fotos von © Spa Chan, © conrado, © Matipon, © nizas, © Maksim Fesenko, © Photo.Lux, © Matusiac Alexandro, alle @ shutterstockAlle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.ISBN 978-3-473-47848-4www.ravensburger.de
Für Lizzy
Prolog
November 2118
Das Gelächter und die Musik in der eintausendsten Etage dröhnten. Die Party neigte sich kaum merklich ihrem Ende zu, die ersten Gäste stolperten in die Fahrstühle und fuhren nach unten in ihre Wohnungen. Die raumhohen Fenster wirkten wie Vierecke aus samtener Dunkelheit, obwohl in der Ferne bereits langsam die Sonne aufging und die Skyline in ein ockerfarbenes, blassrosa leuchtendes und sanft schimmerndes Gold tauchte.
Und dann erklang plötzlich ein Schrei. Ein Mädchen stürzte vom Dach, ihr Körper fiel immer schneller durch die kühle, dämmrige Morgenluft.
In nur drei Minuten würde das Mädchen auf dem gnadenlosen Beton der East Avenue aufschlagen. Doch jetzt – mit ihrem Haar, das wie eine Fahne um sie peitschte, dem Seidenkleid, das um ihre Kurven flatterte, ihren leuchtend roten Lippen, die vor Schreck zu einem vollkommenen O geformt waren – jetzt, in diesem Augenblick, war sie schöner als jemals zuvor.
Es heißt, dass unmittelbar vor dem Tod noch einmal das ganze Leben eines Menschen vor seinem inneren Auge abläuft. Doch während der Boden immer schneller auf sie zukam, konnte sie nur an die letzten Stunden denken, an den Weg, den sie eingeschlagen hatte und der hier endete. Hätte sie doch nur nicht mit ihm geredet. Wäre sie doch nur nicht so dumm gewesen. Wäre sie doch vor allem nicht dort hinaufgegangen.
Als der Wachmann auf der Straße fand, was von ihrem Körper übrig geblieben war, und zitternd eine Meldung des Unfalls durchgab, wusste er nur, dass dieses Mädchen die erste Person war, die in der zwanzigjährigen Geschichte des Towers von dem Gebäude hinuntergestürzt war. Er wusste nicht, wer sie war oder wie sie es nach draußen geschafft hatte.
Er wusste nicht, ob sie gefallen oder gestoßen worden war oder ob sie – erdrückt von der Last unaussprechlicher Geheimnisse – beschlossen hatte, zu springen.
Avery
Zwei Monate vorher
»Das war ein schöner Abend«, sagte Zay Wagner, als er Avery zur Tür ihres Familienpenthouses brachte. Sie waren im New York Aquarium in der achthundertdreißigsten Etage gewesen und hatten zwischen vertrauten Gesichtern im sanften Schimmer der Aquarien getanzt. Eigentlich war Avery kein großer Fan dieser Bar. Aber wie ihre Freundin Eris immer sagte: Eine Party ist eine Party.
»Das fand ich auch.« Avery beugte sich zum Netzhautscanner vor und die Tür entriegelte sich. Sie strich ihre blonden Haare zurück und warf Zay ein schwaches Lächeln zu. »Gute Nacht.«
Er griff nach ihrer Hand. »Ich dachte, ich könnte vielleicht mit reinkommen? Weil deine Eltern doch nicht da sind …«
»Tut mir leid«, murmelte Avery und verbarg ihr Unbehagen hinter einem falschen Gähnen. Er hatte sie schon den ganzen Abend unter irgendwelchen Vorwänden berührt. Sie hätte damit rechnen müssen. »Ich bin müde.«
»Avery …« Zay ließ ihre Hand los und trat einen Schritt zurück. »Das geht jetzt schon seit Wochen so. Magst du mich überhaupt?«
Avery öffnete den Mund, blieb aber stumm. Sie hatte keine Ahnung, was sie sagen sollte.
In Zays Miene flackerte etwas auf – Ärger? Verwirrung? »Schon verstanden. Bis später.« Er stieg in den Fahrstuhl, dann drehte er sich noch einmal um und betrachtete sie von oben bis unten. »Du siehst heute Abend wirklich wunderschön aus«, fügte er hinzu, bevor sich die Fahrstuhltüren mit einem leisen Klick schlossen.
Avery seufzte und trat in die prachtvolle Eingangshalle ihres Apartments. Bevor sie geboren wurde, als sich der Tower noch im Bau befand, hatten ihre Eltern hartnäckig darum gekämpft, diese Wohnung zu bekommen – sie umfasste die gesamte obere Etage des Towers und hatte die imposanteste Eingangshalle im ganzen Gebäude. Sie waren stolz darauf, aber Avery hasste es, wie ihre Schritte im Foyer widerhallten und wie die funkelnden Spiegel an den hohen Wänden alles reflektierten. Sie konnte nirgendwo hinsehen, ohne ihr Spiegelbild vor Augen zu haben.
Sie zog die Pumps aus, ließ sie mitten in der Halle liegen und lief barfuß zu ihrem Zimmer. Morgen würde jemand die Schuhe wegräumen, einer der Bots oder Sarah, wenn sie zur Abwechslung einmal pünktlich war.
Armer Zay. Avery mochte ihn sogar. Er war echt witzig, auf eine übertriebene, übersprudelnde Art, die sie zum Lachen brachte. Sie fühlte nur einfach nichts, wenn sie sich küssten.
Avery wollte nur einen einzigen Jungen küssen – doch mit ihm durfte das niemals geschehen.
Als sie ihr Zimmer betrat, sprang leise summend der Raumcomputer an, der ihre Vitalfunktionen scannte und die Zimmertemperatur entsprechend anpasste. Ein Glas gekühltes Wasser erschien auf dem Tisch neben ihrem antiken Himmelbett – wahrscheinlich wegen des Champagners, der immer noch in ihrem leeren Magen rumorte –, obwohl sie sich nicht mal die Mühe gemacht hatte, danach zu fragen. Nachdem Atlas die Stadt verlassen hatte, hatte sie die Sprachfunktion des Computers ausgeschaltet. Atlas hatte einen britischen Akzent eingestellt und die Stimme Jenkins getauft. Ohne Atlas mit Jenkins zu reden, war einfach zu deprimierend.
Zays Worte hallten in ihrem Kopf wider. Du siehst heute Abend wirklich wunderschön aus. Natürlich hatte er ihr nur ein Kompliment machen wollen. Er konnte nicht wissen, dass seine Worte auf Avery eher abstoßend wirkten. Ihr ganzes Leben lang musste sie sich schon anhören, wie wunderschön sie war – von Lehrern, Jungs, ihren Eltern. Inzwischen hatte dieser Satz all seine Bedeutung verloren. Ihr Adoptivbruder Atlas war einer der wenigen, die wussten, dass man ihr keine Komplimente zu machen brauchte.
Die Fullers hatten eine Menge Zeit und Geld investiert, um Avery zu bekommen. Sie war nicht sicher, wie teuer es gewesen war, sie zu »machen«, aber sie vermutete, dass der Betrag nur leicht unter dem Preis für das Apartment gelegen hatte. Ihre Eltern, die beide nicht besonders groß waren, ein durchschnittliches Äußeres und dünnes braunes Haar hatten, waren zu dem weltweit führenden Forschungsinstitut in die Schweiz geflogen, um ihr genetisches Material durchleuchten zu lassen. Irgendwo in den Millionen Kombinationsmöglichkeiten ihrer sehr durchschnittlichen DNA fanden ihre Ärzte die eine Kombination, die zu Avery geführt hatte.
Manchmal fragte sie sich, wie sie ausgesehen hätte, wenn ihre Eltern sie auf natürliche Weise bekommen hätten oder die Gene nur nach Krankheiten hätten untersuchen lassen, wie es die meisten Leute aus den oberen Etagen taten. Hätte sie die schmalen Schultern ihrer Mutter geerbt oder die großen Zähne ihres Vaters? Natürlich spielte das keine Rolle. Pierson und Elizabeth Fuller hatten für diese Tochter bezahlt, mit honigblondem Haar, langen Beinen und tiefblauen Augen, der Intelligenz ihres Vaters und der schnellen Auffassungsgabe ihrer Mutter. Atlas hatte sie immer damit aufgezogen, dass Dickköpfigkeit ihre einzige Schwäche sei.
Avery wünschte, das wäre wirklich das Einzige, was nicht mit ihr stimmte.
Sie schüttelte ihre Haare aus, band sie zu einem losen Dutt und verließ zielstrebig ihr Zimmer. In der Küche öffnete sie die Tür zur Speisekammer und tastete gleich darauf nach dem verborgenen Griff an der elektronischen Schalttafel. Sie war vor Jahren zufällig darauf gestoßen, als sie mit Atlas Verstecken gespielt hatte. Sie war nicht mal sicher, ob ihre Eltern davon wussten, denn sie hatten wahrscheinlich noch nie einen Fuß in die Speisekammer gesetzt.
Sie drückte die Schalttafel nach innen und eine Leiter schwang hinab. Avery hob den Saum ihres elfenbeinfarbenen Seidenkleids, zwängte sich in den schmalen Zwischenraum und kletterte hinauf, wobei sie instinktiv die Sprossen auf Italienisch zählte: uno, due, tre. Sie fragte sich, ob Atlas in den vergangenen Monaten auch Zeit in Italien verbracht hatte. Ob er überhaupt in Europa gewesen war?
Auf einer der letzten Sprossen balancierend hob sie die Arme, um die Dachluke zu öffnen, und stieg dann erwartungsvoll in die windgepeitschte Dunkelheit hinaus.
Neben dem ohrenbetäubenden Heulen des Windes hörte Avery auch das Grollen unzähliger Maschinen, die sich unter wasserdichten Gehäusen und Solarmodulen auf dem Dach drängten. Ihre nackten Füße wurden auf den Metallplatten kalt. Stahlbögen ragten aus jeder Ecke der Plattform und verbanden sich über ihrem Kopf zu der ikonischen Spitze des Towers.
Es war eine klare Nacht, in der Luft hing keine einzige Wolke, die sofort Averys Wimpern befeuchtet oder sich in Form feiner Wasserperlen auf ihre Haut gelegt hätte. Die Sterne glitzerten wie Glassplitter vor der unglaublich dunklen Weite des Nachthimmels. Wenn irgendjemand herausfand, dass sie sich auf dem Dach aufhielt, bekäme sie für den Rest ihres Lebens Hausarrest. Es war verboten, sich oberhalb der einhundertfünfzigsten Etage Zugang nach draußen zu verschaffen. Alle Terrassen darüber waren durch dicke Scheiben aus Polyethylen-Glas vor dem starken Wind geschützt.
Avery fragte sich, ob überhaupt jemand außer ihr jemals einen Fuß auf das Dach gesetzt hatte. An einer Seite war ein Sicherheitsgeländer angebracht, für den Fall, dass Wartungsarbeiten durchgeführt werden mussten. Aber soweit sie wusste, war das noch nie vorgekommen.
Nicht einmal Atlas hatte sie von diesem Ort erzählt. Es war eins der zwei Geheimnisse, die sie vor ihm hatte. Wenn er hiervon erführe, würde er bestimmt dafür sorgen, dass sie nicht mehr herkommen durfte. Avery konnte den Gedanken nicht ertragen, diesen Platz aufgeben zu müssen. Sie liebte es, hier oben zu sein – liebte den Wind, der ihr ins Gesicht schlug und ihr Haar zerzauste, ihre Augen zum Tränen brachte und so laut heulte, dass er ihre eigenen stürmischen Gedanken übertönte.
Sie trat näher an den Rand und genoss das Schwindelgefühl, während sie auf die Stadt hinunterblickte. Sie beobachtete die Monorails, die sich oberhalb der anderen Gebäude durch die Luft schoben wie fluoreszierende Schlangen. Der Horizont schien unglaublich weit weg. Avery konnte von den Lichtern New Jerseys im Westen bis zu den Vororten im Süden sehen, sie erkannte Brooklyn im Osten und, noch weiter in der Ferne, den schimmernden Atlantik.
Und unter ihren Füßen erhob sich das gigantischste Bauwerk der Erde, eine Welt für sich. Wie seltsam, dass in diesem Moment Millionen von Menschen unter ihr waren, aßen, schliefen, träumten, sich berührten. Avery blinzelte. Plötzlich fühlte sie sich vollkommen allein. Es waren alles Fremde, jeder einzelne von ihnen, sogar diejenigen, die sie kannte. Warum sollte sie sich überhaupt für die anderen interessieren, oder für sich selbst oder für sonst irgendetwas?
Sie lehnte sich mit den Ellbogen auf das Geländer und schauderte. Eine falsche Bewegung und sie könnte fallen. Nicht zum ersten Mal fragte sie sich, wie es sich anfühlen würde, zweieinhalb Meilen in die Tiefe zu stürzen. Sie stellte sich ein merkwürdig friedliches Gefühl vor, ein Gefühl der Schwerelosigkeit, wenn die endgültige Geschwindigkeit erreicht war. Und wahrscheinlich hätte sie längst einen Herzanfall erlitten, bevor sie auf dem Boden aufschlug. Mit geschlossenen Augen beugte sie sich noch weiter vor, krallte die Zehen um die Kante – als die Innenseiten ihrer Augenlider aufleuchteten. Ihre Kontaktlinsen hatten einen Anruf registriert.
Sie zögerte, denn beim Anblick des Namens schlug eine Welle der Begeisterung über ihr zusammen, die gleichzeitig von Gewissensbissen getrübt war. Sie hatte es den ganzen Sommer über so gut geschafft, ihre Gefühle auszublenden, hatte sich mit einem Auslandsstudienprogramm in Florenz und zuletzt mit Zay abgelenkt. Doch schon im nächsten Moment drehte Avery sich um und kletterte rasch die Leiter hinunter.
Zurück in der Speisekammer, flüsterte sie atemlos »Hey!«, obwohl niemand in der Nähe war, der sie hätte hören können. »Du hast dich schon eine Weile nicht mehr gemeldet. Wo bist du?«
»An einem neuen Ort. Es würde dir hier gefallen.« Seine Stimme klang unverändert, warm und kräftig. »Wie läuft’s, Aves?«
Und da war er – der Grund, weshalb Avery in windgepeitschte Höhen kletterte, um vor ihren Gedanken zu fliehen, der Teil ihrer genetischen Schöpfung, der schrecklich schiefgegangen war.
Am anderen Ende der Verbindung war Atlas, ihr Bruder – und der Grund, warum sie niemals einen anderen küssen wollte.
Leda
Als der Helikopter den East River in Richtung Manhattan überquerte, beugte sich Leda Cole vor und drückte das Gesicht gespannt gegen das Flexiglas.
Der erste Blick auf den Tower hatte immer etwas Magisches, besonders um diese Tageszeit, wenn die Fenster der oberen Stockwerke in der Nachmittagssonne aufleuchteten. Unter der Neochrom-Oberfläche zuckten farbige Blitze, wenn die Fahrstühle vorbeischossen, die Adern der Stadt, die ihren Lebenssaft aufwärts und abwärts pumpten. Das Gebäude sah aus wie immer, dachte Leda, total modern und trotzdem irgendwie zeitlos. Leda hatte unzählige Bilder der alten Skyline von New York gesehen, von der die Leute immer noch schwärmten. Doch ohne den Tower hatte die Stadt zerklüftet und hässlich ausgesehen, fand Leda.
»Froh, wieder zu Hause zu sein?«, fragte ihre Mom vorsichtig, während sie Leda über den Gang hinweg musterte.
Leda nickte knapp. Sie hatte keine Lust zu antworten. Sie hatte kaum mit ihren Eltern gesprochen, seit die sie heute Morgen aus der Entzugsklinik abgeholt hatten. Oder eigentlich schon seit dem Vorfall im Juli, dem sie ihren Aufenthalt dort verdankte.
»Können wir heute Abend bei Miatza bestellen? Ich sehne mich schon seit Wochen nach einem Vitro-Burger«, sagte ihr Bruder Jamie in einem durchschaubaren Versuch, sie aufzumuntern.
Leda ignorierte ihn. Jamie war nur elf Monate älter als sie und hatte das letzte Schuljahr vor sich. Er und Leda standen sich nicht besonders nah. Wahrscheinlich weil sie sich überhaupt nicht ähnlich waren.
Für Jamie war alles einfach und unkompliziert, er schien sich nie um irgendetwas Sorgen zu machen. Er und Leda sahen auch nicht aus wie Geschwister – während Leda ein dunklerer Typ war, genau wie ihre Mutter, war Jamies Haut fast so blass wie die ihres Vaters, und trotz Ledas größter Bemühungen sah er immer irgendwie ungepflegt aus. Im Moment trug er stolz einen wild wuchernden Bart, den er wahrscheinlich den ganzen Sommer über hatte wachsen lassen.
»Was Leda möchte«, erwiderte ihr Dad.
Na klar, wenn sie das Abendessen aussuchen durfte, würde das bestimmt alles wiedergutmachen.
»Ist mir egal.« Leda starrte auf ihr Handgelenk. Zwei winzige Einstiche – Überbleibsel des Überwachungsarmbands, das sie hatte tragen müssen – waren der einzige Beweis für ihre Zeit in Silver Cove, einer Entzugsklinik. Anders, als der Name vermuten ließ, befand sie sich weit weg vom Meer in der Mitte Nevadas.
Natürlich konnte Leda ihren Eltern nichts vorwerfen. Wenn sie Zeuge der Szene geworden wäre, in die ihre Eltern letzten Juli hereingeplatzt waren, hätte sie sich auch in eine Entzugsklinik einweisen lassen. Als Leda in Silver Cove angekommen war, war sie ein totales Wrack gewesen: ausfallend und wütend, zugedröhnt mit Xenperheidren und wer weiß was noch für Drogen. Sie hatte einen Tag lang eine starke Infusion aus Beruhigungsmitteln und Dopamin bekommen – von den anderen Mädchen in Silver Cove »Happy Juice« genannt –, bevor sie bereit war, überhaupt mit den Ärzten zu reden.
Doch während die Drogen langsam aus Ledas Nervensystem gesickert waren, hatte sich auch der bittere Geschmack ihrer Feindseligkeit verflüchtigt. Sie begann sich zu schämen, erdrückende, unangenehme Schuldgefühle ergriffen Besitz von ihr. Sie hatte sich immer geschworen, die Kontrolle zu behalten und nicht zu einer dieser erbärmlichen Drogensüchtigen zu werden, die in der Schule als Hologramme in Gesundheitskursen gezeigt wurden. Trotzdem war sie in Silver Cove gelandet, mit einem Infusionsschlauch in der Vene.
»Alles in Ordnung?«, hatte eine der Schwestern gefragt, als sie ihren Gesichtsausdruck bemerkt hatte.
Lass niemals zu, dass jemand dich weinen sieht!, hatte Leda sich eingeschärft und die Tränen zurückgeblinzelt. »Natürlich«, hatte sie mit fester Stimme hervorgepresst.
Irgendwann hatte Leda eine Art inneren Frieden in der Entziehungskur gefunden: nicht bei ihrem nutzlosen Psychoarzt, sondern in der Meditationsgruppe. Sie hatte fast jeden Morgen dort verbracht und im Schneidersitz die Mantras wiederholt, die Guru Vashmi anstimmte. Mögen meine Handlungen entschlossen sein. Ich bin mein größter Verbündeter. Ich bin mir genug. Gelegentlich hatte Leda die Augen geöffnet und kurz die anderen Mädchen durch den Lavendelrauch im Yogazelt gemustert. Sie hatten alle etwas Ruheloses, Gehetztes an sich gehabt, als wären sie hier zusammengetrieben worden und hätten zu viel Angst, wieder zu gehen. Ich bin nicht wie die, hatte Leda sich dann eingeredet. Sie hatte die Schultern gestrafft und die Augen wieder geschlossen. Sie brauchte die Drogen nicht, nicht so wie diese Mädchen.
Jetzt dauerte es nur noch ein paar Minuten, bis sie den Tower erreicht hatten. Plötzlich machte sich eine sorgenvolle Unruhe in ihrer Magengegend breit. War sie bereit dafür? Bereit, zurückzukehren und sich all dem zu stellen, was sie so aus der Bahn geworfen hatte?
Nein, nicht allem. Atlas war immer noch fort.
Mit geschlossenen Augen murmelte Leda ein paar Worte und signalisierte ihren Kontaktlinsen, wieder ihre Inbox zu öffnen. Sie hatte sie fast ununterbrochen abgehört, seit sie die Entzugsklinik heute Morgen verlassen hatte und wieder eine Verbindung aufbauen konnte. Dreitausend Nachrichten hatten sich angesammelt und strömten sogleich durch ihre Ohren, Einladungen und Videosignale, aneinandergereiht wie Musiknoten. Das auf sie einstürmende Interesse war seltsam beruhigend.
Am oberen Ende der langen Reihe war eine Nachricht von Avery. Wann bist du zurück?
Jeden Sommer wurde Leda von ihrer Familie zu einem Besuch »zu Hause« in Podnuk, Illinois, also mitten im Nirgendwo, gezwungen. »New York ist mein Zuhause«, protestierte Leda jedes Mal, aber ihre Eltern ignorierten das. Ehrlich gesagt verstand Leda nicht einmal, warum ihre Eltern unbedingt dorthin wollten. Wenn sie erreicht hätte, was ihre Eltern erreicht hatten – frischverheiratet von Danville nach New York zu ziehen, als der Tower noch im Bau gewesen war, und sich Stück für Stück nach oben zu arbeiten, bis sie es sich endlich hatten leisten können, in den begehrten oberen Stockwerken zu wohnen –, hätte sie nicht zurückgeblickt.
Dennoch hielten ihre Eltern daran fest, jedes Jahr in ihre Heimat zurückzukehren und bei Ledas und Jamies Großeltern in einem von jeglicher Technologie abgeschnittenen Haus zu übernachten, in dem es nur Sojabutter und Tiefkühlkost gab. Als Leda noch klein gewesen war, hatte es ihr dort eigentlich gefallen, es war wie ein Abenteuer gewesen. Doch als sie älter wurde, begann sie darum zu betteln, nicht mitkommen zu müssen. Es machte ihr keinen Spaß mehr, Zeit mit ihren Cousins und Cousinen zu verbringen – mit ihren Billigklamotten von der Stange und den gruseligen Pupillen ohne Kontaktlinsen. Aber egal wie sehr sie auch protestierte, sie hatte es nie geschafft, ihre Eltern umzustimmen. Bis auf dieses Jahr.
Komme gerade an!, antwortete Leda. Sie sprach die Nachricht laut aus und nickte, um sie zu verschicken. Ein Teil von ihr wusste, dass sie mit Avery über Silver Cove reden sollte. Sie hatten in der Klinik oft über Verantwortung und Vertrauen gesprochen und dass man Freunde um Hilfe bitten sollte. Aber allein bei dem Gedanken daran, Avery alles zu erzählen, klammerte sich Leda so fest an ihren Sitz, dass ihre Fingerknöchel weiß hervortraten. Sie konnte es nicht. Diese Schwäche würde sie ihrer perfekten besten Freundin gegenüber niemals zugeben. Natürlich würde sie mitfühlend reagieren, aber Leda wusste, dass ein kleiner Teil von Avery sie auch verurteilen, sie anders ansehen würde. Und damit würde Leda nicht zurechtkommen.
Avery kannte nur ein Bruchstück der Wahrheit: dass Leda begonnen hatte, gelegentlich Xenperheidren zu nehmen, vor allem vor Prüfungen, um ihr Denkvermögen zu schärfen … und dass sie mit Cord und Rick und dem Rest der Clique ein paarmal auch stärkere Sachen ausprobiert hatte. Aber Avery hatte keine Ahnung, wie schlimm es Anfang des Jahres geworden war, nachdem sie aus den Anden zurückgekehrt waren – und sie wusste definitiv nichts über diesen Sommer.
Inzwischen hatten sie den Tower erreicht. Der Helikopter taumelte für einen Moment wie betrunken vor dem Eingang der Hubschrauberlandehalle in der siebenhundertsten Etage. Trotz der Stabilisatoren schaukelte er im orkanartigen Wind, der um den Turm peitschte. Mit einem letzten Ruck nach vorn landete er im Inneren des Hangars. Leda hievte sich aus ihrem Sitz und kletterte hinter ihren Eltern aus dem Helikopter. Ihre Mom hatte bereits einen Anruf bekommen, es klang, als ginge es um irgendein Geschäft, das schlecht gelaufen war.
»Leda!« Ein blonder Wirbelwind sauste auf sie zu und schloss sie in die Arme.
»Avery …« Leda lächelte in das Haar ihrer Freundin und befreite sich sanft aus der Umarmung. Sie trat einen Schritt zurück und als sie aufsah – kam sie augenblicklich ins Stocken. Ihre frühere Unsicherheit wallte in ihr auf. Avery wiederzusehen war jedes Mal ein Schock. Leda versuchte, sich davon nicht aus der Fassung bringen zu lassen, aber manchmal konnte sie nur daran denken, wie unfair doch alles war. Avery hatte das perfekte Leben dort oben in ihrem Penthouse in der eintausendsten Etage. Musste sie wirklich auch noch perfekt sein? Wenn sie Avery neben deren Eltern sah, konnte sie kaum glauben, dass sie von der DNA der Fullers abstammte.
Irgendwie war es einfach zum Kotzen, die beste Freundin des Mädchens zu sein, das zu makellos war, um aus echten Genen entstanden zu sein. Leda dagegen war wahrscheinlich nach zu vielen Tequilas am Hochzeitstag ihrer Eltern gezeugt worden.
»Sollen wir von hier verschwinden?«, fragte Avery.
»Gern«, antwortete Leda. Sie würde alles für Avery tun, nur dass sie diesmal nicht wirklich überredet werden musste.
Avery wandte sich von ihr ab und umarmte Ledas Eltern. »Mr Cole! Mrs Cole! Willkommen zu Hause!«
Leda sah zu, wie sie lachten und Avery ebenfalls umarmten, sich öffneten wie Blüten im Sonnenlicht. Niemand konnte sich Averys Zauber entziehen.
»Darf ich Ihre Tochter kurz entführen?«, fragte Avery.
Ledas Eltern nickten.
»Danke! Zum Abendessen haben Sie sie zurück.« Avery hatte sich bereits bei Leda untergehakt und zog sie beharrlich in Richtung der Hauptstraße auf der siebenhundertsten Etage.
»Warte mal eine Sekunde«, sagte Leda. Neben Averys leuchtend rotem Rock und der bauchfreien Bluse wirkte Ledas Entziehungskur-Outfit – ein schlichtes graues T-Shirt und Jeans – absolut trostlos. »Ich möchte mich erst umziehen.«
»Ich dachte, wir gehen einfach nur in den Park.« Avery blinzelte rasch, ihre Pupillen huschten hin und her, während sie ein Hover-Taxi bestellte. »Ein paar der Mädchen hängen dort ab und alle wollen dich sehen. Ist das okay?«
»Na klar«, sagte Leda mechanisch und unterdrückte ihre Enttäuschung darüber, dass sie nicht unter sich bleiben würden.
Sie traten durch die Doppeltüren der Hubschrauberlandehalle auf die Hauptstraße, einen gewaltigen Verkehrsknotenpunkt, der sich über mehrere Cityblocks erstreckte. Die Decke über ihnen leuchtete in einem hellen Himmelblau. Für Leda war der Anblick genauso wunderschön wie der echte Himmel, den sie auf ihren Nachmittagsspaziergängen in Silver Cove gesehen hatte. Aber sie war auch nicht der Typ, dem die Schönheit der Natur etwas bedeutete. Schönheit war ein Wort, das sie für teuren Schmuck und Kleider und Averys Gesicht reserviert hatte.
»Also, erzähl mal!«, sagte Avery auf ihre direkte Art, als sie einen der Gehwege aus Karbongemisch betraten, die die silberfarbenen Hover-Bahnen säumten. Zylinderförmige Imbiss-Bots auf riesigen Rädern summten über die Straße, boten getrocknete Früchte und Kaffee an.
»Was?« Leda versuchte, sich zu konzentrieren. Hover-Taxis strömten wie ein Fischschwarm in gleichmäßigen Bewegungen die Straße zu ihrer Linken entlang und leuchteten grün oder rot, je nachdem ob sie frei oder besetzt waren. Instinktiv trat sie etwas näher an Avery heran.
»Illinois. War es so schrecklich wie immer?« Averys Blick wanderte in die Ferne. »Rufe Hover«, sagte sie leise und eins der Fahrzeuge scherte aus dem Schwarm aus.
»Du willst den ganzen Weg zum Park mit dem Hover fahren?«, erwiderte Leda, um Averys Frage auszuweichen, wobei sie versuchte, ganz normal zu klingen. Sie hatte völlig vergessen, wie voll es hier immer war – Eltern, die ihre Kinder hinter sich herzogen, Geschäftsleute, die mittels ihrer Kontaktlinsen laut telefonierten, Paare, die Händchen hielten. Nach der verordneten Ruhe während der Entziehungskur war Leda völlig überwältigt.
»Du bist zurück, das ist ein besonderer Anlass!«, rief Avery.
Leda atmete tief ein und lächelte, als das Hover-Taxi vor ihnen hielt. Es war ein schmaler Zweisitzer mit einer vornehmen eierschalenfarbenen Inneneinrichtung. Dank der magnetischen Antriebsleisten schwebte es ein paar Zentimeter über dem Boden. Avery setzte sich ihrer Freundin gegenüber, tippte ihr Ziel ein und schickte das Hover-Taxi los.
»Vielleicht musst du ja nächstes Jahr nicht mehr mit. Dann könnten wir zusammen verreisen«, fuhr Avery fort, während das Taxi in einen der senkrechten Gänge des Towers eintauchte. Die gelbe Beleuchtung an den Tunnelwänden ließ seltsame Muster über ihre Wangen tanzen.
»Vielleicht.« Leda zuckte mit den Schultern. Sie wollte das Thema wechseln. »Du bist übrigens irre braun. Von der Sonne in Florenz?«
»Monaco. Die besten Strände der Welt.«
»Aber nicht besser als der vor dem Haus deiner Grandma in Maine.« Nach ihrem ersten Highschooljahr hatten sie dort eine Woche verbracht, in der Sonne gelegen und an Grandmas Portwein genippt.
»Stimmt. Und in Monaco gab es auch keine süßen Rettungsschwimmer«, erwiderte Avery lachend.
Ihr Hover wurde langsamer, bog in das dreihundertsiebte Stockwerk ein und schwebte dann waagerecht weiter. Normalerweise galt es als bedenkliche »Talfahrt«, wenn man sich so weit nach unten wagte, aber Besuche im Central Park bildeten eine Ausnahme.
Als das Taxi vor dem nordnordöstlichen Parkeingang hielt, richtete Avery ihre tiefblauen Augen auf Leda, ihr Blick war plötzlich ernst. »Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich habe dich diesen Sommer vermisst.«
»Ich dich auch«, sagte Leda leise.
Sie folgte Avery in den Park, vorbei an dem berühmten Kirschbaum, der noch aus dem echten Central Park stammte. Ein paar Touristen lehnten am Zaun, der ihn umgab, machten Fotos und lasen die Geschichte des Baums auf der interaktiven Tafel daneben. Es gab keine weiteren Überbleibsel des ursprünglichen Parks, der unter dem Fundament des Towers begraben lag.
Sie gingen in Richtung Hügel, wo sie sich immer mit ihren Freundinnen trafen. Avery und Leda hatten diesen Ort in der siebten Klasse entdeckt und waren nach einigen Selbstversuchen zu dem Schluss gekommen, dass es der beste Platz war, um die UV-freien Strahlen der Solarlampen zu tanken. Während sie jetzt dorthin unterwegs waren, wechselte das Spektragras am Wegrand von Mintgrün in ein sanftes Lavendel. Ein Hologramm in Gestalt eines Cartoonzwergs rannte links von ihnen durch den Park, gefolgt von einer Horde kreischender Kinder.
»Avery!« Risha hatte sie als Erste entdeckt. Die anderen Mädchen, alle ausgestreckt auf bunten Strandtüchern, richteten sich auf und winkten.
»Und Leda! Seit wann bist du wieder zurück?«
Avery setzte sich in die Mitte der Gruppe und schob sich eine Haarsträhne hinters Ohr.
Leda nahm neben ihr Platz. »Gerade eben. Ich komme direkt aus dem Helikopter.« Sie holte die Vintage-Sonnenbrille ihrer Mutter aus der Tasche. Natürlich hätte sie auch den Verdunklungsmodus ihrer Kontaktlinsen aktivieren können, aber die Sonnenbrille war längst zu einem ihrer Markenzeichen geworden. Es hatte ihr schon immer gefallen, wie gut sie damit ihren Gesichtsausdruck verbergen konnte.
»Wo ist Eris?«, fragte sie. Sie vermisste sie zwar nicht besonders, aber normalerweise tauchte Eris immer auf, wenn es ums Bräunen ging.
»Wahrscheinlich ist sie Shoppen. Oder bei Cord«, antwortete Ming Jiaozu mit einem unterdrückt bitteren Tonfall.
Leda sagte nichts, denn sie war überrascht. In ihren Feeds hatte sie nichts über Eris und Cord gefunden, als sie heute Morgen nachgeschaut hatte. Andererseits war sie beziehungstechnisch bei Eris nie auf dem Laufenden, die fast mit der Hälfte der Jungs und Mädchen aus ihrer Klasse zusammen gewesen war oder zumindest rumgemacht hatte, mit einigen sogar mehr als einmal. Aber Eris war schon ewig mit Avery befreundet. Sie kam aus einer alten Geldadelsfamilie und konnte sich deshalb so ziemlich alles erlauben.
»Wie war dein Sommer, Leda?«, fuhr Ming fort. »Warst du wieder mit deiner Familie in Illinois?«
»Ja.«
»Es muss doch schrecklich gewesen sein, mitten im Nirgendwo festzusitzen.« Mings Stimme klang widerwärtig süß.
»Na ja, ich hab’s überlebt«, sagte Leda leichthin, denn sie wollte sich nicht provozieren lassen. Ming wusste, wie sehr Leda es hasste, über die Herkunft ihrer Eltern zu reden. Es erinnerte sie jedes Mal daran, dass sie nicht aus dieser Welt stammte wie der Rest von ihnen, sondern erst in der siebten Klasse aus MidTower zugezogen war.
»Was ist mit dir?«, fragte Leda. »Wie war es in Spanien? Hast du dich mit irgendwelchen netten Einheimischen angefreundet?«
»Nicht wirklich.«
»Komisch. In den Feeds sah es so aus, als hättest du ziemlich enge Freundschaften geschlossen.« In dem Massendownload auf ihrem Flug heute Morgen hatte Leda ein paar Schnappschüsse von Ming mit einem spanischen Jungen gesehen und sie hätte schwören können, dass zwischen ihnen etwas gelaufen war. Das hatten ihr die Körpersprache und die fehlenden Untertitel unter den Fotos verraten – und jetzt vor allem die plötzliche Röte, die an Mings Hals hinaufkroch.
Ming schwieg und Leda erlaubte sich ein kleines Lächeln. Wenn jemand sie blamieren wollte, musste er damit rechnen, am Ende selbst der Blamierte zu sein.
»Avery«, sagte Jess McClane und beugte sich vor, »hast du mit Zay Schluss gemacht? Ich bin ihm vorhin begegnet und er wirkte ganz schön deprimiert.«
»Ja«, erwiderte Avery langsam. »Ich meine, ich denke schon. Ich mag ihn, aber …« Sie brach lustlos ab.
»Oh mein Gott, Avery. Du solltest es wirklich einfach tun und es hinter dich bringen«, rief Jess. Die goldenen Armreifen an ihrem Handgelenk schimmerten im Licht der Solarlampen. »Worauf wartest du eigentlich? Oder vielleicht sollte ich sagen, auf wen wartest du eigentlich?«
»Hör auf, Jess! Du kannst doch gar nicht mitreden«, fuhr Leda dazwischen. Die anderen warfen Avery ständig solche Kommentare an den Kopf, weil es sonst nichts gab, was man wirklich an ihr kritisieren konnte. Aber es machte noch weniger Sinn, wenn Jess sich dazu äußerte, denn sie war selbst Jungfrau.
»Genau genommen kann ich das sehr wohl«, erwiderte Jess bedeutungsvoll.
Sofort brach ein regelrechter Kreisch-Chor los – »Warte, du und Patrick?« – »Wann?« – »Wo?« – und Jess grinste. Offensichtlich konnte sie es kaum erwarten, den anderen jedes Detail zu schildern.
Leda lehnte sich zurück und tat so, als würde sie zuhören. Soweit die anderen Mädchen wussten, war sie auch noch Jungfrau. Sie hatte niemandem die Wahrheit erzählt, nicht einmal Avery. Und das würde sie auch nie tun.
Es war im Januar passiert, auf dem alljährlichen Skiausflug nach Catyan. Die Fullers und die Andertons fuhren schon seit Jahren dorthin, und seit Leda und Avery so gute Freundinnen geworden waren, kamen auch die Coles mit. Die Anden galten als das beste noch verbliebene Skigebiet der Welt, selbst Colorado und die Alpen waren heutzutage fast ausschließlich auf Schneemaschinen angewiesen. Nur in Chile, auf den höchsten Gipfeln der Anden, lag noch genügend natürlicher Schnee für echten Skisport.
Am zweiten Tag hatten sie sich zum Drohnen-Abfahrtsski verabredet – Avery, Leda, Atlas, Jamie, Cord, sogar Cords älterer Bruder Brice. Sie ließen sich aus ihren Ski-Drohnen fallen, landeten im Puderschnee, rasten die Piste zwischen den Bäumen hinunter und hoben im letzten Moment die Arme, um sich wieder an ihren Drohnen festzuhalten, bevor sie vom Rand des Gletschers stürzen würden. Leda war auf den Skiern nicht so geübt wie die anderen, aber sie hatte vor der Abfahrt einen Tropfen Adrenalin geschluckt und fühlte sich ziemlich gut – fast so gut, als hätte sie den richtig tollen Stoff von ihrer Mom geklaut. Sie folgte Atlas durch die Bäume, gab ihr Bestes, durchzuhalten, und genoss den Wind, der sich in ihren Polydaunen-Skianzug krallte. Sie hörte nur das Zischen ihrer Skier im Schnee und darunter ein tiefes, hohles Geräusch der Leere. Ihr wurde plötzlich bewusst, dass sie mit dem Schicksal spielten, wie sie hier auf einem Gletscher durch die papierdünne Luft sausten, ganz nah am Rand des Himmels.
Und in diesem Moment ertönte Averys Schrei.
Alles was dann folgte, nahm Leda nur noch verschwommen wahr. Sie tastete in ihrem Handschuh nach dem roten Notfallknopf, mit dem sie ihre Ski-Drohne herbeirufen konnte, doch Avery war bereits ein paar Meter entfernt abgefangen worden. Ihr Bein stand in einem furchtbaren Winkel ab.
Als alle wieder in der Penthouse-Suite des Hotels angekommen waren, befand sich Avery bereits auf dem Heimflug. »Sie wird wieder gesund«, hatte Mr Fuller ihnen versichert. Ihr Knie müsste nur wieder gerichtet werden und er wollte, dass sich Fachleute in New York darum kümmerten. Leda wusste, was das bedeutete: Avery hatte nach der Operation bestimmt einen Termin bei Eris’ Dad, dem Schönheitschirurgen Everett Radson, der ihr Bein mit einem Mikrolaser bearbeiten würde. Gott bewahre, dass auch nur die kleinste Spur einer Narbe an ihrem perfekten Körper zurückblieb.
Später an diesem Abend saßen alle Jugendlichen auf der Dachterrasse im Whirlpool, reichten Flaschen mit Whiskey Cream herum, tranken auf Avery, die Anden und darauf, dass es wieder schneite. Als das Schneegestöber stärker wurde, gingen die anderen schließlich grummelnd ins Bett. Aber Leda blieb neben Atlas sitzen. Und auch Atlas hatte sich keinen Zentimeter bewegt.
Leda stand schon seit Jahren auf ihn, seit sie und Avery Freundinnen geworden waren und sie ihm zum ersten Mal in Averys Apartment begegnet war. Er war zu ihnen hereingeplatzt, als sie gerade Disneysongs gesungen hatten, und sie war vor Verlegenheit knallrot geworden. Leda hatte nie wirklich geglaubt, dass sie Chancen bei ihm hätte. Er war zwei Jahre älter und abgesehen davon Averys Bruder. Doch nachdem alle anderen aus dem Whirlpool geklettert waren, zögerte sie kurz und fragte sich, ob vielleicht, möglicherweise … In diesem Moment nahm sie überdeutlich wahr, wo ihr Knie Atlas unter Wasser berührte, was ein Prickeln an ihrer gesamten linken Seite verursachte.
»Möchtest du noch?«, murmelte er und reichte ihr die Flasche.
»Danke.« Leda zwang sich, nicht auf seine Wimpern zu starren, in denen sich Schneeflocken wie winzige, flüssige Sterne verfangen hatten, und nahm einen langen Schluck. Der Whiskeylikör schmeckte weich und süß wie ein Dessert, hinterließ jedoch einen brennenden Nachgeschmack. Ihr war leicht schwindelig, sie fühlte sich benommen von der Hitze des Wassers im Whirlpool und von Atlas’ Nähe. Vielleicht hatte sich der Tropfen Adrenalin noch nicht verflüchtigt, vielleicht war es auch nur die pure Aufregung, die sie mit einem Mal seltsam unbekümmert machte.
»Atlas«, sagte sie leise, und als er sie mit einer erhobenen Augenbraue ansah, beugte sie sich vor und küsste ihn.
Er zögerte einen Moment, dann küsste er sie zurück, streckte die Hände nach ihren dicken Locken aus, die mit Schnee bestäubt waren. Leda verlor völlig das Zeitgefühl. Irgendwann trug sie kein Bikinioberteil mehr und auch kein Höschen – na ja, sie hatte von Anfang an nicht viel Stoff auf der Haut gehabt – und Atlas flüsterte: »Bist du sicher?«
Leda nickte mit pochendem Herzen. Natürlich war sie sicher. Sie war sich noch nie einer Sache so sicher gewesen.
Am nächsten Morgen tänzelte sie regelrecht in die Küche. Ihr Haar war noch feucht vom Dampf des Whirlpools und die Erinnerung an Atlas’ Berührungen hatten sich so unauslöschlich in ihre Haut gebrannt wie ein Live-Tattoo. Aber er war fort.
Er hatte den ersten Flug zurück nach New York genommen. Um nach Avery zu sehen, erklärte sein Dad. Leda nickte gelassen, aber ihr war schlecht. Sie kannte die Wahrheit. Sie wusste, warum Atlas tatsächlich abgereist war. Er wollte ihr aus dem Weg gehen.
Na schön, dachte sie. Wut kochte in ihr hoch und verdeckte den schmerzhaften Verlust. Sie würde es ihm zeigen. Sie würde ihm beweisen, dass er ihr genauso egal war.
Nur, dass Leda nie die Chance dazu bekam. Atlas verschwand am Ende der Woche, noch bevor die Schule wieder losging, obwohl es das Frühlingssemester seines Abschlussjahrs war. Es gab eine kurze, hektische Suche nach ihm, die sich nur auf Averys Familie beschränkte und schon nach wenigen Stunden beendet war, nachdem seine Eltern herausgefunden hatten, dass es ihm gut ging.
Jetzt, mehrere Monate später, war Atlas’ Verschwinden nichts Neues mehr. Seine Eltern taten es in der Öffentlichkeit lachend als jugendlichen Leichtsinn ab. Leda hatte auf unzähligen Cocktailpartys gehört, wie sie behaupteten, er hätte eine Weile ausgesetzt, um die Welt zu bereisen, und dass es von Anfang an ihre Idee gewesen war. Das war ihre Version der Geschichte, an die sie sich krampfhaft klammerten, aber Avery hatte Leda die wahren Umstände erzählt. Die Fullers hatten keine Ahnung, wo Atlas war und wann – oder ob – er zurückkommen würde. Er rief Avery gelegentlich an, um sich wenigstens kurz zu melden, hielt seinen Aufenthaltsort aber immer geheim, obwohl er nach den Gesprächen sowieso jedes Mal weiterreiste.
Leda hatte Avery nie von der Nacht in den Anden erzählt. Sie wusste nicht, wie sie das Thema anschneiden sollte. Schließlich war Atlas ihretwegen verschwunden, und je länger sie es für sich behielt, desto mehr wurde es zu ihrem Geheimnis. Der Gedanke, dass der einzige Junge, für den sie je etwas empfunden hatte, buchstäblich weggelaufen war, nachdem er mit ihr geschlafen hatte, tat einfach zu weh. Leda versuchte, wütend zu bleiben. Es war sicherer, wütend zu sein, als sich verletzt zu fühlen. Doch selbst die Wut reichte nicht aus, um den Schmerz zum Schweigen zu bringen, der dumpf in ihr pochte, wenn sie an Atlas dachte.
Und genau aus diesem Grund war sie in der Entzugsklinik gelandet.
»Leda, kommst du nun mit?«
Averys Stimme riss sie aus ihren Gedanken. Leda blinzelte.
»Ins Büro meines Dads, um etwas zu holen«, fügte Avery mit bedeutungsvollem Blick hinzu. Das Büro von Averys Vater war eine Ausrede, die sie seit Jahren benutzten, wenn eine von ihnen gehen wollte, egal, mit wem sie gerade zusammen waren.
»Hat dein Dad keine Bots für Botengänge?«, fragte Ming.
Leda überging die Frage einfach. »Natürlich«, sagte sie zu Avery, stand auf und klopfte sich ein paar Grashalme von der Jeans. »Lass uns gehen.«
Sie winkten zum Abschied und liefen zur nächstgelegenen Fahrstuhlhaltestelle, wo die Expresslinie C durch eine senkrechte Säule nach oben schoss. Die Wände waren transparent, sodass Leda im Inneren eine Gruppe älterer Frauen sehen konnte, die die Köpfe zusammengesteckt hatten und sich angeregt unterhielten, während ein Kleinkind neben seiner Mutter in der Nase bohrte.
»Atlas hat sich gestern Abend bei mir gemeldet«, wisperte Avery, als sie die Wartefläche in Richtung UpTower erreicht hatten.
Leda erstarrte. Sie wusste, dass Avery ihren Eltern schon lange nicht mehr von Atlas’ Anrufen erzählte. Sie meinte, sie regten sich nur darüber auf. Dennoch war es irgendwie seltsam, dass Avery mit niemandem darüber sprach außer mit Leda.
Andererseits hatte Avery schon früh eine merkwürdige Art von Beschützerinstinkt für Atlas entwickelt. Wenn er mit jemandem ausgegangen war, hatte sie sich stets höflich verhalten, aber auch ein wenig distanziert – als wäre sie nicht ganz damit einverstanden oder als würde sie es für einen Fehler halten. Ob das etwas damit zu tun hatte, dass Atlas adoptiert war? Vielleicht machte sich Avery insgeheim Sorgen, dass er wegen seiner Vergangenheit verletzlicher war, und hatte deshalb das Gefühl, ihn beschützen zu müssen.
»Wirklich?«, fragte Leda mit möglichst ruhiger Stimme. »Hast du mitbekommen, wo er war?«
»Ich habe im Hintergrund laute Stimmen gehört. Wahrscheinlich war er irgendwo in einer Bar.« Avery zuckte mit den Schultern. »Du weißt doch, wie Atlas ist.«
Nein, das weiß ich nicht. Wenn sie Atlas verstehen würde, könnte sie vielleicht auch ihre eigenen verwirrenden Gefühle verstehen. Sie drückte Averys Arm.
»Egal«, fuhr Avery mit gezwungener Heiterkeit fort, »er kommt sicher bald nach Hause, wenn er endlich so weit ist, stimmt’s?« Sie sah Leda fragend an.
Für einen Moment traf es Leda wie ein Schlag, wie sehr Avery sie an Atlas erinnerte. Sie waren zwar nicht blutsverwandt, aber sie hatten dennoch dieselbe glühende Ausstrahlung. Wenn sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf einen lenkten, wurde man geblendet, als würde man in die Sonne blicken.
Leda trat unbehaglich von einem Fuß auf den anderen. »Natürlich«, sagte sie. »Er kommt sicher bald zurück.«
Sie betete, dass das nicht passierte, während sie gleichzeitig das Gegenteil hoffte.
Rylin
Am folgenden Abend stand Rylin Myers vor der Tür ihrer Wohnung und kämpfte damit, ihren ID-Ring vor den Scanner zu halten, während sie eine volle Einkaufstüte unter einen Arm geklemmt hatte und in der anderen Hand einen halb vollen Energydrink hielt. Natürlich wäre das kein Problem, wenn sie einen Netzhautscanner und eine dieser schillernden computergesteuerten Kontaktlinsen hätte, die die Kids in den oberen Etagen trugen, dachte sie, während sie ohne Hemmungen gegen die Tür trat. Doch hier unten im zweiunddreißigsten Stockwerk, wo Rylin wohnte, konnte sich niemand so etwas leisten.
Als sie gerade noch einmal mit dem Bein ausholte, um gegen die Tür zu treten, wurde diese von innen geöffnet.
»Na endlich«, brummte Rylin und schob sich an ihrer vierzehnjährigen Schwester vorbei.
»Wenn du deinen ID-Ring reparieren lassen würdest, wie ich es dir andauernd sage, wäre das nicht passiert«, stichelte Chrissa. »Andererseits, wie würdest du das erklären? ›Tut mir leid, Officers, ich benutze meinen ID-Ring zum Öffnen von Bierflaschen und jetzt funktioniert er nicht mehr‹?«
Rylin ignorierte Chrissa einfach. Sie nahm einen großen Schluck von ihrem Energydrink, hievte die Einkaufstüte auf den Küchentresen und warf ihrer Schwester eine Schachtel Gemüsereis zu. »Kannst du das wegräumen? Ich bin spät dran.« Das Intrasys – Intraflur-Transitsystem – war schon wieder ausgefallen. Deshalb war sie gezwungen gewesen, die ganzen zwanzig Blocks von der Fahrstuhlhaltestelle bis zu ihrer Wohnung zu laufen.
Chrissa blickte auf. »Du gehst heute Abend weg?« Sie hatte die weichen koreanischen Gesichtszüge, die feine Nase und die hoch geschwungenen Augenbrauen ihrer Mom geerbt, während Rylin mit ihrem kantigen Kinn eher nach ihrem Dad kam. Trotzdem hatten beide die hellgrünen Augen ihrer Mutter, die im Kontrast zu ihrer Haut wie Beryll-Edelsteine leuchteten.
»Ähm, ja, es ist Samstag«, erwiderte Rylin, wobei sie absichtlich überging, worauf ihre Schwester anspielte. Sie wollte nicht darüber reden, was heute vor genau einem Jahr geschehen war – als ihre Mom gestorben und ihre ganze Welt zusammengebrochen war. Sie würde nie vergessen, wie sie sich an diesem Abend weinend in den Armen gelegen hatten, vor ihnen die Mitarbeiter des Jugendamts, die ihnen von dem Pflegekinderprogramm erzählten.
Rylin hatte eine Weile zugehört, während Chrissa den Kopf an ihre Schulter gelehnt und weitergeschluchzt hatte. Ihre Schwester war klug, richtig klug, und so gut im Volleyball, dass sie eine echte Chance auf ein Collegestipendium hatte. Doch Rylin wusste genug über Pflegefamilien, um sich ausmalen zu können, was dann mit ihnen passieren würde. Insbesondere mit Chrissa.
Sie würde alles tun, damit sie und ihre Schwester zusammenbleiben konnten, egal, was es sie kosten würde.
Gleich am nächsten Tag war sie zum nächstgelegenen Familiengericht gegangen und hatte sich als legal erwachsen erklären lassen, damit sie ihrem schrecklichen Job an der Monorail-Station ab sofort ganztägig nachgehen konnte. Was hätte sie sonst für eine Wahl gehabt? Sie kamen schon so kaum über die Runden – Rylin hatte gerade eine weitere Mahnung von ihrem Vermieter erhalten. Sie waren immer mindestens einen Monat mit der Miete im Verzug. Ganz zu schweigen von all den Krankenhausrechnungen ihrer Mom. Rylin hatte während des ganzen letzten Jahres versucht, alles abzubezahlen, doch durch die hohen Zinsen begann der Schuldenberg eher noch zu wachsen. Manchmal hatte sie das Gefühl, dass sie nie davon loskommen würde.
Das war jetzt ihr Leben und es würde sich in naher Zukunft nicht ändern.
»Rylin … bitte.«
»Ich bin echt schon zu spät.« Rylin zog sich in ihren Bereich des winzigen Schlafzimmers zurück. Sie dachte darüber nach, was sie anziehen sollte und dass sie ganze sechsunddreißig Stunden nicht zur Arbeit musste. Sie tat alles, um sich von dem vorwurfsvollen Blick ihrer Schwester abzulenken, deren grüne Augen sie schmerzvoll an ihre Mom erinnerten.
Rylin und ihr Freund Hiral gingen die Stufen am Ausgang 12 des Towers hinunter.
»Da sind sie«, murmelte Rylin und hob eine Hand gegen das blendende Licht. Ihre Freunde lungerten an ihrem üblichen Treffpunkt herum, einer von der Sonne aufgeheizten Metallbank zwischen der 127sten Straße und der Morningside Avenue.
Sie warf Hiral einen kurzen Blick zu. »Bist du sicher, dass du nichts dabeihast?«, fragte sie noch einmal. Sie war nicht gerade froh darüber, dass Hiral jetzt ein Dealer war – zuerst hatte er nur ihre Freunde beliefert, inzwischen verkaufte er auch im größeren Stil –, aber es war eine lange Woche gewesen und sie war immer noch genervt von dem Gespräch mit Chrissa. Sie konnte wirklich einen Kick vertragen, Relaxans oder einen Zug aus der Halluci-Pfeife, irgendetwas, das die Gedanken zur Ruhe brachte, die ihr endlos durch den Kopf schwirrten.
Hiral schüttelte den Kopf. »Tut mir leid. Hab diese Woche meinen ganzen Vorrat vertickt.« Er sah sie an. »Ist alles okay?«
Rylin schwieg. Hiral griff nach ihrer Hand und sie ließ es zu. Seine Handfläche war ganz rau von der Arbeit und er hatte schwarze Ränder unter den Fingernägeln. Hiral hatte im letzten Jahr die Schule geschmissen, um als Lifty zu arbeiten, die die riesigen Fahrstühle des Towers reparierten. Er verbrachte seine Tage in Hunderten Metern Höhe, wie eine menschliche Spinne.
»Ry!«, rief ihre beste Freundin Lux und kam auf sie zugestürmt. Ihr in spitze Fransen geschnittenes Haar war diese Woche aschblond. »Da bist du ja! Ich hatte schon befürchtet, du würdest nicht kommen.«
»Sorry. Wurde aufgehalten«, entschuldigte sich Rylin.
Andrés schnaubte. »Brauchtest wohl einen kleinen Anstoß vor dem Konzert, was?« Er machte eine dreckige Geste.
Lux verdrehte die Augen und umarmte Rylin. »Wie fühlst du dich?«, murmelte sie.
»Ganz gut.« Rylin wusste nicht, was sie sonst sagen sollte. Sie war verwirrt und dankbar, dass Lux noch wusste, welcher Tag heute war, ärgerte sich aber auch ein bisschen, weil sie schon wieder daran erinnert wurde. Sie ertappte sich dabei, wie sie an der alten Halskette ihrer Mom herumspielte, und ließ sie schnell los. Eigentlich war sie genau aus dem Gegenteil hergekommen – um nicht an ihre Mom denken zu müssen.
Rylin schüttelte den Kopf und ließ den Blick über den Rest der Clique wandern. Andrés lehnte an der Bank und trug trotz der Hitze stur seine Lederjacke. Hiral hatte sich neben ihn gestellt, seine bronzefarbene Haut schimmerte in der untergehenden Sonne. Hinter der Bank stand noch Indigo. Sie trug schwindelerregend hohe Stiefel und eine Bluse, die sie notdürftig in ein Kleid verwandelt hatte.
»Wo ist V?«, fragte Rylin.
»Spaß besorgen. Oder wolltest du uns heute etwa welchen mitbringen?«, erwiderte Indigo sarkastisch.
»Ich mache nur mit, danke«, antwortete Rylin.
Indigo verdrehte die Augen und wandte sich wieder ihrem Tablet zu.
Natürlich hatte Rylin schon eine Menge illegaler Drogen genommen – genau wie alle anderen hier –, aber zwischen Konsumieren und Verkaufen zog sie nach wie vor eine klare Grenze. Ein paar rauchende Teenager kümmerten niemanden, mit Dealern ging das Gesetz dagegen härter um. Wenn Rylin im Gefängnis landete, würde man Chrissa sofort in das Pflegekinderprogramm abschieben. Das durfte sie nicht riskieren.
Andrés sah von seinem Tablet auf. »V will sich dort mit uns treffen. Lasst uns gehen.«
Ein glühender Windstoß wirbelte ein paar Müllreste über den Fußweg. Rylin stieg darüber hinweg und nahm einen tiefen, belebenden Atemzug. Die Luft hier draußen mochte zwar heiß sein, aber wenigstens war sie nicht wiederaufbereitet und sauerstoffangereichert wie im Tower.
Hiral bückte sich bereits neben der Wand des Towers, schob eine Messerklinge unter die Kante einer Stahlplatte und zog sie auf.
»Die Luft ist rein«, sagte er leise.
Als Rylin durch die Öffnung kletterte, berührten sich kurz ihre Hände und sie wechselten einen Blick. Dann stieg Rylin in den Underground Club hinab.
Die Geräusche von draußen verschwanden sofort und wurden von leisem Stimmengewirr, aufgeputschtem Gelächter und dem Rauschen der Ventilatoren ersetzt. Jetzt befanden sie sich unterhalb der ersten Etage des Towers, in der Unterwelt – einem unheimlichen, dunklen Ort aus Rohren und Stahlträgern. Rylin und Lux gingen langsam durch die Schatten und nickten im Vorbeigehen den anderen Grüppchen zu. Ein paar Leute reichten eine mattrosa schimmernde Halluci-Pfeife im Kreis herum. Andere hatten sich, nur noch halb bekleidet, auf einem Stapel Kissen ausgestreckt und begannen offensichtlich gerade mit einer Oxyto-Orgie.
Rylin sah die Maschinenraumtür verräterisch aufleuchten und lief ein wenig schneller.
»Ihr könnt alle mal herkommen und mir danken«, kam eine Stimme aus den Schatten. Rylin stolperte fast vor Schreck. V.
Er war nicht so groß wie Andrés, aber er wog mindestens zwanzig Kilo mehr, und das war alles Muskelmasse. Seine breiten Schultern und Arme waren vollständig von Live-Tattoos bedeckt, die in einem unaufhörlich wirbelnden Durcheinander über seinen Körper tanzten. Sie bildeten Formen, brachen wieder auseinander und vereinten sich irgendwo neu. Rylin zuckte bei der Vorstellung zusammen, sich so viel Haut tätowieren zu lassen.
»Okay, Leute.« V griff in seine Tasche und holte einen Stapel goldglänzender Pflaster hervor. Jedes hatte die Größe von Rylins Daumennagel. »Wer hat Bock auf Communals?«
»Heilige Scheiße!«, rief Lux lachend. »Wo hast du die denn aufgetrieben?«
»Geil, Alter!« Hiral gab Andrés einen High Five.
»Im Ernst?«, fragte Rylin in die Feierlaune hinein. Sie mochte keine Communals. Sie lösten einen Gruppenrausch aus, der sich anfühlte, als würde man in die anderen eindringen, als hätte man Sex mit einem Haufen Fremder. Das Schlimmste daran war, dass man keine Kontrolle über den eigenen Rauschzustand hatte, weil man sich den anderen vollständig auslieferte.
»Ich dachte, wir rauchen heute Abend was zusammen«, sagte sie. Sie hatte sogar ihre Halluci-Pfeife mitgebracht, ein kleines kompaktes Röhrchen, das man fast für alles verwenden konnte – Darklights, Crispies und natürlich das halluzinogene Gras, für das die Pfeife eigentlich gedacht war.
»Schiss, Myers?«, fragte V herausfordernd.
»Ich habe keinen Schiss.« Rylin baute sich zu ihrer vollen Größe auf und starrte V an. »Ich wollte nur etwas anderes machen.«
Ihr Tablet vibrierte. Sie sah nach und fand eine Nachricht von Chrissa. Ich habe Moms Bratapfelstücke gemacht, schrieb sie. Falls du nach Hause kommen möchtest!
V musterte Rylin immer noch herausfordernd.
»Egal«, sagte sie leise. »Warum zur Hölle nicht?« Sie riss V ein Pflaster aus der Hand und klatschte es sich auf die Innenseite ihres Arms, direkt in die Armbeuge, wo die Vene gut zu sehen war.
»Genau so hatte ich mir das vorgestellt«, sagte V, während die anderen nun ebenfalls ungeduldig nach den Pflasterstückchen griffen.
Als sie den Maschinenraum betraten, hörte Rylin plötzlich nur noch elektronische Musik. Wütend dröhnte der Bass in ihrem Schädel und löschte jeden anderen Gedanken aus. Lux griff nach ihrem Arm, begann hysterisch herumzuspringen und schrie etwas Unverständliches.
»Seid ihr bereit für die Party?!«, rief der DJ, der auf einer Tonne mit Kühlflüssigkeit stand. Ein Verstärker ließ seine Stimme durch den ganzen Maschinenraum hallen. Die aufgeheizte Menge aus dicht gedrängten Körpern brach in Kreischen aus.
»Alles klar!«, brüllte der DJ. »Wenn ihr ein Goldenes habt, klebt es jetzt auf. Ich bin DJ Lowy und ich nehme euch mit auf den wahnsinnigsten Trip eures Lebens.«
Das gedämpfte Licht spiegelte sich in einem Meer von goldenen Communal-Pflastern. Fast jeder hier hatte eins. Das würde heftig werden, dachte Rylin.
»Drei …«, fing Lowy rückwärts an zu zählen.
Lux stieß ein ungeduldiges Lachen aus und sprang noch höher, wobei sie versuchte, über die Menge hinwegzusehen. Rylin blickte kurz zu V hinüber. Die Tattoos um das Pflaster auf seinem Arm bewegten sich sogar noch wilder als sonst, als wüsste seine Haut, was gleich abgehen würde.
»Zwei …«
Der größte Teil der Meute zählte mit. Hiral stellte sich hinter Rylin, legte die Arme um ihre Taille und das Kinn auf ihre Schulter. Sie lehnte sich mit dem Rücken an ihn und schloss die Augen. Gleich wurden die Communals aktiviert.
»Eins!«, hallte der Schrei durch den Raum. Lowy griff nach dem Tablet, das vor ihm schwebte und schaltete den elektromagnetischen Impuls ein, der auf die Frequenz der Communals eingestellt war. Augenblicklich setzten alle Pflaster im Raum ihre Substanzen frei, die in den Blutkreislauf ihrer Träger eindrangen. Der ultimative synchronisierte Gruppenrausch.
Die Musik wurde noch lauter, Rylin warf die Arme in die Luft und genoss das laute, scheinbar endlose Kreischen. Sie spürte regelrecht, wie sich die Stoffe in ihrem Körper verteilten und die Kontrolle über ihr Nervensystem übernahmen. Die Welt war nur noch auf die Musik ausgerichtet, alles – die blinkenden Lichter an der Decke, ihre Atemzüge, ihr Herzschlag, der Herzschlag aller anderen – war perfekt auf den tiefen, eindringlichen Puls der Bässe abgestimmt.
Ist das nicht geil?, formte Lux mit den Lippen, zumindest schien sie das sagen zu wollen, Rylin war sich nicht ganz sicher. Sie hatte bereits den Zugriff auf ihre Gedanken verloren. Chrissa und die Textnachricht spielten keine Rolle mehr. Ihr Job und ihr Boss, das Arschloch, spielten keine Rolle mehr. Nichts war mehr wichtig. Es zählte nur noch dieser Moment. Sie fühlte sich unbesiegbar, unantastbar, als könnte sie für immer tanzen und für immer jung und elektrisierend und lebendig sein.
Lichter. Eine Flasche mit etwas Hochprozentigem wurde herumgereicht. Sie nahm einen Schluck, ohne zu schmecken, was es war. Eine Berührung an ihrer Hüfte. Hiral, dachte sie und zog seine Hand mit einer einladenden Geste noch fester um sich. Doch dann entdeckte sie Hiral plötzlich ein paar Reihen weiter vorn. Er und Andrés sprangen in die Höhe und stießen in der Luft gegeneinander. Rylin wirbelte herum und sah Vs Gesicht aus der Dunkelheit auftauchen. Er hielt ein weiteres Goldpflaster in der Hand und hatte vielsagend eine Augenbraue hochgezogen. Rylin schüttelte den Kopf. Sie wusste nicht mal, wie sie ihm das erste Pflaster bezahlen sollte.
Doch V zog bereits die Schutzfolie an der Rückseite ab. »Kostet nichts«, flüsterte er ihr ins Ohr, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Oder hatte sie laut gedacht? Dann strich er ihr die Haare aus dem Nacken. »Kleines Geheimnis: Je näher es am Gehirn sitzt, desto schneller wirkt es.«
Rylin schloss benommen die Augen, während sie von der zweiten Drogenwelle überflutet wurde. Es war ein rasiermesserscharfer Rausch, der all ihre Nervenbahnen in Flammen setzte. Sie tanzte und schwebte dabei irgendwie, bis sie ein Vibrieren in ihrer Hosentasche wahrnahm. Sie ignorierte es, sprang und bewegte sich weiter zur Musik, aber da vibrierte es wieder, bis sie nach und nach in ihren unbeholfenen, physischen Körper zurückgezerrt wurde. Es dauerte eine Weile bis sie ihr Tablet umständlich aus der Tasche gezogen hatte.
»Hallo?«, keuchte Rylin. Sie bekam nur stoßweise Luft, weil ihre Atmung nicht mehr auf die Musik abgestimmt war.
»Rylin Myers?«
»Was zum … wer ist da?« Sie konnte kaum etwas verstehen und wurde von der Menge vor- und zurückgestoßen.
Es entstand eine Pause, als wäre der Anrufer verblüfft von ihrer Frage. »Cord Anderton«, sagte er schließlich. Rylin blinzelte erschrocken. Bevor ihre Mom krank geworden war, hatte sie als Hausangestellte für die Andertons gearbeitet. Langsam wurde Rylin bewusst, dass sie die Stimme von den wenigen Malen kannte, die sie dort gewesen war. Aber warum zum Teufel rief Cord Anderton sie an?
»Also, kannst du nun herkommen und auf meiner Party aushelfen?«
»Ich kann nicht … wovon redest du?« Sie versuchte, die Musik zu übertönen, aber ihre Stimme klang eher wie ein Krächzen.
»Ich habe dir eine Nachricht geschickt. Ich schmeiße heute Abend eine Party.« Er sprach schnell und klang ungeduldig. »Ich brauche hier jemanden – um alles sauber zu halten, den Caterern zur Hand zu gehen, der ganze Kram, den deine Mom immer erledigt hat.«
Als er ihre Mom erwähnte, zuckte Rylin zusammen, aber natürlich konnte er das nicht sehen.
»Die Haushaltshilfe, die sonst immer kommt, hat in letzter Minute abgesagt. Aber dann habe ich mich an dich erinnert und deinen Kontakt herausgesucht. Willst du den Job oder nicht?«
Rylin wischte sich eine Schweißperle von der Augenbraue. Für wen hielt sich dieser Kerl, dass er sie einfach so an einem Samstagabend herbeibeorderte? Sie öffnete den Mund, um dem reichen Pisser zu sagen, dass er sich den Job direkt in seinen –
»Hab ich ganz vergessen«, fügte Cord in diesem Moment hinzu, »es gibt zweihundert Nanos.«
Rylin würgte die Worte hinunter. Zweihundert Nanodollar für nur eine Nacht, in der sie es mit ein paar betrunkenen reichen Kids aushalten musste?
»Wie schnell brauchst du mich?«
»Oh, vor einer halben Stunde.«
»Ich bin unterwegs«, sagte sie, obwohl sich der Raum immer noch um sie drehte. »Aber –«
»Großartig.« Damit beendete Cord das Gespräch.
Mit übermenschlicher Anstrengung riss Rylin zuerst das Pflaster von ihrem Arm und dann das andere von ihrem Nacken, wobei sie heftig zusammenzuckte. Sie warf noch einen kurzen Blick zurück zu den anderen – Hiral tanzte, ohne etwas um sich herum wahrzunehmen, Lux hatte die Arme um einen Fremden geschlungen und ihre Zunge in seinen Hals gesteckt, Indigo saß auf Andrés Schultern. V beobachtete sie immer noch, aber Rylin verabschiedete sich nicht. Sie trat einfach in die stickige Abendhitze hinaus und ließ die benutzten Goldpflaster fallen, die langsam hinter ihr zu Boden segelten.
Eris
Wütend auf das penetrante Klingeln der Mikroantennen in ihren Ohren, vergrub Eris Dodd-Radson den Kopf noch tiefer unter ihrem flauschigen Seidenkissen.
»Fünf Minuten noch«, brummte sie. Das Klingeln hörte nicht auf. »Ich sagte Schlummerfunktion!«, schimpfte sie, bevor ihr klar wurde, dass das gar nicht ihr Wecker war. Es war Averys Klingelton, den Eris vor langer Zeit auf volle Lautstärke eingestellt hatte, damit sie keinen ihrer Anrufe verpasste, auch wenn sie schlief.
»Anruf annehmen«, murmelte sie.
»Bist du schon unterwegs?«, dröhnte Averys Stimme in ihrem Ohr. Sie sprach lauter als gewöhnlich, um den Partylärm zu übertönen. Eris registrierte kurz die Uhrzeit, die in pinken Zahlen am linken unteren Rand ihres Blickfelds leuchtete. Cords Party hatte vor einer halben Stunde begonnen und sie lag immer noch im Bett und hatte keine Ahnung, was sie anziehen sollte.
»Na klar.« Während sie sich einen Weg durch achtlos hingeworfene Klamotten und verstreut herumliegende Kissen zu ihrem Wandschrank bahnte, schlüpfte sie gleichzeitig aus ihrem übergroßen T-Shirt. »Ich musste nur – autsch!«, schrie sie auf und umklammerte ihren Zeh, den sie sich gerade gestoßen hatte.
»Oh mein Gott, du bist noch zu Hause!«, hielt Avery ihr vor, aber sie lachte dabei. »Was ist passiert? Hast du wieder deinen Schönheitsschlaf gehalten und verpennt?«
»Ich lasse alle anderen nur gern warten, damit sie sich noch mehr freuen, mich zu sehen«, antwortete Eris.
»Und mit ›alle anderen‹ meinst du Cord.«
»Nein, ich meine alle anderen. Insbesondere dich, Avery«, sagte Eris. »Hab nur nicht zu viel Spaß ohne mich, okay?«
»Versprochen. Und du flickerst mir, wenn du unterwegs bist, ja?« Damit beendete Avery das Gespräch.
Eris gab diesmal ihrem Dad die Schuld. In ein paar Wochen wurde sie achtzehn und heute waren sie bei ihrem Familienanwalt gewesen, um die Formalitäten für ihren Treuhandfonds zu erledigen. Es war unglaublich langweilig gewesen. Sie musste in Anwesenheit eines Zeugen unzählige Dokumente unterschreiben und einen Drogen- und DNA-Test machen. Sie hatte nicht mal alles verstanden. Sie wusste nur, wenn sie die Papiere unterschrieb, wäre sie eines Tages reich.
Eris’ Dad stammte aus einem alten Geldadelsgeschlecht – seine Familie hatte die magnetische Abstoßungstechnologie entwickelt, die die Hovercrafts in der Luft hielt. Everett hatte das bereits riesige Vermögen sogar noch vermehrt, denn er war der weltweit renommierteste Schönheitschirurg geworden. Die einzigen Fehler, die er je begangen hatte, waren zwei kostspielige Scheidungen, bevor er schließlich Eris’ Mom kennenlernte. Er war damals vierzig gewesen und sie ein fünfundzwanzigjähriges Model. Er redete nie über die anderen beiden Ehen, und weil daraus keine Kinder hervorgegangen waren, fragte Eris auch nicht nach. Um ehrlich zu sein, dachte sie nicht besonders gern daran.
Sie betrat ihren Wandschrank und zeichnete mit dem Zeigefinger einen Kreis an die verspiegelte Wand, die sich daraufhin in einen Touchscreen verwandelte, auf dem der gesamte Inhalt ihres Kleiderschranks aufleuchtete. Cord warf jedes Jahr eine Back-to-School-Kostümparty und jedes Jahr gab es insgeheim einen erbitterten Wettkampf um die beste Verkleidung. Seufzend ging Eris die verschiedenen Möglichkeiten durch: das goldfarbene Flapper-Kleid, der unechte Pelzhut, den sie von ihrer Mom hatte, das sexy, paillettenbesetzte pinkfarbene Kleid, das sie zu Halloween getragen hatte. Nichts davon schien das Richtige zu sein.
Scheiß drauf!, dachte sie schließlich. Warum suchte sie überhaupt nach einem Kostüm? Ohne Verkleidung würde sie viel mehr auffallen.
»Das schwarze Alicia-Top«, befahl sie ihrem Schrank, der das Teil über die Ausgabeklappe auf den Boden spuckte. Eris zog das Top über ihren Spitzen-BH, stieg in ihre Lieblingswildlederhose, in der ihr Hintern fantastisch aussah, und schlang ein paar Silberreifen um ihre Oberarme. Sie löste ihren Pferdeschwanz und ihr rotblondes Haar fiel wild über ihre Schultern.
Sie biss sich auf die Unterlippe, ließ sich vor ihrem Schminktisch nieder und legte die Hände auf die beiden Elektroimpulsgeber an ihrem Haarstyler. »Glatt«, ordnete sie an, schloss die Augen und entspannte sich.
Ein Prickeln breitete sich von den Handflächen über die Arme bis zu ihrer Kopfhaut aus, während das Gerät sie mit Stromstößen bearbeitete. Die anderen Mädchen in der Schule beschwerten sich immer über den Styler, aber Eris genoss insgeheim das heiße, reine, fast schmerzhafte Gefühl, mit dem ihre Nervenenden in Brand gesetzt wurden. Als sie aufsah, fielen ihre Haare glatt um ihr Gesicht. Sie tippte auf den Bildschirm an ihrem Schminktisch und schloss erneut die Augen, bevor sie von einem feinen Make-up-Spray eingenebelt wurde. Als sie diesmal wieder in den Spiegel blickte, wurden die außergewöhnlichen und faszinierenden bernsteinfarbenen Flecken in ihrer Iris von feinem Eyeliner noch hervorgehoben, während ein leichtes Rot ihre Wangenknochen sanfter erscheinen ließ und die Sommersprossen an ihrer Nase betonte. Aber irgendetwas fehlte noch.
Ohne lange zu überlegen, lief Eris durch das dunkle Schlafzimmer ihrer Eltern und betrat den Wandschrank ihrer Mutter. Sie tastete nach dem Schmucksafe und tippte den Sicherheitscode ein, den sie schon mit zehn Jahren herausbekommen hatte. Sie griff an einer farbenfrohen Reihe aus Edelsteinen und einem Band dicker schwarzer Perlen vorbei nach den Buntglasohrringen ihrer Mom. Sie bestanden aus seltenem, antikem Glas – kein Flexiglas, sondern ein Glas, das tatsächlich zersplittern konnte.