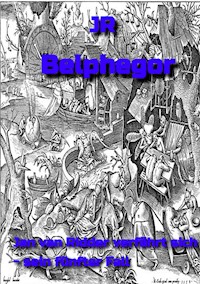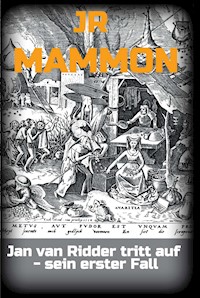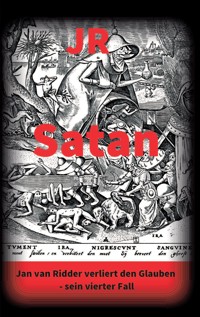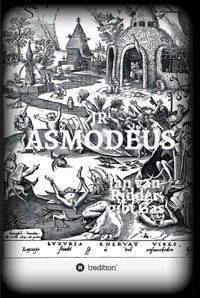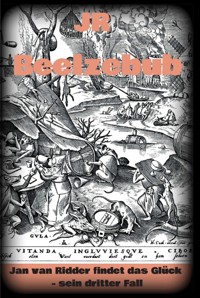
Beelzebub Kriminalroman Rüstungsskandal Bundeswehr Bonn Koblenz Leipzig Berlin Tübingen E-Book
JR JR
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jan van Ridder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Am Bonner Rheinufer wird vor Jan van Ridders Augen ein Bundeswehrangehöriger aus dem Hinterhalt erschossen. Jan selbst entgeht nur knapp dem Attentäter. Der Mitarbeiter der Bundewehr kann Jan vorher noch einen USB-Stick zustecken. Die Datensammlung enthält hochbrisante Insiderinformationen, die auf einen Rüstungsskandal immensen Ausmaßes hindeuten. Und es wird von Morden berichtet, die zur Vertuschung des Skandals verübt wurden. Jan van Ridder, der ehemalige IT-Vertriebsmanager, Spezialist für die öffentliche Verwaltung und Bundeswehr und inzwischen selbständiger Berater, wird widerwillig in den Fall hinein gezogen. In seinem dritten Fall begibt sich der sympathisch authentische Bonner Hobby-Ermittler Jan van Ridder auf eine sehr persönliche Reise: eine Achterbahnfahrt zwischen Gewaltverbrechen und undurchsichtiger Interessen, nagendem Zweifel und Glücksmomenten voller Liebe. Jan wird zum Spielball mächtiger Gegenspieler, die auch vor Morden nicht zurückschrecken. Ein rasanter Politthriller, der den Leser in die verschlossene Welt des industriell-militärischen Rüstungssektors und seine enge Verflechtung mit der Bundeswehr und der Politik entführt. In Zeiten zahlreicher Rüstungsskandale, steigender deutscher Waffenexporte und der weltweiten Bedrohungslage durch Terrorismus ist die Handlung top aktuell und nah an der Realität. Gleichzeitig durchzogen von Momenten zarter Verliebtheit, unsicherer Anbahnung zwischen Mann und Frau und rauschhaften Glückszuständen. Neben vertrauten Bekannten aus der van Ridder Reihe trifft der Leser auf ein eingeschworenes Vertriebsteam, alte Kameraden, ungleiche Brüder, korrupte Spitzenbeamte, einen Landtagsabgeordneten mit erstaunlichen Erinnerungslücken, den tödlichsten Pressesprecher Deutschlands und die Sieben Prinzen der Hölle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© 2016 JR
Bildnachweis Umschlag: Pieter Brueghel d.Ä., Die sieben Laster „Beelzebub“, Kupferstich, Sammlung Bibliothèque Royale, Cabinet Estampes, Brüssel
Lektorat, Korrektorat: U.S., M.G.
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
978-3-7345-6827-5 (Paperback)
978-3-7345-6828-2 (Hardcover)
978-3-7345-6829-9 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
JR
Beelzebub
Jan van Ridder findet das Glück - sein dritter Fall
Kriminalroman
Das Buch
Winter in Deutschland. Vorweihnachtszeit. Ein für rheinische Verhältnisse ungewohnt früher und frostiger Wintereinbruch hält Bonn und das gesamte Land in eisiger Umklammerung.
Auf einem abendlichen Spaziergang am Rheinufer wird vor Jan van Ridders Augen ein Bundeswehrwehrangehöriger aus dem Hinterhalt erschossen. Jan selbst entgeht dabei nur knapp dem Attentäter. Der Mitarbeiter der Bundewehr kann Jan vorher noch einen USB-Stick mit Hintergründen aus einem bundeswehrinternen Untersuchungsprojekt zustecken. Die Datensammlung enthält hochbrisante Insiderinformationen, die auf einen Rüstungsskandal immensen Ausmaßes hindeuten. Und es wird von Mordfällen berichtet, die zur Vertuschung des Skandals verübt wurden. Jan van Ridder, der ehemalige IT-Vertriebsmanager, Spezialist für die öffentliche Verwaltung und Bundeswehr und inzwischen selbständiger Berater, wird widerwillig in den ominösen Fall hinein gezogen. Schnell wird bei seinen weiteren Recherchen klar, dass es sich um ein gigantisches Komplott handelt. Mächtige Akteure aus der Politik, des Verteidigungsbereiches, der Rüstungsindustrie und selbst der Aufsichts- und Ermittlungsbehörden haben ihre Finger in dem dubiosen Spiel und ziehen aus dem Verborgenen die Fäden. Sein Bekannter, der Bonner Hauptkommissar, Klaus Ebner, fühlt sich nicht zuständig, die Kollegen der Koblenzer Mordkommission ermitteln nur halbherzig, nur ein Journalist schenkt Jans Vermutungen Glauben. Jan van Ridder ist auf sich allein gestellt.
Alle Spuren weisen auf eine mittelständische Rüstungsfirma im Süddeutschen mit ihrem umstrittenen Sturmgewehr hin. Jan begibt sich auf eine winterliche Reise ins Schwäbische. Dort trifft er die mysteriöse, unbekannte Frau wieder, die er im Herbst in seinem Fall rund um das Hells Angels Chapter Bonn, kennen gelernt und in die er sich verliebt hat. Jan ist unsicher. Welche Rolle spielt sie? Kann er ihr trauen?
In seinem dritten Fall begibt sich der sympathisch authentische Bonner Hobby-Ermittler Jan van Ridder auf eine sehr persönliche Reise: eine Achterbahnfahrt zwischen zahlreichen Gewaltverbrechen und undurchsichtiger Interessen, nagender Zweifel und Glücksmomenten voller Liebe. Jan wird zum Spielball mächtiger Gegenspieler, die auch vor Morden nicht zurück schrecken. Blut mischt sich in die weiße Schneepracht. Alles andere als eine friedliche Vorweihnachtszeit.
Van Ridder, vielschichtig, mal locker-humorvoll, mal nachdenklich-melancholisch, durch ein tragisches Unglück früh verwitwet, Vater einer studierenden Tochter und Großvater, Liebhaber deutscher Weißweine, Rockmusikhörer, Altbaubewohner, Katzenbesitzer, und immer auf der Suche. Findet er sein Glück?
Der Fall
Ein rasanter Politthriller, der den Leser in die verschlossene Welt des industriell-militärischen Rüstungssektors und seine enge Verflechtung mit der Bundeswehr und der Politik entführt. In Zeiten zahlreicher Rüstungsskandale, steigender deutscher Waffenexporte trotz anders lautender politischer Absichtserklärungen und der weltweiten Bedrohungslage durch Terrorismus aktuell und nah an der Realität. Gleichzeitig durchzogen von Momenten zarter Verliebtheit, unsicherer Anbahnung zwischen Mann und Frau und rauschhaften Glückszuständen. Neben vertrauten Bekannten aus der van Ridder Reihe trifft der Leser auf ein eingeschworenes Vertriebsteam, alten Kameraden, zwei ungleiche Brüder, korrupte Spitzenbeamte, einen Landtagsabgeordneten mit erstaunlichen Erinnerungslücken, den tödlichsten Pressesprecher Deutschlands und die Sieben Prinzen der Hölle.
Der Autor
Langjähriger, aktiver Manager in führenden IT-Weltkonzernen, intimer Kenner der Bundesverwaltung und Bundeswehr in Bonn und Berlin.
Beelzebub
Schweren Lastern wurden im Verlauf der Kirchengeschichte – insbesondere unter Papst Gregor I. (um 540 bis 604) – als sinnbildliche Warnung für die Gläubigen und Mönche bestimmte Dämonen zugeordnet. Quasi die Armee des Teufels. Unter anderem waren verantwortlich: Der Satan für den Zorn, Leviathan für Neid und Eifersucht, Mammon für Habgier, Asmodeus für die Untugenden Raserei und Begierde und eben der Beelzebub für die Völlerei, Maßlosigkeit und Selbstsucht.
Baal Zebub wird übersetzt mit „Herr der Fliegen“ und ist vermutlich eine Verballhornung des eigentlichen Namens Baal Zebul (‚erhabener Herr‘), um den heidnischen Gott zum Dämonen abzuwerten beziehungsweise dessen Anhänger zu verspotten. Als Fliegendämon besitzt Beelzebub eine ältere Vorlage in der altiranischen, zoroastrischen Dämonologie: Dort ist es der weibliche Dämon Nasu, der als eine in Leichen wohnende Fliege dargestellt wurde und Verwesung, Unreinheit und Zerfall symbolisierte.
Der Beelzebub (auch Beelzebul, Beelzebock, Belsebub) ist ein Dämon der christlichen Mythologie und im Volksmund ein anderer Name für den Teufel. Im dualistischen Denken und der christlichen Dämonenlehre wurde Beelzebub zum Anführer der widergöttlichen Mächte erhoben. So erscheint er im Neuen Testament als der „Fürst der Dämonen“, oberster Teufel und einer der sieben Prinzen der Hölle.
Die im Volksmund gebräuchliche Redewendung „Den Teufel durch Beelzebub austreiben“ (nach Matthäus 12, 24-27), die auf eine Begebenheit im Lukasevangelium zurückgeht, bedeutet sinngemäß „ein Übel durch ebenso Schlimmes oder Schlimmeres zu beseitigen“.
ERSTER TEIL
Anfang Dezember
Winter
Ein weißes Feld, ein stilles Feld.
Aus veilchenblauer Wolkenwand
Hob hinten, fern am Horizont,
Sicht sacht des Mondes roter Rand.
Und hob sich ganz heraus und stand
Bald eine runde Scheibe da,
In düstrer Glut. Und durch das Feld
Klang einer Krähe heisres Krah.
Gespenstig durch die Winternacht
Der große dunkle Vogel glitt,
Und unten huschte durch den Schnee
Sein schwarzer Schatten lautlos mit.
Gustav Falke (1853-1916)
Prolog
Stille umgibt ihn.
Er starrt in den dunklen Himmel.
Schneeflocken rieseln aus dem schwarzen Nichts. Schweben wie weiße, kleine Federn langsam auf ihn herab. Benetzen sanft einer kühlen, leichten Daunendecke gleich sein Gesicht.
Er kann sich nicht bewegen. Er liegt auf dem Rücken. Stechende Schmerzen rasen durch sein Gehirn. Aus seinem Hinterkopf ergießt sich eine dampfende Blutlache über die eiskalten Steine. Das warme Blut lässt den Schnee schmelzen und färbt ihn rot. Sein Kreislauf bricht zusammen. Er wird ohnmächtig.
Am Nachmittag war er mit der Seilbahn zur Festung Ehrenbreitstein 1 hinauf gefahren. Die imposante Festungsanlage thronte hoch oben auf dem Bergtableau gegenüber der Moselmündung und bewachte von alters her das Flusstal und die Stadt. In der Vorweihnachtszeit und bei dem nasskalten, winterlichen Wetter verirrten sich nur wenige Touristen am Deutschen Eck, wo Rhein und Mosel in einer spektakulären Flusslandschaft zusammen flossen. In der Kabine der Seilbahn hatte er alleine gesessen. Unter dem gläsernen Boden der Gondel glitt der mächtige Strom des Rheins vorbei, schräg gegenüber der Blick auf die Moselmündung, das mächtige Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm dem I. und das Stadtpanorama von Koblenz.
Oben angekommen war er eine knappe Stunde gedankenverloren und ziellos über das riesige Areal der verlassen liegenden, alten Wehranlage gelaufen. Der Schnee hatte das Gelände mit einer dünnen weißen Schicht überzogen. Wie feiner Puderzucker, dachte er beim leisen Knirschen unter seinen Schritten. Er aber konnte sich nicht an der friedlichen Winterlandschaft erfreuen. Was wollte er hier? Er war weder geschichtlich interessiert, noch der Typ touristischer Jäger, der nach Fotomotiven oder Reiseführersensationen Ausschau hielt, die es zu erlegen galt. In der kalten Luft und in der Bewegung den Kopf freikriegen? Seine Gedanken sortieren? Aber ein befreiendes Gefühl wollte sich nicht einstellen. Ganz im Gegenteil. Je länger er umherlief, desto unruhiger und aggressiver wurde er. Missmutig stapfte er durch den Schnee. Wollte ihn am liebsten zertreten.
In seiner kleinen Wohnung war ihm am Vormittag – nach einer viel zu kurzen und durchwachten Nacht - die Decke auf den Kopf gefallen. Das ansonsten behagliche Einliegerappartement, wo er seit seiner Versetzung aus Bonn nach Koblenz bei einer alter Dame zur Untermiete unter der Woche wohnte, kam ihm mit einem Mal bedrohlich eng und stickig vor. Der schlagartige Verlust schmerzte. Die abrupte Abfuhr setzte ihm unerwartet heftig zu. Er spürte nach dem Aufwachen wie die einsetzende Einsamkeit sein Gemüt im eisernen Griff hielt. Nachdem er wie gelähmt im Schlafanzug lange an dem kleinen Küchentisch gesessen und vor sich hin gestiert hatte, trieb es ihn nach draußen. Er war noch nie der Typ gewesen, der auf sich allein gestellt sein konnte.
Das Telefonat mit Sabine gestern Abend. Seine Freundin aus Bonn, bei der er normalerweise immer die Wochenenden verbrachte, hatte ihn gestern Abend angerufen und in dürren Worten mitgeteilt, dass sie ihre Beziehung beenden wollte. Sie hatte ihn abserviert.
Vor drei Wochen war Sabine berufsbedingt von Bonn nach Berlin gezogen. Gewechselt oder besser gesagt auf der Verwaltungsrutschbahn in die neue Hauptstadt geschliddert wie so viele Angestellte und Beamte aus den verbliebenen Bonner Ministerien. Wer im Beamtenapparat der Bundesministerien Karriere machen und am Entscheidungspuls des Politik- und Verwaltungsgeschehens der Bundesrepublik sitzen wollte, ging nach Berlin. Die Hebel der Macht wanderten seit Jahren langsam aber unaufhaltsam nach Berlin ab. Interessante, höherdotierte Stellen gab es zunehmend nur noch dort. Ganze Abteilungen in allen Ressorts wurden – trotz der anderslautenden Bestimmungen des bestehenden Bonn-Berlin-Gesetzes – sukzessive vom Rhein an die Spree verlagert. Die Bonner Bundesministerien bluteten aus. Aber Sabine hatte diesen Schritt freiwillig getan. Keine Versetzung, keine Abordnung, kein Marschbefehl. Sie hatte sich aus freien Stücken für den internen Stellenwechsel im Bundesentwicklungshilfeministerium 2 gemeldet.
Nächtelang hatten sie das Für und aus seinen Augen vor allem das Wider diskutiert: was würde dann aus ihrer Beziehung? Die Strecke Koblenz – Berlin war zu weit, um eine einigermaßen regelmäßige Wochenendbeziehung aufrecht zu erhalten. Fliegen war zu teuer. Die Bahnverbindung war durch mehrfaches Umsteigen zu umständlich, durch die notorischen Verspätungen und Zugausfälle zu unzuverlässig und an Autofahrten war aufgrund der chaotischen Verkehrslage besonders rund um Köln und im Ruhrgebiet auf der langen Strecke aus Zeitgründen gar nicht erst zu denken. Mit steigender Verwunderung war ihm bei ihren Gesprächen in letzter Zeit aufgefallen, dass Sabine diese für ein regelmäßiges Sehen nicht zu überwindenden, faktischen Hürden und damit den ungewissen Fortbestand ihrer Beziehung leichtfertig in Kauf genommen hatte. Sie hatte ihn beschwichtigt: „Lass es uns doch versuchen!“ Um sein Verständnis für ihre (einseitige) Entscheidung geworben: „Für mich ist der Wechsel beruflich unheimlich wichtig“.
Und jetzt hatte er die Bestätigung. Sein schwelender Verdacht hatte sich erhärtet. Bei dem Telefonat hatte sie ihm beiläufig und ohne erkennbares, schlechtes Gewissen mitgeteilt, dass sie einen anderen Mann kennengelernt hatte. Ihre Beziehung sei ja schon seit langem „brüchig“, wie sie es formuliert hatte. Sie hätten sich entfernt, auseinandergelebt. Sie könne bis heute zum Beispiel nicht verstehen, warum er bei der Bundeswehr arbeiten und dem Irrglauben hinterherjagen würde, dass Töten im Namen eines angeblich gerechten Krieges die Welt verbessern könnte. „Du siehst doch was die Feldzüge im Irak, Afghanistan und jetzt Syrien anrichten. Failed States, Armut, Chaos, Terror und immer nur noch mehr Krieg. Die Welt wird durch militärische Interventionen, wenn sie vielleicht auch noch so gut gemeint sind, nicht sicherer, sondern ganz im Gegenteil immer unsicherer. Man kann den Teufel halt nicht mit dem Beelzebub austreiben!“
Er hatte diese Diskussionen mit Sabine von Anfang an, als sie sich vor drei Jahren kennen gelernt hatten, befremdlich gefunden. Zu Beginn ihrer Beziehung strahlte Sabines euphorisches Engagement für eine bessere Welt auf ihn noch etwas, wenn auch klein-mädchenhaftes, naives, aber liebenswertes aus. Über die Jahre wurde er den immer gleichen Argumenten überdrüssig. Er konnte es nicht mehr hören und die Litanei trübte schleichend seinen Blick auf Sabines Charakter ein. In seinen Augen bewegte sie sich in einer selektiven, selbstgefälligen Wahrnehmungsblase, die nur Argumente zuließ, die dazu da waren, am Ende Recht zu behalten und die eigene, feststehende Sichtweise zu zementieren. Sie nährte in einer Endlosschleife nur noch ihr eigenes Universum und sich besser, überlegen zu fühlen. In ihrer selbstgerechten Welt der Gutmenschen, die mit Brunnenbohren, Alphabetisierungskampagnen und Wideraufforstungsinitiativen in millionenschweren Entwicklungshilfeprojekten die Dritte Welt beglückten, um nur Monate später ansehen zu müssen, wie ihre mühsam aufgebauten Schulen im Flammenmeer, ihre nachhaltig, ökologisch korrekt wirtschaftenden Kleinbauern im Kugelhagel von Taliban und IS, folternden Diktatoren, korrupten Provinzregierungen und archaisch denkenden Stammesältesten wieder untergingen.
„Manchmal muss Krieg leider die Ultima Ratio der Politik sein. Ich glaube nicht, dass Du den schwertschwingenden und Scharia-gläubigen Islamist in einer Podiumsdiskussion über die Gleichberechtigung der Frau und die Notwendigkeit von Schulbildung für Mädchen überzeugen kannst“ hatte er spöttisch erwidert. „Im Bombenhagel der IS, den Giftgaswolken eines Assads und Säuberungswellen irgendwelcher Möchtegernkalifen wirst Du deine heilen Zivilgesellschaften nicht aufbauen können. Noch nicht mal einen Deiner Brunnen unbehelligt bohren können. In den meisten Krisengebieten müssen zivile Aufbaumaßnahmen wohl oder übel militärisch abgesichert werden.“
Eigentlich hätte er ihr viel lieber gesagt, dass er als Zivilangestellter und Ingenieur in der wissenschaftlichen Prüfabteilung des Bundesamtes für Ausrüstung direkt nichts mit dem militärischen Teil der Bundeswehr zu tun hatte. Aber er war es leid. Sie hatte immer schon alles mit allem vermengt und in den nicht aufzulösenden Topf der ganz großen, universellen ethischmoralischen Grundsatzfragen gestellt. Mit dem Ergebnis, dass sie auf der richtigen Seite der guten Weltenretter stand, während er – wenn auch nur als kleines Rädchen – auf der falschen Seite der Schuldigen zurück blieb. Am Anfang ihrer Beziehung hatte er diese Diskussionen nicht ernst genommen. Aber gerade in letzter Zeit führte Sabine die Auseinandersetzungen immer verbissener, fast schon verblendet mit einem missionarischen Eifer, der sie immer weiter von ihm entfremdete.
Mit den Worten: „Raimund, lass doch mal Deinen unerträglichen Sarkasmus“ hatte sie die Auseinandersetzung abgewürgt und stattdessen die Entfernung zwischen Koblenz und Berlin als Argument für das Aus ihrer Beziehung nachgeschoben. Das habe ja alles keine Zukunft. Das müsse ihm doch auch klar sein! Bei dieser Wendung des Telefonats war er explodiert: „Ach, jetzt plötzlich ist es die Entfernung. Vor Wochen hast Du noch die Durchhalteparole ausgegeben: Lass es uns versuchen!“ Er war außer sich: „Du lügst doch. Deinen neuen Stecher kennst Du doch schon viel länger und folgst ihm jetzt willig nach Berlin“ hatte er abschätzig ins Telefon gebrüllt. „Sei jetzt wenigstens ehrlich!“ Sie hatte geschwiegen.
Er legte nach. Wollte verletzend sein, sie persönlich treffen, ihr wehtun: „Wahrscheinlich auch so ein naiver Wir-bringen-Frieden-in-die Welt durch Stuhlkreise und Handauflegen-Spinner!“
„Nein. Wenn es dich beruhigt: Er macht etwas ganz anderes“ hatte sie trotzig entgegnet.
„Was denn?“ fragte er verächtlich.
„Er ist Unternehmensberater in einer großen, internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.“
„Ach so. Am heimischen Küchentisch und in den warmen Amtsstuben die Welt verbessern und dabei alle andere verurteilen, aber gleichzeitig auf die Segnungen des kapitalistischen Luxus und die Bequemlichkeiten eines gesättigten Wohlstandlebens durch einen bilanzfälschenden Anzugträger nicht verzichten wollen. Marke Prenzlauerberg Sofarevoluzzer: Auf dem Wochenmarkt Champus saufen und fair gehandelte Krabbenschwänze knabbern und für den Ferienflug in die Karibik den CO2-Ausgleich als Ablass für das schlechte, grüne Gewissen in die Dritte Welt spenden. Du spinnst ja wohl, Sabine.“
Keine Reaktion. Es war still in der Leitung.
Er ließ seiner Wut freien Lauf und redete sich in Rage: „Und Abends beseelt vom Weltfrieden beim gemeinsamen Anschauen der prall gefüllten Kontoauszüge die Beine für den Schlipsträger breit machen! Wie schön einfach doch alles sein kann.“
Ihr Schweigen ließ ihn ungehalten werden. Er schrie: „Jetzt werden mir auch deine vielen plötzlichen Dienstreisen nach Berlin in den letzten Monaten klar. Mehrere Tage, über Nacht. Ja klar, die kleine Juristin aus dem BMZ muss selbst am Wochenende dienen.“ Seine Stimme triefte vor Verachtung: „Für wie blöd hälst du mich eigentlich? Ich lass mich doch von dir nicht verarschen, Sabine!“
Wieder keine Antwort. Erst an dem monotonen Tuten in der Leitung merkte er, dass sie längst aufgelegt hatte.
Er setzte sich auf die niedrige Umgrenzungsmauer. Unter ihm die steil abfallenden Felsabhänge. Er ließ die Beine über dem Abgrund baumeln und schaute in die Tiefe. 60 Meter unter ihm floss der Rhein träge in seinem Bett. Er blickte hinüber auf Koblenz. In der Dämmerung funkelten die Lichter der Stadt am gegenüberliegenden Flussufer. Durch den einsetzenden Schneefall sahen die beleuchteten Häuser wie auf einer winterlichen Postkartenidylle aus. Der friedlich-liebliche Anblick hellte sein Gemüt auf: Dann schmeiße ich mich heute Abend in das prickelnde Nachtleben von Koblenz. Irgendeine wird sich schon finden. Und wenn nicht, lasse ich mich mal wieder richtig volllaufen, schmunzelte er. Er kramte sein Smartphone aus der Jackentasche und machte ein Foto von der Stadtansicht. Bei der zweiten Aufnahme beugte er sich weiter vor, um das Rheinpanorama besser ins Bild zu bekommen.
Plötzlich traf ihn ein harter Schlag auf den Hinterkopf. Er verlor das Gleichgewicht, kippte nach vorne und stürzte kopfüber mehrere Meter tief hinab in den dunklen Abgrund.
Er öffnet die Augen. Er starrt in den Nachthimmel. Schneeflocken schweben auf ihn herab. Von ferne hört er über sich das heiserne Krächzen von Krähen. Die schwarzen Vögel gleiten über ihn durch den dunklen Himmel.
Sein Kopf schmerzt. Seine Gliedmaßen fühlen sich wie zerschlagen an.
Ein heller Lichtstrahl durchschneidet die Dunkelheit. Trifft ihn – es schmerzt. Er schließt die Augen. Öffnet sie zögerlich wieder. Weit über sich meint er verschwommen zwei Konturen auszumachen, die sich gegen den dunklen Himmel abzeichnen. Er kneift die Augen zusammen. Er versucht um Hilfe zu schreien, bekommt aber keinen Ton heraus. Einer der Umrisse beugt sich über die Begrenzungsmauer. Hält etwas Großes, Schwarzes mit ausgestreckten Armen vor sich. Das grelle Licht blendet ihn.
Der schwarze Gegenstand löst sich und rast auf ihn zu.
Er versucht, abwehrend die Arme zu heben. Kann sich aber nicht bewegen.
Der Steinbrocken zermalmt seinen Schädel.
Nun ist er tot.
Leise rieselt der Schnee.
Das weiße Feld färbt sich rot.
Ein schwarzer Vogel fliegt heran. Lässt sich neben dem leblosen Körper auf einem Stein nieder. Der Vogel stößt krächzende Laute aus. Der Schwarm fliegt neugierig und hungrig heran.
Eine unverhoffte Begegnung am Flughafen Leipzig
Draußen setzt Schneetreiben ein. In der Dunkelheit wirbeln Schneeflocken in den Lichtkegeln der grellen Startbahnbeleuchtung. Weiße, dicke Flocken, vom Wind hin und her geweht, tauchen aus dem schwarzen Nichts auf. Wie von einer unsichtbaren Hand unachtsam dahin geworfen. Führen einen zuckenden Tanz auf ihrer hellerleuchteten Lichterbühne auf und verschwinden dann wieder in der Schwärze der Nacht. Ein bizarres Schauspiel.
Jan sitzt in der großen Wartehalle am Flughafen Leipzig-Halle. Gelangweilt blickt er umher. Im Wartebereich vor den Flugsteigen verlieren sich an diesem frühen Sonntagabend des ersten Dezemberwochenendes nur wenige Reisende. Er schaut auf seine Armbanduhr: 17.15 Uhr. Er stöhnt missmutig. Die Zeit will einfach nicht vergehen. Ihm ist langweilig.
Seine Gedanken schweifen ab: Wie viele Stunden er in seinem Leben wohl schon wartend auf Flughäfen und Bahnhöfen verbracht hat? Damals als er noch beruflich im Wochentakt per Flieger quer durch Europa gereist war. Inklusive der ellenlangen Staus auf den Autobahnen sicherlich ein Fünftel seiner Lebenszeit. Ach, und die Warterei vor roten Ampeln, geschlossenen Schranken, in Arztzimmern, vor Schaltern, in Amtsstuben. Plus Schlafen. Verschläft der Mensch nicht ein Drittel seines Lebens? Das halbe Leben besteht aus Warten. Auf wen und was auch immer. Eigentlich sogar das ganze Leben, wenn man die Lebensspanne als Warten auf den Tod begreift. Wir sind alle nur auf der Durchreise. Eine erschreckende Bilanz. Oder auch nicht? Abwarten und Teetrinken. In der Ruhe liegt die Kraft.
Jan schüttelt sich. Vertreibt die unnützen Gedankenspiele.
Er hatte in seiner Rolle als selbständiger IT-Berater und Vertriebscoach am Donnerstag und Freitag eine Vertriebsschulung in der Leipziger Zentrale eines großen Handelspartners von Marcosoft gehalten. Seinen Aufenthalt hatte er mit einem Besuch eines langjährigen und befreundeten Kollegen aus seinen Macrosoft Zeiten am Samstag und Sonntag kombiniert. Im Gegensatz zu vielen anderen Regionen in Ostdeutschland kannte Jan Leipzig durch seine damaligen geschäftlichen Aufenthalte verhältnismäßig gut. Seit der Wiedervereinigung war er beginnend mit seinem ersten Besuch direkt nach dem Mauerfall regelmäßig in Leipzig. Er war bei seinen Besuchen immer wieder fasziniert, wie prächtig sich diese Stadt über die Jahrzehnte seit dem Mauerfall entwickelt hatte: von einer tristen, von der sozialistischen Planwirtschaft ruinierten Messestadt hin zu einer lebendigen, boomenden Metropole. Hier war es wirklich zu denen im Taumel der deutsch-deutschen Einheit viel bemühten „blühenden Landschaften“ gekommen. Wenn auch mit fast 30 Jahren Verzug und damit sehr viel später, als Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit, dem Wahlvolk einst versprochen hatte.
Jan schaut erneut auf seine Armbanduhr. Die Uhrzeiger scheinen still zu stehen. Wie geronnen. Immer noch fast eine Stunde bis zum Abflug. Er war viel zu früh, da er das tägliche Verkehrschaos und die zähen Abfertigungsschlangen von seinem Heimatflughafen Köln/Bonn automatisch mit einkalkuliert hatte. Leipzig, zwar ähnlich groß dimensioniert wie der Köln/Bonner Flughafen, machte sich dagegen wie ein verschlafener Provinzflughafen aus, mit dem Vorteil, dass Jan zügig durch den gesamten Checkin-Prozess kam. Jan greift nach seiner Computertasche, erhebt sich und schlendert in den gegenüberliegenden Zeitschriftenladen. Der Laden ist nur spärlich besucht. Außer einer Verkäuferin, die hinter der Kassentheke Zigarettenschachteln in das Regal einsortiert, ist nur noch eine weitere Kundin im Laden. Jan geht in die Ecke mit den Musikzeitschriften und blättert die neueste Ausgabe des ROCKS Magazins3 durch. Er liest die Rezession der neuen Scheibe von Mother`s Finest. Er wundert sich, dass diese Wegbereiter des Heavy Metal-Funk-Fusion Sounds aus den 80igern immer noch aktiv sind. „Liest sich gut. Die werde ich mir wohl holen müssen“, denkt er bei der Beschreibung der Musik. Neben ihm nimmt sich eine Frau ein GEO-Reiseheft über Kambodscha und Vietnam.
Dann riecht er es. Ganz plötzlich. Dieser verführerische, süßlichschwere Parfumduft. Bilder überfluten sein inneres Auge. Schlagartig hat er die Geschehnisse aus den stürmischen Herbsttagen vor Augen. Und sie. Ihr Kennenlernen in der brasilianischen Bar in Bad Godesberg, das Wochenende, die gemeinsamen Abendessen, die verwirrenden Tage, geprägt von blinder Rache, Hass und Gewalt, aber auch seine starken Gefühle für diese Frau, ihr überraschender Auftritt auf dem Herbstfest des Hells Angels Charters Bonn, der Schusswechsel, ihr spurloses Verschwinden. Er dreht sich langsam zu der Frau um und betrachtet sie. Sie steht mit dem Rücken zu ihm. Ohne Zweifel: Sie muss es sein. Das halblange, schwarze, gewellte Haar, die schlanke, sportliche Statur. „Maria?“ flüstert er kaum hörbar; zu mehr hat er keinen Mut. Die Frau reagiert nicht. Vorsichtig macht er einen Schritt auf sie zu. Tippt sie von hinten zaghaft auf die Schulter: „Entschuldigen Sie.“
Die Frau dreht sich um. Schaut ihn an. Jan wird schwindelig. Sie ist es! Das Gesicht. Und vor allem diese dunkelbraunen, intensiven Augen. Im Antlitz der Frau spiegelt sich Erstaunen und dann ein Anflug von Entsetzen wieder.
„Maria!“ mehr bringt Jan nicht heraus.
„Jan, was machst du denn hier?“ fragt sie erschrocken. Ihr Gesicht zeigt keine Freude.
„Ich hatte hier geschäftlich zu tun. Und du? Wohnst du hier?“
„Nein, ich habe meine Mutter besucht, die …“Eine Lautsprecherdurchsage unterbricht sie: „Der letzte Aufruf für alle Gäste für Flug LH386 nach Stuttgart. Kommen Sie bitte umgehend zu Gate drei. Wir schließen den Flug.“
„Jan, ich muss.“ Sie lässt die Zeitschrift auf den Stapel fallen und wendet sich ab.
Jan streckt seine Hand nach ihr aus: „Maria, nein warte. Ich möchte dich unbedingt …“
„Jan, ich melde mich bei dir. Ich verspreche es“.
Sie geht Richtung Ausgang. Jan läuft hinter ihr her: „Maria, nein, so kann ich dich jetzt nicht gehen lassen…“
„Tschuildjung, junger Mann, de Zeidung da bezahlense aber schunn noch bei mir!“ schallt eine energische Stimme hinter ihm. Jan dreht sich um und schaut die kleine, dickliche Verkäuferin verständnislos an. Die Frau deutet auf die Musikzeitschrift in seiner Hand. Jan schmeißt die ROCKS Ausgabe mit den Worten: „die nehme ich doch nicht“ auf den Tresen und blickt zum Ausgang. Die Verkäuferin hält ihn am Arm fest und zetert: „So jed dass nisch, ärschd lesen un dann nischd goofen!“
Jan reißt sich los und läuft aus dem Laden in die lichtdurchflutete Wartehalle. Er schaut sich hektisch um: „Wo ist dieses Gate drei?“
Und dann sieht er sie. Sie legt gerade ihr Smartphone auf den Ticketscanner, die Zugangsschleuse öffnet sich. Sie geht hindurch. Die gläserne Schiebetür am Gate schließt sich mit einem leisen zurrenden Geräusch hinter Maria.
Weg ist sie.
Schon wieder.
Wie damals.
Jan rennt durch die Halle. Außer Puste erreicht er den Schalter. Eine junge Frau am Counter klappert mit rot lackierten Fingernägeln auf der Tastatur des Computers. Jan stottert – vor Atemlosigkeit, vor allem aber aufgrund seiner Verwirrung: „Ich müsste bitte dringend die Frau von eben…“
Die Lufthansaangestellte schaut ihn verständnislos an. „Tut mir leid, der Flug LH386 ist bereits geschlossen!“
Jan atmet durch: „Ich fliege nicht nach Stuttgart. Ich bräuchte nur den Namen von der letzten Dame, die hier eben reingegangen ist. Bitte!“
„Ich bin aus Datenschutzgründen leider nicht befugt, ihnen Namen von anderen Fluggästen zu überlassen.“ sagt die Frau mit einem einstudierten „Wie wimmele ich Beschwerden ab“-Lächeln, was nicht zu ihrem ansonsten abweisenden Gesichtsausdruck passt.
„Das verstehe ich natürlich!“ Jan hat sich mittlerweile gesammelt und eine Geschichte zu Recht gelegt. Er schaut auf das Namensschild auf der blau-gelben Uniform: „Aber ich denke, dass wir beide gemeinsam, Frau Ponkatz, der Dame viel Ärger ersparen können, wenn sie gelandet ist. Und Sie wollen ja wohl nicht, dass das auf den Kundenservice Ihrer Airline zurückfällt, wenn wir uns hier jetzt unnötig bürokratisch verhalten?“
Sie schaut ihn fragend an. Ihre Gesichtsmimik entspannt sich. Sein Plan geht auf. Er hat die Frau neugierig gemacht.
Jan – ganz alte Gesprächsführungsschule aus seinen Vertriebszeiten – legt nach: „Die Dame hat in dem Zeitschriftenladen ihr Portemonnaie liegen lassen.“ Jan greift in seine Manteltasche und holt zum Beweis eine Geldbörse hervor, die er am Samstag als Geschenk für seine Tochter Charlotte in einer Boutique in der Leipziger Innenstadt gekauft hatte. Er wedelt damit lächelnd vor der Lufthansaangestellten herum.
„Dann geben Sie mir das Portemonnaie und wir schicken das der Passagierin über unseren Kundenservice nach.“
„Ach, kommen Sie, Frau Ponkatz. Verbauen Sie mir doch nicht die einmalige Gelegenheit auf einen Finderlohn in Form eines Candle-Light-Diners mit einer hübschen, unbekannten Frau?“ Jan legt seinen ganzen Charme in die Waagschale: strahlt die Frau aus seinen blauen Augen an und zaubert einen romantisch verklärten Ausdruck auf sein Gesicht. Seine Stimme samtigweich. „Bitte!“ Frau Ponkatz schwankt.
„Dann ersparen Sie sich die Arbeit, wahrscheinlich bedeutet das doch endlose Formularschlachten. Und ich habe vielleicht die Chance, meine Traumfrau kennenzulernen!“
Frau Ponkatz zögert. Dann nickt sie. „Ok, aber sie verraten mich nicht.“ lächelt sie Jan verschwörerisch an, während sie bereits mit ihren langen Fingernägeln auf den Tasten des PC klimpert.„So, das müsste sie sein. Anneliese Unter …“
Jan runzelt die Stirn.
„Ach, nein, habe ich mich doch glatt in der Reihe vertan. Frau Mareike Gollsing.“
„Gollsing mit Doppel L ?“, fragt Jan rasch nach.
„Ja, jetzt ist aber Schluss. Ich muss zur nächsten Abfertigung.“ Sie loggt sich aus, packt ihre Handtasche und verlässt den Check In-Desk am Gate.
„Danke, Frau Ponkatz. Vielen Dank“ ruft ihr Jan hinterher.
Jetzt erst merkt er, dass er in der Aufregung seine Computertasche in dem Zeitschriftenladen stehen gelassen hat. Er läuft zurück. Begleitet von der schnippischen Bemerkung der Verkäuferin: „Na wohl ä schlechts Jewissen jekricht? Wollnse de Zeidung jetze doch bezaahln?“, holt er seine Tasche. Er strahlt die Verkäuferin an:„ Ja, jetzt bin ich soweit“, reicht ihr einen Fünf-Euroschein mit dem Kommentar „Stimmt so“ und verlässt den Laden.
Jan hastet zum Flugsteig, da der Boardingprozess seines Fliegers bereits geschlossen wird. Am Schalter steht Frau Ponkatz. Sie zwinkert ihm zu: „Viel Glück bei der Unbekannten.“
Wenn Du wüsstest, dass die mir so ganz und gar nicht unbekannt ist, denkt er und geht über die Gangway ins Flugzeug.
Im Flieger sitzend notiert er sich den Namen: Gollsing. Aber wie schreibt man Mareike? Mit einfachem r oder mit doppeltem r? Hatte die Frau am Schalter den Vornamen lang oder schnell ausgesprochen? Mit k oder ck oder sogar mit kk? Mit ei oder ai? Jan schreibt alle Varianten in sein Büchlein. Ein aparter Vorname, denkt er. Eher selten. Umso besser, das wird die Recherche erleichtern.
Er blättert gedankenverloren in dem ROCKS-Magazin. Seine Augen nehmen zwar die Buchstaben der Musikbeschreibungen wahr, aber er kann sich nicht konzentrieren. Er ist abwesend. Mit den Gedanken ganz woanders. Bei Mareike.
Es fühlt sich gut an. Ein euphorisches Gefühl durchflutet ihn.
Er hat ihren Namen.
Er hat eine Spur.
Endlich.
Wir.Dienen.Deutschland
„Jetzt ist alles aus!“
Er schlich mit gesenktem Kopf über die dunklen Fluren zurück zu seinem Büro. Seine Schritte hallten in den endlosen Gängen wieder. Der Block lag zu dieser fortgeschrittenen Uhrzeit einsam und verlassen. Die meisten Kollegen hatten bereits vor Stunden ihre Arbeitsplätze und die Liegenschaft verlassen, waren jetzt auf dem Heimweg oder saßen bereits zu Hause beim Abendbrot mit ihren Familien. Ursprünglich wollte er auch schon heute Abend von Koblenz zurück nach Bonn fahren, um bei seiner Frau Melanie und seinen beiden kleinen Kindern Julius und Sophie zu sein. Gerade jetzt in der Adventszeit galt es noch einiges für das Weihnachtsfest und die Feiertage vorzubereiten. Gleich morgen Nachmittag wollte er mit den Kindern in den Kottenforst fahren und einen Weihnachtsbaum schlagen.
Sie hatten ihm im Zuge seiner damaligen Versetzung von der Hardthöhe in das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 4 nach Koblenz zugebilligt, dass er regelmäßig an Montagen und Freitagen auch von zu Hause aus arbeiten könnte („wenn keine dienstlichen Verpflichtungen eine Anwesenheit in der Liegenschaft Koblenz erforderlich machen“). Wie hieß es in all den „Wir.Dienen.Deutschland“-Hochglanzbroschüren, internen Personalversammlungen und Mitarbeitergesprächen immer so schön: Die Bundeswehr legt als attraktiver Arbeitgeber gesteigerten Wert darauf, gerade jungen Familieneltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen – nicht zuletzt durch den Einsatz moderner Kommunikationsmittel, flexiblen Arbeitszeitmodellen und einer innovativen Arbeitsorganisation. Dies war Teil der umfassenden Attraktivitätsoffensive der Verteidigungsministerin, um die Bundeswehr nach ihrer Umwandlung in eine Freiwilligenarmee als Arbeitgeber am Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu halten. In den ersten sechs Monaten nach seiner Versetzung aus dem Bundesverteidigungsministerium 5 ins BAAINBw nach Koblenz war dies auch nie ein Problem. Ganz im Gegenteil – sein direkter Vorgesetzter zeigte sich in diesen Fragen immer äußerst großzügig und ermunterte ihn sogar, von dieser Flexibilität regelmäßig Gebrauch zu machen. Alles ganz unbürokratisch. Die Abordnung nach Koblenz hatte ihn aufgrund der zeitraubenden Fahrerei zwischen dem Bonner Norden und dem Koblenzer Süden als junger Familienvater mit den gerade erst geborenen Zwillingen, dem vor einigen Monaten bezogenen Neubau und der noch frischen Ehe zuerst aus dem Tritt gebracht. Wenn am Tag allein mehrere Stunden durch die Pendelei unnütz verloren gingen, wie sollte er das alles unter einen Hut bekommen? Sein Job, seine Rolle als Ehemann, Vater, Hausbauer? Die Rush-Hour des Lebens. Und jetzt noch das anspruchsvolle Projekt in Koblenz. Er hatte sich schnell überfordert gefühlt. Aber der erste Schock hatte sich nicht zuletzt aufgrund der flexiblen Home Office-Regelung inzwischen gelegt. Unter der Woche schlief er in der Regel in dem Gästehaus auf dem Kasernengelände, während er freitags und zum überwiegenden Teil auch montags von zu Hause aus arbeitete. Mit der Versetzung ging auch eine außerplanmäßige Beförderung einher. Er hatte als Zivilangestellter einen deutlichen Sprung in der Besoldungsklasse gemacht, eine üppige Sonderzulage erhalten und von weiteren finanziellen Segnungen des öffentlichen Dienstes wie Familienzulage und Trennungsgeld profitiert. Eigentlich unüblich für seine Altersklasse – tickte der öffentliche Dienst doch immer noch stark nach dem Senioritätsprinzip. Sie hatten ihm sogar eine vorzeitige Verbeamtung in Aussicht gestellt, wenn er dieses Sonderprojekt erfolgreich abschließen sollte.
„Nach dem Einlauf wird das jetzt nicht mehr funktionieren. Nichts mehr!“ schoss es ihm durch den Kopf als er die Tür zu seinem Büro öffnete. Sein kleines Arbeitszimmer lag im Dunklen. Die Hofbeleuchtung tauchte sein kahles Zimmer in ein diffuses Dämmerlicht. Er machte kein Licht an, trat ans Fenster und schaute nach Draußen. Es hatte zu schneien begonnen. Der Hof zwischen den Gebäuden war mit einer feinen Schneeschicht bedeckt. Weiße Weihnachten, die Kinder würden sich freuen. Aber ihm war nicht nach vorweihnachtlicher Stimmung zu Mute. Sein Kopf war seltsam leer. Eine dumpfe Resignation legte sich bleiern auf sein Gemüt. Alles war zusammengebrochen!
Er wollte gerade den PC herunterfahren und zusammen packen, als um kurz nach 17.30 Uhr eine Email seines Abteilungsleiters in seiner Lotus Notes Inbox mit einem leisen „Pling“ eintraf: „Kommen Sie um Punkt 18.00 Uhr in mein Büro.“ Keine Anrede, kein freundlicher Gruß. Nichts.
Er ahnte da bereits nichts Gutes. Aber es sollte noch viel schlimmer kommen.
Bevor er sich auf den Weg zu dem Abteilungsleiter aufmachte, hatte er noch versucht, seinen Referatsleiter zu erreichen. Bekam aber nur eine Bandansage am anderen Ende der Leitung zu hören. Um kurz vor sechs hatte er an der Tür des Abteilungsleiters im zweiten Stock geklopft. Erst keine Reaktion, dann ein barsches „Nein. Ich hole Sie rein!“ Er ging in dem Flur auf und ab und schielte immer wieder in die Richtung der Tür des Eckbüros am Ende des Ganges. Minütlich blickte er auf seine Uhr. Vereinzelte Kollegen verabschiedeten sich mit einem Nicken während sie an ihm vorbei in den Feierabend davon eilten. Einige beäugten ihn dabei neugierig.
Um 18.20 Uhr öffnete sich die Tür des Abteilungsleiters. Ein Mann kam heraus. Kleine, gedrungene Gestalt. In zivil. Er kannte ihn nicht. Das BAAINBw beschäftigte in Koblenz tausende Mitarbeiter. Und er war zu neu, um auch nur annähernd alle Kollegen selbst in seinem Gebäudetrack zu kennen. Als der Fremde mit festen Schritten an ihm vorbei ging, würdigte der ihn keines Blickes. Die Tür des Büros stand offen. Er war unsicher: Sollte er direkt eintreten oder besser noch warten? Er ging zögerlich auf die Tür zu. Er blickte hinein und sah den breiten Rücken des Abteilungsleiters, der am Fenster stand und telefonierte. Plötzlich drehte der Abteilungsleiter sich um, starrte ihn an, schüttelte den Kopf, bedeckte den Lautsprecher des Handys mit der Hand und herrschte ihn an: „Warten Sie draußen und machen Sie die Tür zu!“ Er wendete sich verstört wieder ab.
Bei seinem damaligen Antrittsbesuch gemeinsam mit seinem Referatsleiter und dem Gespräch über das anstehende Projekt, welches er in den nächsten zwölf Monaten als prüfender Ingenieur leiten sollte, war ihm der Abteilungsleiter bestimmt aber ausgeglichen und freundlich vorgekommen. Danach hatte er ihn nicht noch einmal persönlich gesprochen, nur in zwei größeren Besprechungsrunden erlebt. Auch dort war er ihm mit seiner sachlich-ruhigen und etwas betulichen Art und Weise eher angenehm in Erinnerung geblieben. Und jetzt das! Er konnte sich diesen Wandel und die ganze Situation nicht erklären. Er suchte fieberhaft nach einer möglichen Erklärung. Hatte er einen Fehler gemacht? In seinem letzten Bericht über die Prüfergebnisse etwas übersehen? Aber dann hätte ihn sein Referatsleiter doch vorgewarnt. Zu seinem Vorgesetzten hatte er ein gutes und offenes Verhältnis. Dachte er zumindest. Natürlich wusste er, dass das Projekt unter allerhöchster politischer Beobachtung stand, die Ministerin sich teilweise persönlich über die aktuelle Lage unterrichten ließ, die mediale Begleitung gerade in den letzten Wochen einen neuen Höhepunkt erreicht und die ganze Angelegenheit Top-Priorität in der Bundeswehr hatte. Schließlich waren Leib und Leben der kämpfenden Truppen im Ausland direkt davon berührt, die Rüstungsindustrie war betroffen, die Opposition im Bundestag stellte Fragen, das Bundeswirtschaftsministerium und Teile der Bundesregierung waren involviert. Das alles wusste er nur zu gut. Schließlich verfolgte auch er die diversen Presseberichte über den wie es dort oft hieß „drohenden Skandal“. Aber er war nur ein relativ kleines Rädchen in diesem Apparat. Und hatte nicht die Ministerin höchstpersönlich in ihrer letzten Pressekonferenz in Berlin „eine schonungslose Aufklärung“ angekündigt, „um maximale Transparenz“ herzustellen. Dies hatte ihm der Abteilungsleiter damals selbst als Arbeitsauftrag mit auf den Weg gegeben: „Alles muss auf den Tisch. Die ganze Wahrheit. Ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten von wem auch immer!“ Er erinnerte sich noch genau an dessen Worte, die keinen Interpretationsraum offen ließen.
Die Tür wurde ruckartig aufgerissen: „Gräferscheidt!“
Der Abteilungsleiter saß hinter seinem Schreibtisch. Unter seiner massigen, schweren Körperfülle verschwand der Bürostuhl. Er konnte in dem nur von einer Schreibtischlampe spärlich beleuchteten Raum sehen, dass der Spitzenbeamte schwitzte. Sein teigiges, fleischiges Gesicht war von einem glänzenden Schimmer überzogen. Die wenigen rötlichblonden Haare klebten strähnig an seiner hohen Stirn. Drei Fliegen tanzten surrend im Lichtkegel.
„Hiermit teile ich Ihnen mit, dass Sie mit sofortiger Wirkung von der Projektleitung enthoben werden, bis Ende Dezember beurlaubt sind und dann zum 01.01. nach Dresden in die dortige Poststelle des IT-Amtes versetzt werden. Aufgrund der Planstellenzuweisung wird Ihre jetzige Besoldungsstufe entsprechend gekürzt. Alle bisherigen Sonderzulagen werden gestrichen. Genauso wie die mögliche Verbeamtung.“
Der Ministerialdirektor hatte ihn stehen lassen und kanzelte ihn in einem schneidenden Ton ab: „Außerdem wird ein internes Disziplinarverfahren gegen Sie eingeleitet. Verdacht auf Untreue, Vorteilsnahme. Uns sind da nämlich einige Unregelmäßigkeiten bei Ihrer extensiven Nutzung des Heimarbeitsplatzes aufgefallen. Darüber hinaus wird ein Ermittlungsverfahren wegen Landesverrat, Verletzung der Verschlusssachendirektive und Geheimnisverrat – Stichwort Weitergabe von VS-nfD Unterlagen 6 an die Presse - gegen Sie eröffnet. Weiterhin besteht der Anfangsverdacht der Fälschung von Prüfergebnissen.“
Er wollte etwas sagen, holte Luft, aber die Zunge klebte schwer in seinem trockenen Mund. Er brachte keinen Ton heraus. Stattdessen fixierte er das feiste Gesicht des Abteilungsleiters. Auf dessen verschwitzter Stirn krabbelte eine dicke Fliege.
„Da kommt ganz schön was auf Sie zu, Gräferscheidt. Sie sind eine Schande für die Bundeswehr. Und Sie haben dem Ansehen der Bundesrepublik schweren Schaden zugefügt. Sie haben sich mit Ihrem Verhalten untragbar gemacht!“
Der Abteilungsleiter starrte ihn mit wutverzerrtem Gesicht an. Das fleischige Gesicht des Mannes, welches ihm mit seinen ausgeprägten Hängebacken und den hängenden Tränensäcken amtsintern den Spitznamen „Bernhardiner“ eingebracht hatte, hatte nichts mit einem gutmütigen Hundeblick gemein. Er glich mehr einer angriffslustigen Dogge. Der Ministerialdirektor schüttelte den Kopf. Aufgescheucht flog die Fliege davon, um sich aber sofort auf einem seiner wulstigen Finger niederzulassen: „Ich gebe Ihnen einen letzten, guten Rat, junger Mann: Machen Sie keinen Aufstand. Nehmen Sie die Versetzung nach Dresden an. Fügen Sie sich. Vielleicht können wir dann noch etwas für Sie machen und Ihren persönlichen Schaden auf eine interne Untersuchung begrenzen. Sie haben doch kleine Kinder! Eventuell kann ich die Ministerin persönlich überzeugen, hier Gnade vor Recht ergehen zu lassen und von einem offiziellen Dienstverfahren gegen Sie absehen!“
Gräferscheidt schluckte. Kam aber gegen den Kloß in seinem Hals nicht an. Er dachte an Melanie. An die Zwillinge. An Weihnachten. Aber die Bilder waren seltsam eingetrübt und unscharf.
„Morgen um Punkt 08.00 Uhr räumen Sie Ihr Büro und geben Ihre Zugangs- und Ausweiskarten ab. Alle Akten, Projektunterlagen und der PC sind abzugeben. Sie verlassen spätestens um 09.00 Uhr das Gelände. Alles weitere wird Ihnen schriftlich an Ihre Privatadresse übermittelt. Bis zu Ihrem Dienstantritt in Dresden sind Sie mit sofortiger Wirkung beurlaubt!“ Die fleischige Dogge schaute ihm direkt in die Augen und bellte: „Haben Sie das verstanden, Gräferscheidt?“
Er nickte stumm. Der Boden unter seinen Füßen schwankte. Er stützte sich an der Rückenlehne des Stuhls ab, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
„Ihr Büro wird gleich versiegelt. Sie haben dort wie in allen anderen Büros auf dem Kasernengelände striktes Zutrittsverbot!“
In seinem Kopf rauschte es. Er hörte sich wie von Ferne sagen: „Ich müsste aber wenigstens noch meine Frau anrufen und meinen Mantel, die Tasche und den Autoschlüssel holen.“
„Einverstanden. Sie haben 15 Minuten Zeit. Dann schicke ich den Wachdienst vorbei. Wegtreten!“
Er stand am Fenster in seinem Büro. Schneeflocken rieselten aus dem Nachthimmel. Legten sich wie eine weiße Daunendecke auf den Hof und die Rasenflächen. Es sah alles so lieblich und friedlich aus. Aber nichts war friedlich. Es herrschte Krieg. Nicht nur in Afghanistan, Syrien, dem Irak, Somalia und Mali und wo deutsche Truppen noch überall kämpften. Sondern hier. In den warmen Amtsstuben der Wehrverwaltung. Im kleinen, beschaulichen Koblenz. Wo Rhein und Mosel zusammen fließen. Der Tourismus sich am Deutschen Eck, auf der Festung Ehrenbreitstein, am Moselwein und der Bundesgartenschau erfreut. Sein ganz persönlicher Krieg. Er sollte geopfert werden. Das war ihm nach dem Gespräch mit dem Bernhardiner klar. Er wurde hingerichtet. Geradezu zerstört.
Nach zwanzig Minuten verließ er unter den gestrengen Augen eines jungen Wachsoldaten sein Büro. Er ging über den verschneiten Hof in den gegenüberliegenden, langgezogenen Bau, wo das Gästehaus untergebracht war. Er hinterließ Spuren in der weißen, jungfräulichen Schneedecke. Hier war nichts mehr unschuldig, dachte er. Ganz im Gegenteil. Auch die Geschichte mit dem Unfall von seinem Projektmitarbeiter Raimund erschien ihm jetzt in einem ganz anderen Licht. Das konnte kein Zufall gewesen sein. Er hatte schon vor zehn Tagen, als ihn die Nachricht über den tödlichen Freizeitunfall seines Kollegen erreicht hatte, erhebliche Zweifel. Raimund war ein überlegter, umsichtiger Mensch – dazu noch sportlich. Raimund hatte ihm bei ihrem letzten Gespräch an einem der vielen einsamen Abende in dem spartanischen Gästehaus seine kritische Haltung an den bisherigen Ergebnissen ihrer internen Prüfungen deutlich gemacht. Sehr fundiert mit nachvollziehbaren Argumenten und auf einer validen Zahlen-, Daten-, Faktenbasis. Auch ihn persönlich beschlichen in den letzten Monaten immer wieder Zweifel, ob ihr Projekt der viel beschworenen Wahrheitsfindung dienen sollte oder doch eher ein Feigenblatt und reinen Aktionismus darstellte? Warum ordnete man ansonsten zwei junge Sachbearbeiter aus dem BMVg Bonn in das BAAINBw nach Koblenz ab, überträgt ihnen von heut auf morgen ohne große Vorbereitung ein Projekt mit diesen politischen und wirtschaftlichen Ausmaßen, lässt sie zwar scheinbar machen, aber bremst sie trotzdem in den entscheidenden Momenten der Recherche immer wieder aus? Einsichten in gewisse Akten wurden ihnen verweigert oder es hieß, diese Akten seien zurzeit nicht auffindbar oder im Bendlerblock in Berlin in Bearbeitung oder bereits ausgesondert oder unterlägen der Geheimhaltung oder oder oder. Die Zuarbeit von wichtigen Informationen lief immer nur äußerst stockend, war lückenhaft oder gespickt mit Widersprüchen. Die typischen, amtsinternen Verwaltungsmechanismen, wenn die deutsche Bürokratiemaschinerie etwas verhindern, auf die lange Bank schieben oder verschleiern wollte.
Er stapfte durch den Schnee zum Eingang des Gästehauses. Das kleine Foyer lag im Dunklen. Im Haus war es still. Er schien heute Abend der einzige Übernachtungsgast zu sein. In dem winzigen Zimmer – eingerichtet nur mit einem einfachen Schreibtisch, einem schmalen Bett und einen kleinen Schrank – ließ er den Rollladen herunter und knipste dann die Schreibtischlampe an.
Das Gespräch mit dem Abteilungsleiter hatte ihm schlagartig die Augen geöffnet: Zuerst wollten sie mich mit dem Ausblick auf eine beschleunigte Beamtenkarriere und ein paar Zulagen kaufen, jetzt degradieren und schieben sie mich ab und drohen mir noch dabei. Der kleine, unerfahrene Neuling aus Bonn, findet eh nichts. Und wenn doch – wie jetzt wohl geschehen – dann schieben wir ihn in die ostdeutsche Verwaltungsdiaspora ab. Briefe sortieren, Eingänge abstempeln. Und wenn er unbequem wird, setzen wir ihn unter Druck. Vernichten ihn. Es tobt ein Krieg. Ein Krieg um die Wahrheit.
Wütend lief er in dem engen Zimmer auf und ab: Den könnt ihr haben! Jetzt hab ich nichts mehr zu verlieren!
Zuerst machte er einige Telefonate, dann holte er seinen privaten Laptop aus der Tasche, verband diesen mit der externen Festplatte und fing an zu schreiben. Gegen 4.30 Uhr verließ er das Gästehaus. Er ging zu dem Gebäudekomplex, wo die Büros der Zentralabteilung untergebracht waren. Er hielt sich dabei möglichst im Schatten der Häuser, lief bewusst einige Umwege über das weiträumige Kasernenareal. Als er bei dem Gebäudekomplex G angekommen war, wartete er einige Minuten regungslos hinter einem Baum und beobachtete das langgezogene Haus. Alle Fenster waren dunkel, keinerlei Bewegung. Er ging in einem großen Bogen zum Hintereingang des Gebäudes, öffnete mit seiner Zugangskarte die Tür und schlich durch die dunklen Gänge in den zweiten Stock.
Um kurz nach 5.00 Uhr verließ er mit seinem Koffer und einer kleinen Aktentasche die Liegenschaft. Die externe Festplatte hatte er sich zur Sicherheit in die Unterhose gesteckt. An der Pforte gab er seinen Zugangsausweis bei dem wachhabenden Offizier ab. Der junge Soldat protokollierte den Austritt. „Sie müssen laut Anweisung morgen um 8.00 Uhr wieder hier sein. Das lohnt sich doch gar nicht mehr, jetzt noch zu gehen.“ gab der Wachhabende mit Blick auf die Uhr zu Bedenken. Er antworte nicht und verließ grußlos die Baracke. Beim Rausgehen hörte er, wie der Mann im Hintergrund zum Telefon griff und mit unterdrückter Stimme aufgeregt in den Hörer sprach.
Er schritt durch das Tor der Kaserne und ging über den Parkplatz zu seinem Auto. Als er seinen Wagen rückwärts ausparkte, sah er im Rückspiegel wie der Wachhabende winkend auf sein Auto zu gerannt kam. „Leck mich am Arsch.“ sagte er, gab Gas und fuhr mit auf der Schneedecke durchdrehenden Reifen in Richtung Ausfahrt.
Steffen Gräferscheidt verließ um 5.08 Uhr den Kasernenparkplatz und fuhr Richtung Bonn. Nach Hause. Zu seiner Familie.
Er hatte mit dem Kapitel abgeschlossen. Er war nun entschlossen, den Kampf aufzunehmen. Es gab kein Zurück mehr.
Um 5.11 Uhr verließ ein schwarzer Geländewagen den Parkplatz. Ebenfalls in Richtung Bonn.
Es schneite und das Thermometer zeigte unter null an.
Der Verkehrsfunk hatte um kurz nach 5.00 Uhr vor Straßenglätte und stellenweise auftretendem Blitzeis in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz gewarnt.
Die Suche im digitalen Heuhaufen oder die Unbekannte vom Märchensee
Ich sehe dich in tausend Bildern
Ich sehe dich in tausend Bildern,Maria, lieblich ausgedrückt,Doch keins von allen kann dich schildern,Wie meine Seele dich erblickt.Ich weiß nur, daß der Welt GetümmelSeitdem mir wie ein Traum verwehtUnd ein unnennbar süßer HimmelMir ewig im Gemüte steht.
Novalis (1772-1801)
Jan nahm ein Schluck Weißwein.Er überlegte fieberhaft: Was hatte er?
Vorname: Mareike. Wie auch immer geschriebenAlias: MariaNachname: Gollsing
Stimmten die Namen diesmal?
Ankunftsflughafen Stuttgart – Abflug von Leipzig, wo ihre Mutter wohnt – zumindest in der Nähe von Leipzig. Ist Leipzig beziehungsweise die Region dann auch ihr Geburtsort?
Äußerlich sah sie aus wie damals im Herbst: Die gleiche Frisur, die schwarzen Haare, gleicher Kleidungsstil, die Figur. Jan hatte bei der kurzen Begegnung keine äußerliche Veränderungen bei ihr ausmachen können.
Er stand auf, wechselte die CD, entschied sich für die „Return to Zero“ von den Spiritual Beggars7 und ging umhüllt von den rockig-sphärischen Klängen wieder zurück an seinen Schreibtisch. Während seines letzten Treffens mit Hauptkommissar Klaus Ebner im „Rien ne va plus“ hatte Jan - nachdem sie bereits einige Kölsch intus hatten - beiläufig nach Maria gefragt. Klaus hatte erzählt, dass sich die unbekannte Frau, die sich damals in Bonn Maria nannte, auf ihrem persönlichen Kriegspfad gegen die Hells Angels befand, um ihre Schwester zu rächen. Sie hatte sich in dem Hotel neben dem Mata Hari Bordell in Bad Godesberg mit dem Namen M. Pettermanns und einer Meldeadresse aus Kiel in das Meldeformular eingetragen. Die damalige Fahndungsabfrage der Polizei verlief erfolglos. Bis heute. Mit der Kombination aus Namen und Anschrift gab es keine Pettermanns. Auch nicht in der erweiterten Umgebung von Kiel. Die Personenstandsabfrage Pettermanns hatte zu viele Treffer in der Bundesrepublik ergeben, so dass eine Weiterverfolgung dieser Spur für die Polizei keinen Sinn machte. Wenn der Name überhaupt richtig war? Der Hotelangestellte hatte nur einen flüchtigen Blick auf den vorgelegten Personalausweis geworfen. Bei dem Nachnamen war er sich einigermaßen sicher, der Vorname müsste etwas mit M gewesen sein, an das Geburtsdatum oder den Ausstellungsort hatte er keine Erinnerung.
Jan schrieb auf den Zettel vor sich den Namen Pettermanns und ein M.
Hatte sie bei der Schießerei mit dem Präsidenten nicht gerufen, dass ihre Schwester Marleen hieß? Jan notierte sich Marleen. Aber wie genau geschrieben? Er überlegte. Im Hintergrund sangen die Spiritual Beggars „We are born in chaos“. Jan zündete sich eine Zigarette an. Er hatte entschieden, heute ausnahmsweise einmal in der Wohnung zu rauchen. Draußen war es ungemütlich. Nass, kalt, windig. Ein typischer Winterbeginn im Rheinland: Regen statt Schnee, wenn überhaupt grau-schwarzer Schneematsch anstatt einer weißen Flockenpracht. Allerdings hielt Väterchen Frost dieses Jahr ungewöhnlich früh Einzug ins Rheinland. Nachts fror es bereits. Außerdem war seine Aufregung und Anspannung zu groß. Endlich hatte er nach all den Monaten der nagenden Ungewissheit und der zehrenden Sehnsucht nach einem Lebenszeichen von Maria einen konkreten Ansatzpunkt für seine Suche.
Er dachte zurück an seine Treffen mit Maria in Bonn im vergangenen Herbst. Diese stürmische Zeit hatte sein Leben auf den Kopf gestellt: der Albtraum rund um seine Tochter Charlotte, die in einer seltsamen Mischung aus Abhängigkeit und Liebe, aus Gewalt und Drohungen in einem Sumpf aus Prostitution und organisierter Rockerkriminalität rund um das Bonner Charter der Hells Angels versunken war. Sein Enkelkind Jonas, als dessen Vater sich der Präsident dieser Höllenengel herausgestellt hatte. Und Maria, die auf einem Rachefeldzug für ihre jüngere Schwester gegen die Rockergang unterwegs war. Er hatte sich Hals über Kopf in diese mysteriöse Frau verliebt und dabei nicht gesehen oder besser gesagt, nicht wahrhaben wollen, dass sie ihn nur benutzt hatte, um an Informationen für ihre blutige Vergeltung zu kommen 8. Bei ihren damaligen Gesprächen war ihm aufgefallen, dass sie kaum etwas Privates, Persönliches von sich preisgegeben hatte. Sie sei in der IT-Branche beschäftigt. Sie käme aus Süddeutschland. Das war alles!
Jan schrieb beide Stichwörter auf: IT und Süddeutschland.
Er überlegte: Unter Süddeutschland versteht man im allgemeinen Bayern und Baden-Württemberg. Vielleicht noch das Saarland und Hessen. In seinem Laptop rief er Google Maps auf und zoomte auf Stuttgart. Er überlegte: Wie weit würde sie fahren, um zum oder vom Flughafen Stuttgart zu kommen? 50km? 100 km? 200 km. Bei 200km hätte sie auch von Köln-Bonn nach Leipzig fliegen können. Dann hätte sie im gleichen Flieger gesessen wie er. Bei diesem Gedanken musste Jan schmunzeln. Einen kleineren Regionalflughafen mit Direktflügen von Lufthansa nach Leipzig gab es in der Region nicht. Das südliche Bayern schied aus, dann wäre sie von München aus geflogen, ebenso Hessen wegen des Flughafens Frankfurt. Also Stuttgart. Er entschied sich für einen Radius von 120 km. Dann kämen auch Teile des Saarlandes, des südliche Rheinland-Pfalz und des nordwestlichen Bayerns als möglicher Wohnort in Frage. Baden-Württemberg nahm er komplett mit auf. Er wollte keinen Fehler machen, jetzt wo er endlich einen konkreten Hinweis hatte.
Er hatte alles beieinander. Die Suche konnte beginnen. Er rief verschiedene Internetadressbücher und soziale Netzwerke auf und gab den Namen Gollsing in Bayern, Baden-Württemberg, dem Saarland und Rheinland-Pfalz ein. 178 Treffer. Zu viele. Seine anfängliche Euphorie schlug um – Hoffnungslosigkeit machte sich breit.