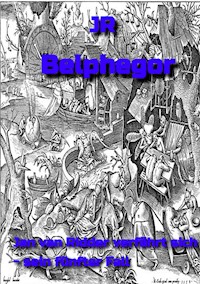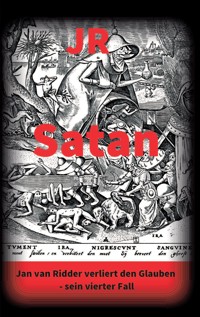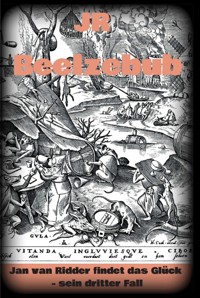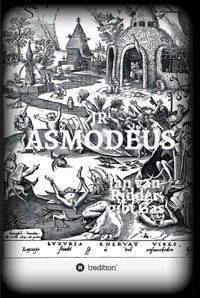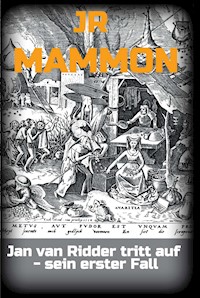
4,80 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein ungewöhnlich heißer Sommer. Deutschland ächzt unter der andauernden Hitze. In Bonn fischt die Polizei die Leiche eines IT-Referatsleiters vom Auswärtigen Amt aus dem Rhein. Kurze Zeit später findet man einen toten chinesischen Doktoranden vom Lehrstuhl für Informatik in einem Abfallcontainer. Beide mit dem gleichen Mordwerkzeug umgebracht: einer Garotte. In Berlin zieht ein Spitzenbeamter hinter den Kulissen gekonnt die Strippen und kassiert zu seinen Gunsten ab. Zumindest bis zu dem Tag, an dem er ein mysteriöses Päckchen mit einer eindeutigen Botschaft aus seiner unrühmlichen Vergangenheit erhält. Das Ermittlungsteam um den Bonner Hauptkommissar Klaus Ebner tappt im Dunkeln. Obwohl es sich offensichtlich um die gleichen Mörder und Vorgehensweise handelt, stehen die Opfer in keiner direkten Beziehung. Ebner zieht seinen alten Bekannten Jan van Ridder, den ehemaligen IT Vertriebsmanager, Spezialist für die öffentliche Verwaltung und inzwischen selbständigen Berater, hinzu. Jan deckt mit seinem unkonventionellen Vorgehen Verbindungen zwischen beiden Fällen auf. Schnell stellt er fest, dass die Morde nur die Oberfläche eines viel größeren Spiels darstellen: Es geht um Spionage, Wirtschaftsinteressen, Vergangenheitsbewältigung, um Macht und Einfluß zwischen Behörden und um sehr viel Geld. Jan wirbelt Staub auf. Seine Ermittlungen führen ihn von Bonn nach Berlin und Hamburg. Dann geschehen zwei weitere Morde. Im Hintergrund scheinen noch ganz andere Mächte zu agieren, die schließlich auch Jan persönlich bedrohen. Mit Jan van Ridder betritt eine sympathisch-authentische Figur die Ermittlungsbühne: vom Leben gezeichnet, vielschichtig, mal locker-humorvoll, mal melancholisch-nachdenklich, durch ein tragisches Unglück verwitwet, Vater einer studierenden, alleinerziehenden Tochter, die ihn früh zum stolzen Opa gemacht hat, Liebhaber deutscher Weißweine, überzeugter Rockmusikhörer, Altbaubewohner, geschichtsinteressiert und dabei immer auf der Suche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
© 2020 JR - 2. überarbeitete Auflage
(© 2014 JR – 1. Auflage)
Bildnachweis Umschlag: Pieter Bruegel d.Ä., Folge der Laster, „Der Geiz“ von 1558, Kupferstich, Sammlung Bibliothèque Royale, Cabinet Estampes, Brüssel.
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
978-3-347-04399-2 (Paperback)
978-3-347-04400-5 (Hardcover)
978-3-347-04401-2 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für die in der Publikation enthaltenen Verweise auf Links, Webseiten und sonstiger Artikel Dritter wird keine inhaltliche Haftung übernommen. Inhalte stellen lediglich deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dar.
JR
MAMMON
Jan van Ridder tritt auf – sein erster Fall
Kriminalroman
Das Buch
Ein ungewöhnlich heißer Sommer. Deutschland ächzt unter der andauernden Hitze und Trockenheit. In Bonn fischt die Polizei die Leiche eines IT-Referatsleiters vom Auswärtigen Amt aus dem Rhein. Kurze Zeit später finden sie einen toten chinesischen Doktoranden vom Lehrstuhl für Informatik in einem Abfallcontainer. Die beiden Toten wurden mit dem gleichen, eigentümlichen Mordwerkzeug umgebracht: einer Garotte.
In Berlin zieht ein Spitzenbeamter hinter den Kulissen gekonnt die Strippen und kassiert zu seinen Gunsten ab. Bis zu dem Tag, an dem er ein mysteriöses Päckchen mit einer eindeutigen Botschaft aus seiner eigenen, unrühmlichen Vergangenheit erhält.
Das Ermittlungsteam um den Bonner Hauptkommissar Klaus Ebner tappt im Dunkeln. Obwohl es sich um die gleichen Mörder und Vorgehensweisen handelt, stehen die Opfer scheinbar in keiner direkten Beziehung. Ebner zieht seinen alten Bekannten, Jan van Ridder, den ehemaligen IT-Vertriebsmanager, Spezialisten für die öffentliche Verwaltung und inzwischen selbständigen Berater, hinzu. Jan deckt mit seiner unkonventionellen Vorgehensweise und seinem InsiderWissen Verbindungen zwischen beiden Fällen auf. Er stellt fest, dass die Morde nur die Spitze eines viel größeren Komplotts darstellen: es geht um Spionage, Wirtschaftsinteressen, Vergangenheitsbewältigung, um Macht und Einfluss zwischen Behörden und um Geld. Sehr viel Geld!
Dann geschehen zwei weitere Morde. Im Hintergrund scheinen noch andere Mächte zu agieren, die schließlich auch Jan bedrohen.
Mit Jan van Ridder betritt eine sympathisch authentische Figur die Ermittlungsbühne: vom Leben gezeichnet, vielschichtig, mal lockerhumorvoll, mal melancholisch-nachdenklich, durch ein tragisches Unglück verwitwet, Vater einer studierenden Tochter, die ihn früh zum stolzen Großvater gemacht hat, überzeugter Rockmusikhörer, Altbaubewohner, Lebenskünstler, geschichtsinteressiert und immer auf der Suche.
Der Fall
Ein rasanter Thriller, der den Leser auf eine spannende und entlarvende Reise durch die Welt der Geheimdienste und Diplomatie, der deutschen Ministerialbürokratie, multinationaler IT-Konzerne und in die Sphären staatlich gelenkter Spionage und Cyber-Attacken mitnimmt. In einer Epoche, in der die bisherige Nachkriegsweltordnung umbricht und sich neu sortiert, begleitet von einer rasanten Digitalisierung, internationalen, protektionistischen Handelskriegen und einer scheinbaren Krise des Westens schmerzend nah an der Realität und von höchster Aktualität.
Dabei gespickt mit facettenreichen, psychologisch-feinsinnigen Situations- und Typenbeschreibungen aus dem deutschen Alltag. Egal, ob bei einer Witwe aus Meckenheim, einer ehrgeizigen Studentin in Bonn oder höchsten Vertretern des Beamtenapparats in Berlin, einem belesenen General von der Führungsakademie der Bundeswehr, einem investigativen Topjournalisten aus Hamburg, von konkurrierenden Geheimdienstlern bis hin zu jung-dynamischen IT-Unternehmern… das Karo des Lebens ist bunt und dabei häufig (wohltuend oder erschreckend) klein.
Der Autor
Ein aktiver Manager aus international und national führenden IT-Konzernen, langjähriger und intimer Kenner der Bundesverwaltung in Bonn und Berlin.
Anmerkung zur zweiten Auflage
Die erste Veröffentlichung von Mammon erschien im Jahr 2014 (und ist im Kopf bereits einige Jahre vorher herangereift). Sie stand damals unter dem Eindruck der Snowden-Enthüllungen rund um die weltweiten NSA-Spionageaktivitäten. In der vorliegenden, stark überarbeiteten, zweiten Auflage - über sechs Jahre später - haben viele der damaligen Beschreibungen und getroffenen Einschätzungen zu gesellschaftlichen, politischen Entwicklungen und insbesondere zu den Auswirkungen der globalen Digitalisierung und Bedrohung aus dem Cyber-Space (aus Sicht des Autors glücklicherweise) immer noch Bestand und beinhalten nach wie vor ihre Aktualität.
Nichts desto trotz habe ich mich zu einer inhaltlichen Überarbeitung entschieden. Nicht zuletzt auch, um einige Rechtschreibfehler zu eliminieren, die mir bei meinem Erstlingswerk damals im Eifer des Krimi-Gefechtes unverzeihlicher Weise durchgerutscht sind; wahrscheinlich habe ich auch jetzt noch immer nicht alle erwischt. Der Plot und der Wesenskern des Romans sind dabei unverändert geblieben. Aber auch für diejenigen LeserInnen, die die erste Veröffentlichung bereits verschlungen haben, ist es sicherlich interessant, die Ermittlungen des Falls in seiner überarbeiteten Fassung noch einmal aufzunehmen. Vielleicht entdecken Sie an der ein oder anderen Stelle eine neue Wendung.
Lieber Jan van Ridder Fan, ich wünsche Ihnen gute und spannende Unterhaltung – verbunden mit der ein oder anderen Anregung zum Nachdenken, eventuell zur eigenen Nachrecherche oder einfach „nur“ für einige unterhaltsame Stunden der Lektüre.
JR
Autoren-Webseite: https://tredition.de/autoren/jr-jr-16468/
Email: [email protected]
Mammon
Schweren Lastern wurden im Verlauf der Kirchengeschichte – insbesondere unter Papst Gregor I. (um 540 bis 604) – als sinnbildliche Warnung für die Gläubigen und Mönche bestimmte Dämonen zugeordnet. Quasi die Armee des Teufels. Unter anderem waren verantwortlich: der Satan für den Zorn, Leviathan für den Neid, Beelzebub für die Völlerei, Asmodeus für die Untugenden Raserei, Begierde, Verschwendungssucht und der Mammon für die Habgier.
„Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ (Evangelium nach Matthäus 6,24)
Das Wort Mammon leitet sich ursprünglich vom aramäischen Wort „mamona“ für Vermögen, Besitz ab. Alternativen Deutungen zufolge stammt es von dem aramäischen Wort „aman“ ab und bedeutet „das, worauf man vertraut“. Das Wort gelangte über seine griechische Schreibweise in die Bibel, in der Vulgata wird daraus lateinisch mam[m]ona. Martin Luther übersetzte das Wort nicht und so gelangte es als Mammon ins Deutsche. Daraus resultierte, dass Mamon im Volksglauben und der Literatur als personifizierter Reichtum zu einem Dämon wurde, der den Menschen zu Geiz und Habgier verführt.
Im Katholizismus gehört die Avaritia, der Geiz, die Habsucht, als zweite zu den sieben Hauptlastern, die als die Wurzeln von Todsünden betrachtet werden. Im Lukasevangelium, 12. Kapitel, Vers 15 heißt es: „[…] und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat.“
Mammon bezeichnet einen unredlich erworbenen Gewinn oder unmoralisch eingesetzten Reichtum, wenn er etwa zur lebensbestimmenden Maxime wird.
Heute wird mit dem Begriff „schnöder Mammon“ abschätzig der Drang zum Geld im Allgemeinen bezeichnet.
Prolog
Im strahlend blauen Himmel kreist hoch oben einsam ein Adler.
Darunter die endlose Weite der Steppe. In grün-braunen Farbschattierungen zieht sie sich dahin. Endlos. Soweit das Auge reicht. Hinten am Horizont die sanften Hügel. Die geschwungene Hügelkette sieht aus wie eine große, liegende, schlafende Frau. Aus den schneeweißen Jurten steigt vereinzelt Rauch auf. Feine Schlieren und Kringel im Blau, verlieren sich in der Weite. Ein gellender Pfiff erweckt die Hufe der Steppenpferde zu einem wilden Trommelreigen. Der Boden vibriert. Die Reiter treiben mit Hunden die Herde der Pferde zusammen.
Er öffnet die Augen, blinzelt in die Sonne. Über ihm das runzelige Gesicht seiner Großmutter, die ihn sacht in den Armen wiegt.
Die Großmutter summt eine vertraute Melodie. Ihr fast zahnloser Mund formt sich dabei zu lustigen Grimassen.
Die Sonne scheint ihm wärmend ins Gesicht.
Die Großmutter wiegt ihn sanft hin und her.
Der Adler kreist am Himmel.
Er schließt die Augen. Schläft wieder ein.
Er sitzt auf dem Rücken des mächtigen Adlers und fliegt zu der schlafenden Frau in den fernen Hügeln…
Im Biergarten am Rhein
Wieder schaut er auf sein altes Handy. Immer noch keine Nachricht. Die digitale Anzeige schimmerte blass: 20:33 Uhr. Wo bleibt der nur?
Sie hatten sich ursprünglich zwischen 18.30 und spätestens 19.30 Uhr verabredet. Sie wissen schon: je nachdem, ob der Flieger von Hamburg nach Köln/Bonn Verspätung hat oder nicht und dann noch der zähe Feierabendverkehr über die Autobahn nach Bonn, hatte der Mann ihm bei ihrem Telefonat wortreich dargelegt. Von wegen… nun ist es schon über eine Stunde später! Er hasst Unpünktlichkeit. Hält sie für eine unnötige, ungute Erscheinung des oberflächlichen Zeitgeistes.
„Wollen Sie noch ein Kölsch oder was anderes?“ Erschrocken fährt er aus seinen Gedanken hoch. Vor ihm steht der Kellner und schaut ihn fragend an. Typ Student, unrasiert, zerrissene Jeans, hellrot verwaschenes T-Shirt mit irgendeinem Logoaufdruck. „Ja, noch ein kleines Kölsch.“ entgegnet er abweisend.
Er hatte heute Früh auf dem Weg ins Amt mit diesem Wirtz telefoniert: es sei nun an der Zeit, sich noch mal zu treffen, um ihre Gespräche wieder aufzunehmen. Er hätte neue Informationen, könnte seine Vermutungen inzwischen belegen, mit weiteren Fakten untermauern. Die Initiative war von ihm ausgegangen. Wenn er jetzt - mit einigem zeitlichen Abstand - das Telefonat noch mal Revue passieren lässt, hatte er den Journalisten geradezu bekniet, dass der Termin heute Abend zustande komme. Wirtz hatte sich zuerst zurückhaltend geäußert. War dann aber mit dem Hinweis, dass er das Wochenende eh in Bonn bei Freunden verbringen wolle, darauf eingegangen, so dass sie sich am frühen Freitagabend treffen könnten.
Wieder lässt er das Display seines Handys aufleuchten: 20:42 Uhr. Immer noch keine Nachricht. Gloster starrt vor sich hin. Seine Stimmung schlägt um. Hatte er sich anfänglich noch auf das Gespräch gefreut und war geradezu in eine euphorische Leichtigkeit auf dem Weg vom Amt zum Treffpunkt verfallen, breitet sich nun ein dumpfes Gefühl des Zweifelns, der Verärgerung aus und legt sich wie eine muffige, schwere Decke auf sein Gemüt. „Diese verdammte Unzuverlässigkeit heut zu Tage!“ nörgelt er ungehalten vor sich hin. „Dann soll er wenigstens absagen!“ Das junge Pärchen, das ihm an den langen Bierbänken gegenübersitzt, beachtet ihn nicht. Zu sehr sind sie in inniger Umarmung mit sich selbst und ihrem hormonellen Höhenflug beschäftigt. Der alte, einsam wirkende Mann mit seinen Selbstgesprächen und seiner Bitterkeit dringt nicht in ihre Glückswelt vor. Er schüttelt den Kopf. Schaut hinaus auf den Rhein.
Konrad Wirtz arbeitete beim Reporter in Hamburg und war dort einer der alteingesessenen Journalisten im Ressort Innenpolitik. Sein Wort oder besser gesagt seine investigativen Beiträge hatten großes Gewicht. Seine Reportagen prägten nicht nur die deutsche Journalistenszene, sondern darüber hinaus auch die veröffentlichte Meinung der Bundesrepublik. Er war regelmäßiger Gast in den einschlägigen Polit-Talkshows, wo er mit scharfzüngigen Kommentaren und sezierenden Analysen den Politikbetrieb auseinandernahm. Seine Interviews mit den Spitzenpolitikern des Berliner Regierungsbetriebes glichen unerbittlichen Verhören. So manchen Skandal hatte Wirtz mit seinen hartnäckigen Recherchen aufgeklärt, Politiker zuerst mit einem medialen Sperrfeuer in die Ecke und schließlich zum Rücktritt getrieben.
Die Beiden kannten sich. Sie waren sich mehr oder weniger zufällig bei den immer wiederkehrenden Anlässen des Politik- und Ministerialverwaltungsbetriebs begegnet. Das erste Mal hatte er den Journalisten vor Jahren auf einem Botschafterempfang des Auswärtigen Amtes in Berlin getroffen. Später hatte Wirtz an einer umfangreichen Story über die Geschichte des Auswärtige Amts von den Ursprüngen im Kaiserreich bis zur Neuzeit gearbeitet und während der Recherchen mehrere Hintergrundinterviews mit ihm geführt. Er konnte sich noch gut daran erinnern: es ging um die politische Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik und damit einhergehend um die organisatorische Neuaufstellung des Amtes im Nachgang zu den Terroranschlägen des 11. September 2001. Die deutsche Außenpolitik suchte fieberhaft ihren Weg zwischen Bündnistreue und jahrzehntelangen Freundschaft zu den USA und der ablehnenden Haltung der Bundesregierung unter Kanzler Schröder gegen den propagierten Krieg der USA gegen den weltweiten Terror. Er konnte nicht verhehlen, dass er sich damals von der Anfrage des Journalisten geschmeichelt gefühlt hatte, das dieser ausgerechnet ihn, den kleinen Beamten aus der unwichtigen Außenstelle des Auswärtigen Amtes in Bonn, als Insider, als heiße Quelle zu einem solch epochalen Thema auserwählt und intensiv befragt hatte. Während der mehrtägigen Interviews hatten sie eine persönliche Nähe aufgebaut – nicht zuletzt von den Gemeinsamkeiten ihrer Biografien getragen. Danach hatten sie sich noch zweimal privat in Bonn getroffen. Zufälle des Lebens in einer mittelgroßen Stadt: bei einem Konzert auf der Museumsmeile (Deep Purple, wenn er sich richtig erinnerte) und einmal hier, im Biergarten am „Alten Zoll“. Daher hatte Wirtz auch für das heutige Treffen wieder den Biergarten am Rhein als Treffpunkt vorgeschlagen, was ihm sehr entgegen kam: bequem vom Auswärtigen Amt in einem kurzen Fußmarsch zu erreichen, aber gleichzeitig weit genug entfernt vom Ministerium, um möglichst unverdächtig zu sein. Konspirativ, aber ohne allzu große Umstände. Gerade freitags waren die meisten Kollegen im Ministerium darauf bedacht, möglichst pünktlich am frühen Nachmittag ins Wochenende zu verschwinden. Bei dem überwiegend jungen und studentischen Publikum des „Alten Zolls“ war es höchst unwahrscheinlich, auf andere Amtskollegen oder Ministerialbeamte aus den Bonner Bundesministerien zu treffen, die womöglich ihn als auch den Journalisten kannten und damit Querverbindungen erahnen konnten. Außerdem war der „Alte Zoll“ mit seiner Lage am Rhein und dem Blick auf das Siebengebirge einer der schönsten Biergärten in Bonn. Genau richtig für so einen herrlichen Sommerabend wie den heutigen. In dieser leichten, beschwingten Atmosphäre machte Bonn seinem Ruf als italienisch anmutende Stadt alle Ehre.
Aber ihm steht nicht der Sinn nach einem entspannten Abend. Und schon gar nicht nach knutschenden jungen Leuten. Er wendet seinen Blick ab. 20:55 Uhr! Immer noch keine Nachricht. Nichts! Er wählt die Nummer des Journalisten: „Hier ist die Mailbox von Konrad Wirtz. Ich bin im Moment nicht zu erreichen. Hinterlassen Sie eine Nachricht mit Ihrem Namen und Ihren Erreichbarkeiten. Ich melde mich dann umgehen bei Ihnen.“ Er legt auf. Seine Unruhe steigt. Zweifel an der Richtigkeit seines Tuns nagen an ihm. War sein Wunsch nach einem Treffen richtig? War er für den Journalisten als Insider nicht mehr interessant? Der hatte doch längst alle brisanten Infos von ihm. Was juckt den noch der Behördenklatsch von einem kleinen Beamten aus dem Maschinenraum der Bürokratie, der sich kurz vor seiner Pensionierung nochmal wichtigtun will? Er schaut auf den Rhein und beobachtet die geruhsam dahinziehenden Lastkähne. Soll ich jetzt noch länger warten oder gehen?
Um ihn herum ein munteres Kommen und Gehen, das fröhlich heiteres Stimmengewirr verfängt sich in den ausladenden Ästen der alten Bäume. Die zahlreichen Besucher genießen die milden Temperaturen des Abends. Schwalben schießen durch die Luft und vollführen bei ihrer Jagd tollkühne Flugmanöver.
Er fühlt sich unwohl. Nicht nur, dass Wirtz ihn ganz offensichtlich versetzt hat und dass er seine ganze Lage als zunehmend fragwürdig empfindet. Nein, jetzt - gerade in diesem Moment - fühlt er sich irgendwie bedrängt! Unsicher schaut er umher. Lässt seine Augen suchend über das Gewimmel der Gäste gleiten. Etwa doch Kollegen oder Bekannte, die ihn entdeckt haben?
Beobachtet fühle ich mich - ja, das trifft es besser.
Seine Augen bleiben unvermittelt an einem älteren, graumelierten Herrn hängen, der ungefähr drei Tischreihen weiter sitzt und ihn durch eine Lücke zwischen den sitzenden Menschen aufmerksam mustert. Als sich ihre Blicke für einen Sekundenbruchteil treffen, nickt der Herr ihm aufmunternd zu und lächelt dabei. Wer ist das? Ein Kollege? Nein. Irgendwoher kommt ihm das Gesicht zwar bekannt vor, aber er kann es nicht zuordnen. Er schaut weg. Trinkt missmutig sein Kölsch aus.
„Es hat keinen Sinn mehr! Ich gehe jetzt“, murmelt er vor sich hin, winkt dem Kellner zu und bestellt die Rechnung. Kaum hat er sich erhoben, drängeln sich zwei junge Frauen laut kichernd an ihm vorbei und quetschen sich eilig zwischen den Bierbänken auf den freiwerdenden Sitzplatz. Er riecht ihr billiges Parfüm - zu viel, zu aufdringlich. Die Röcke zu kurz, die Ausschnitte zu tief, alles viel zu freizügig. Er starrt gedankenverloren die beiden Frauen an. Zu lang, zu intensiv. „Hei, Du alter, geiler Bock, lass die Mädels in Ruhe.“ Ein junger Mann – zwei Köpfe größer als er – schiebt ihn rüde zur Seite und pflanzt sich gebieterisch zwischen die beiden Frauen. Er reißt den Blick los und verlässt mit schleifenden Schritten den Biergarten.
21.29 Uhr immer noch keine Nachricht. Er steht unterhalb des „Alten Zolls“ an der Rheinpromenade und blickt auf den breiten Fluss. Auf dieser Höhe der Bonner Kernstadt bildet der Rhein eine starke Strömung. Faszinierend schaut er einer leeren Flasche zu, die in Ufernähe einen skurrilen Tanz in der Strömung aufführt. Auf und ab zwischen Strudeln und in einem fortgerissen mit der unbändigen Kraft des dahinfließenden Wassers. So fühle ich mich inzwischen auch bei der ganzen Geschichte.
Nachdem er noch eine Zeit lang am Rhein gestanden und dabei einige Male nervös sein Handy kontrolliert hat – immer in der Hoffnung, dass Wirtz doch noch anrufen oder zumindest eine SMS hinterlassen würde – schlendert er langsam südwärts zurück zum Auswärtigen Amt, wo sein Auto in der Tiefgarage steht. Die Rhein-Promenade hat sich inzwischen geleert. Jetzt sind nur noch vereinzelte Fußgänger und Radfahrer unterwegs. Die Abenddämmerung taucht das gegenüberliegende Siebengebirge in ein dunkelrotes Gewand und bereitet der Burgruine des Drachenfels mit ihren ruhmreichen Heldengeschichten eine dramatisch ausgeleuchtete Bühne.
Kurz vor dem Auswärtigen Amt hält er an, nimmt noch einmal sein Handy aus dem Jackett und schaut auf das trübe schimmernde Display: 22:08 Uhr. Keine Nachrichten. Er überlegt, ob er den Journalisten noch mal anrufen soll. Ein vorbeifahrender Lastkahn auf dem Rhein hupt. Zwei Kanus rudern um ihr Leben. Er ist abgelenkt. Schaut dem langgezogenen Schiff nach. Die bunten Kanus schaukeln wie Nussschalen in der Bugwelle. Im Augenwinkel nimmt er schräg hinter sich ein kurzes, helles Aufflackern wahr. Zwei Fußgänger stehen einige Meter von ihm entfernt und geben sich Feuer für eine Zigarette.
Ich versuche es ein letztes Mal. Wenn er jetzt nicht drangeht, fahre ich nach Hause, denkt er und wendet sich erneut seinem Handy zu. Als er gerade auf Wahlwiederholung drücken will, hört er Schritte hinter sich. Jemand geht an ihm vorbei. Er dreht sich ein wenig zur Seite, um in Ruhe telefonieren zu können. Plötzlich durchzuckt ihn ein stechender Schmerz. Links unten in der Seite. Das Handy fällt aus der Hand. Er fasst sich instinktiv an die Stelle, wo sich unterhalb des Rippenbogens ein pulsierender starker Schmerz ausbreitet. Mit der anderen Hand stützt er sich an dem Ufergeländer ab. Kaltes Metall an der einen, eine heiße Flüssigkeit in der anderen Hand. Im gleichen Moment legt sich von hinten etwas Scharfkantiges um seinen Hals. Schnürt ihm mit tonnenschwerem Druck blitzschnell die Luft ab. Was um Himmelswillen, geschieht hier? Entsetzen macht sich breit. Ungläubig schaut er auf den roten Feuerball, der langsam hinter dem Petersberg versinkt. Er taumelt benommen zurück. Etwas Warmes läuft in seinen Hemdkragen. Er stürzt. Liegt auf dem Rücken. Sein Sichtfeld ist getrübt. Ein Flimmern breitet sich vor seinen Augen aus. Schemenhaft kann er zwei dunkle Gestalten wahrnehmen. Verschwommen flammt ein glutroter Punkt bedrohlich nah über seinem Gesicht auf. Eine undurchdringliche Schwärze hüllt ihn ein. Begleitet von einer absoluten Stille. Ein wärmender Impuls durchflutet ihn. Kurz, intensiv. Dann wird es kalt.
Um 22.13 Uhr ist Karsten Gloster – seines Zeichens Referatsleiter in der IT-Abteilung des Auswärtigen Amtes – tot.
Die Sonne ist hinter dem Siebengebirge untergegangen. Die Natur hat ihre farbintensive Bühne geschlossen.
Dass kurz nach halb elf sein Handy in einer Ritze der mächtigen Steinquader der Uferbefestigung des Rheins liegend im Vibrationsmodus einsam vor sich hin brummt, spielt für den Beamten Gloster nun keine Rolle mehr. „Hallo Herr Gloster. Hier Konrad Wirtz. Entschuldigen Sie bitte vielmals, dass ich mich erst jetzt bei Ihnen melde. Aber mit meinem Flug von Hamburg nach Köln ist alles drunter und drüber gegangen. Zuerst hatten wir massive Verspätung und dann haben wir mit einem technischen Defekt noch über eine Stunde auf dem Rollfeld gestanden. Zu allem Überfluss war noch mein Akku vom Handy leer. Naja, ich bin jetzt eben erst gelandet und rufe Sie aus einer Telefonzelle am Flughafen an. Also… ich gehe davon aus, dass Sie jetzt keine Lust und Zeit mehr haben sich mit mir zu treffen. Vielleicht können wir morgen im Laufe des Tages noch mal telefonieren? Ich bitte nochmals um Entschuldigung… einen schönen Abend noch… Auf Wiedersehen.“
Neulich gegen 22.30 Uhr in einem Berliner Büro
„Ja?“
Als Doktor Harald Schausten in seinem Berliner Büro den Telefonhörer abnahm, schaute er auf die große Uhr, die an der gegenüberliegenden Wand seines Schreibtisches hing: kurz nach halb 11 Uhr abends. Die Uhr war ein Geschenk seiner Abteilung zu seinem 50. Geburtstag. Er fand sie billig, geschmacklos, nicht seinem Stil entsprechend. Aber seine Frau hatte gemeint, er solle sie als Zeichen der Wertschätzung gegenüber seinen Mitarbeitern aufhängen. Nun hing sie da schon seit einigen Jahren und tickte vor sich hin. Als unerbittlicher Chronist der verrinnenden Zeit. Seiner Lebenszeit.
„Die Sache in Bonn ist erledigt“, hörte er undeutlich eine fistelige Männerstimme, “jetzt sind Sie am Zug!“
„Wie bitte? Wer ist da?“
Keine Antwort. Nichts – nur ein leises Rauschen im Hintergrund.
„Hallo…? Hallo, wie kommen Sie dazu hier anzurufen? Was ist denn los?“
Aufgelegt. Doktor Schausten hielt den Hörer in der Hand. Er war starr vor Schreck. Er merkte, wie sich ein Schweißfilm auf seiner hohen Stirn bildete. Woher verdammt noch mal kannten die seine Durchwahlnummer im Büro? Woher wussten die, dass er freitagabends, um diese Uhrzeit hier noch zu erreichen ist? Wie konnten die es überhaupt wagen, ihn entgegen aller Abmachungen direkt zu kontaktieren?
Er legte den Hörer auf. Knipste die Schreibtischlampe aus und saß eine Weile regungslos im Halbdunkel. Von den Straßenlaternen drang ein mattes Licht in sein Büro. Die obligatorische Standardausstattung der größeren Büros im Amt, eine immergrüne Zimmerpflanze, zeichnete im diffusen Licht der Straßenbeleuchtung ein bizarres Schattenspiel an die Wände. Gebannt starrte er auf die Schatten an der Wand und versuchte krampfhaft, daraus eine Art Muster oder einen Schriftzug abzulesen. Oder war es mehr eine verzerrte Figur, die ihn anschaute? Oder ihre rankenartigen Finger nach ihm ausstreckte? Wie gelähmt saß er in seinem Stuhl. Minutenlang. Alle Bewegungen erstarrten, alle Gedanken wie eingefroren. Die Zeit schien stillzustehen. Die Wanduhr tickte.
Eine entfernte Tür schlug zu. Das hallende Geräusch hallte dumpf durch den verlassenen, langen Flur. Schausten rappelte sich auf, nahm seine lederne Aktentasche, hechtete über die dunklen Flure und verließ eilig den riesigen Gebäudekomplex am Werderschen Markt durch einen der Seiteneingänge. Er verschwand mit hastigen Schritten in der Berliner Abenddämmerung.
Einer geht noch – einer geht noch rein
„Haben Sie schon gehört, Ridder? Gestern hat die Polizei Kollege Gloster tot aus dem Rhein gezogen?“ Schmidt-Vorbeck war aufgeregt. Rote Flecken hatten sich an seinem faltigen Hals gebildet. Sie leuchteten wie kleine Warndreiecke in dem schummrigen Licht des Weinlokales.
„Welchen Kollegen Gloster?“ gab Jan van Ridder leicht genervt zurück. Schmidt-Vorbeck hatte die Angewohnheit alle möglichen Leute, die er nur sehr vage persönlich kannte – manchmal hatte van Ridder auch den Eindruck gar nicht – mit „Kollege“ oder in seinen wortreichen Erzählungen nur mit dem Nachnamen, ohne jegliche weitere Anrede oder Titel zu bezeichnen. Damit hatte der unbedarfte Gesprächspartner den Eindruck, dass Schmidt-Vorbeck nahezu jeden vertraulich kannte und damit tief in der Bonner Prominenten und Polit-Szene verwurzelt war. Diese Aura war in seinem Geschäftsfeld, Kontakte herzustellen, Beziehungen im Behörden- und Firmenumfeld zu verknüpfen, von immensem Vorteil und machte einen gehörigen Anteil seines Marktwertes aus. Schmidt-Vorbeck war zu neudeutsch ein „Informationbroker“, ein „Spin Doctor“, spezialisiert auf das boomende Geschäftsfeld der Informations- und Kommunikationstechnologie, Verwaltungsmodernisierung, eGovernment, Projektsteuerung und alle möglichen Themen der digitalen Transformation in der und für die Öffentliche Verwaltung. Die öffentlichen Aufraggeber waren für viele Firmen ein nur schwer zugänglicher Markt, der mit seinen ganz eigenen Regeln, Entscheidungs- und Beschaffungsmechanismen so ganz anders funktionierte als die der Privatwirtschaft. Gleichzeitig stellte die öffentliche Verwaltung einen großen Markt dar, dessen Nachholbedarf und Rationalisierungsdruck deutlich umfassender ausfiel als in anderen Branchen. Öffentliche Auftraggeber bargen aufgrund der nach wie vor großen Beschäftigtenzahlen, relativ stabilen Finanzmittel und der Mächtigkeit und Langfristigkeit vieler Projekte ein verlockendes und lukratives Geschäftsfeld.
In diesem Umfeld waren sich Jan van Ridder und Schmidt-Vorbeck vor fünfzehn Jahren über den Weg gelaufen. Jan war dieser eigentümlich anmutende Herr über die Jahre ans Herz gewachsen. Schmidt-Vorbeck kam ihm vor wie ein Relikt aus einer anderen Zeit, ein Dinosaurier aus den Hochzeiten der vergangenen Bonner Republik: schätzungsweise Anfang 70, schlank und groß gewachsen, dunkle, grau melierte Haare, immer elegant im schwarzen Dreiteiler gekleidet, blütenweiße Hemden, tadelloses Auftreten. Sohn eines Bundestagsabgeordneten, lange Jahre Journalist zu Zeiten der Bonner Hauptstadt, zeitweise selbst als Unternehmer in den frühen Anfangsjahren der EDV erfolgreich und heute als Berater zwischen den Welten der Verwaltung, Politik und IT-Industrie unterwegs. Schmidt-Vorbeck stellte in der hektischen IT-Branche, die unter dem stetigen Druck der immer kürzer werdenden Technologiezyklen und durch die Wachstumsgier vor allem der dominierenden US-amerikanischen Konzerne in einem mörderischen Wettbewerb stand, für viele, die sich auf dem Parkett IT und Öffentliche Auftraggeber bewegten, eine Art beruhigenden Pol dar. Schmidt-Vorbeck verkörperte die personifizierte Entschleunigung. Während die jungen, erfolgsgetriebenen Firmenvertreter von Quartals- zu Quartalszielerreichung hechelten und die atemlose Kurzfristigkeit der IT-Branche mit den zähen Entscheidungsprozessen der Öffentlichen Verwaltung für sich in Einklang bringen mussten, ohne dabei zwischen den Anforderungen ihrer Unternehmen und der Langsamkeit ihrer öffentlichen Kunden zerrieben zu werden. Aufgrund seines Alters und seiner vielfältigen Betätigungen hatte er alles schon gesehen und erlebt. Oder verstand es zumindest perfekt, diesen Eindruck nach außen zu vermitteln. Seine berufliche Selbständigkeit - und Jan vermutete auch weitest gehend finanzielle Absicherung - machte ihn weniger fremdbestimmt. Obwohl sich Schmidt-Vorbeck in der IT-Welt bewegte, hatte er fast schon aufreizend wenig Ahnung von professioneller Datenverarbeitung und machte daraus auch keinen Hehl, während sich viele verzweifelt abstrampelten, um wenigstens den Anschein von Fachwissen in der immer komplexer werdenden und sich zunehmend schneller drehenden Welt der Digitalisierung vorgaukeln zu können.
Jan van Ridder hatte Schmidt-Vorbeck kennen gelernt, als er selbst noch aktives Rädchen in dem bunten Zirkus des IT-Vertriebes war. Zu einer Zeit als sich das Karussell der IT-Branche zwar immer noch in spektakulären Höhen, aber bereits mit deutlichen Unwuchten, drehte. Jan van Ridder hatte seine Laufbahn in der IT eher untypisch begonnen: er war von Hause aus Geistes- und Sozialwissenschaftler, kein Informatiker. Für ihn waren Computer Gebrauchsgegenstände, die zu funktionieren hatten. Das hingebungsvolle Schrauben und stundenlange Installieren jedes neuen und noch so kindischen Software-Gadgets bedeuteten für ihn persönlich eine nicht nachvollziehbare Zeitverschwendung. Dennoch hatte er nach seinem Studium auf Anhieb auf hohem Niveau den Einstieg in die IT geschafft. Er fing als Trainee bei dem US-Konzern Miracle an, dem damaligen globalen Marktführer im Bereich Datenbank-Software. Dort arbeitete er sich mit seiner ganz eigenen Disziplin, seiner Hartnäckigkeit, seinem Organisationstalent und vor allem seinen ausgeprägten Soft Skills über die Jahre vom Trainee über verschiedene Vertriebspositionen bis hin zum Manager hoch. Mit jedem Schritt auf der Karriereleiter hatte er für sich gelernt, trotz allem unbarmherzigen Stress und Hektik dieser eigenwilligen Branche, auch die Vorzüge seiner Vertriebstätigkeit genießen zu können: ein relativ freies, selbstbestimmtes Arbeiten, ein hohes Maß an Entscheidungsfreiräumen, interessante Kunden und Geschäftspartner, spannende Biographien der verschiedenen Kollegen, die häufig wie er als Quereinsteiger in die boomende Jobmaschine IT in den 80iger und 90iger Jahren eingetreten waren. In dieser Zeit war Jan auf den Geschmack gekommen, als junger Mann in einem der weltweiten Top IT-Unternehmen schnell Verantwortung übernehmen und Gestaltungsmacht ausüben zu können.
Um die Jahrtausendwende kam die Jobmaschine IT und die glitzernde Welt des immer höher, immer weiter, immer schneller für viele Beschäftigte in der Branche das erste Mal nachhaltig ins Stocken. Die „Jahr 2000“-Umstellungspanik 1 in Verbindung mit dem sich abzeichnenden Platzen der Internet-Blase 2 versetzte dem Beschäftigungsboom in der IT-Industrie eine deutliche Delle und katapultierte viele ehemals gutverdienende Beschäftigte in die Arbeitslosigkeit. Nicht so van Ridder. Er hatte sich frühzeitig auf die Öffentliche Verwaltung als Zielmarkt spezialisiert und beherrschte die eigentümlichen Spielregeln und Verhaltensweisen dieser Klientel von der Pike an. Er gehörte damit zu einer seltenen Spezies in diesem überhitzen und volatilen Markt. Gleichzeitig kam van Ridder zu Gute, dass er nie dem typischen Muster des normalen Vertrieblers verfallen war: viel Geld verdienen ja, aber nicht um jeden Preis der inneren Anpassung – Technikaffinität ja, aber ohne in die häufig lächerlich wirkenden Geek oder „erwachsene Männer spielen die nerdige Technik“ Nummer abzudriften. Am Ende war das Wissen über die Fachlichkeit, die Prozesse und Entscheidungsstrukturen bei den Kunden spielentscheidender. Nach seinem Einstieg und über zehn Jahre Verweildauer bei der Firma Miracle – eine Dauer, die für viele IT-Jobs zum damaligen Zeitpunkt eine Ewigkeit darstellte - erlag Jan van Ridder dem heftigen Abwerben des damals weltweit größten Softwarehaus Macrosoft. Dort baute er über fünfzehn Jahre lang sein Netzwerk im Bereich der Öffentlichen Auftraggeber aus und stieg als bald zum Vertriebsdirektor für die gesamte Bundesverwaltung auf. Mit dem großen Konzernnamen auf der Visitenkarte stieß er in höchste Sphären der Ministerialverwaltung, des Regierungsapparates und der Politik der Bundesrepublik vor. Die Vorzüge einer erfolgreichen Managerkarriere in einem internationalen Topkonzern entfalteten sich zur vollen Blüte: ein überdurchschnittlich hohes Einkommen, Boni-Ausschüttungen, Aktienpakete, Auszeichnungen, spektakuläre Incentive Reisen rund um die Welt, teure Dienstwagen, Geschäftsreisen in alle Welt, luxuriöse Firmenevents und wilde Partys, Teilnahme an Veranstaltungen mit hochrangigen Speakern aus Politik, Wirtschaft und Entertainment, Pressekontakte… ein Glamourfaktor, der Jan – bei allen regelmäßig widerkehrenden Zweifeln an seinem Tun - durchaus gefiel. So erfolgreich er im Job war, so sehr litt auf der anderen Seite sein Privatleben. Hobbys, sportliche Aktivitäten und alles, was eine Regelmäßigkeit an sozialen Kontakten erforderte, hatte er bereits früh auf dem Altar der Managerrolle und der ständigen Erreichbarkeit geopfert. Konnte er eine Zeit lang noch Familie und Beruf trotz 70-Stunden Wochen einigermaßen austarieren, gelang ihm dies auf Dauer zunehmend schlechter. Der Erfolg forderte unbarmherzig seinen Tribut.
„Na, den Kollegen Gloster vom Auswärtigen Amt.“ rief ihm Schmidt-Vorbeck im geselligen Geräuschpegel der Weinstube über den Tisch zu: „Kennen Sie den etwa nicht?“ Die Erregung ließ seine Stimme erzittern. Jan schaute stattdessen auf die Uhr: Puh, schon nach 23.00 Uhr. Er spürte den Wein. Er schmeckte der angenehmen Säure-Süße-Kombination auf der Zunge nach. Er schwitzte. Die ungewöhnliche Hitze der vergangenen Wochen hing drückend in dem niedrigen Raum. Die eng beieinandersitzenden Besucher dünsteten eine Mischung aus Schweiß, Weinseligkeit und angeduselter Geselligkeit aus. Sein T-Shirt klebte am Körper. Er versuchte eine schlagfertige Antwort, fand die passende Worte nicht, verhaspelte sich lallend. Stattdessen deutete er nur ein leichtes Kopfschütteln an. Sofort drehte sich alles.
Sie trafen sich zu einer Art Stammtisch mit einigen Kollegen aus dem Köln/Bonner Raum, die sich beruflich als Berater und Kontaktvermittler in dem Netzwerk von IT-Anbietern, Unternehmensberatungen, Öffentlichen Auftraggebern und vergleichbaren Organisationen bewegten. Waren es anfänglich noch regelmäßige Zusammenkünfte in einem recht illustren und großen Kreis alle zwei Wochen, waren die Treffen mittlerweile auf einmal im Quartal zusammengeschrumpft. Wenn er ehrlich war, war der Kreis nicht nur deutlich kleiner geworden, sondern auch schon lange nicht mehr allzu prominent besetzt. Mittlerweile glich die traurige Versammlung eher einem Club der Übriggebliebenen. Alternde, weiße Männer in ihren Fünfzigern und steil aufwärts, die von glorreichen, vergangenen Zeiten und ihren beruflichen Erfolgen schwadronierten. Wenn es hochkam, trafen sie sich seit einem Jahr vielleicht noch mit vier oder fünf Teilnehmern in wechselnden Lokalitäten in und rund um Bonn. Inhaltlich spannend oder gar gewinnbringend für das Geschäft waren diese Treffen für Jan schon lange nicht mehr, so dass auch er nur noch unregelmäßig teilnahm. Er machte es vor allem Schmidt-Vorbeck zu liebe, der sehr an diesem Ritual hing. Statt der Gesprächsinhalte war es für Jan inzwischen anstrebenswerter, auf diese Weise immer wieder neue Lokalitäten kennen zu lernen. Als Liebhaber deutscher Weißweine und eines guten Essens war dies eine willkommene kulinarische Abwechslung, die er als Selbständiger auch noch steuerlich als Werbekosten absetzen konnte. Als junger Mann hatte er diese steueroptimierenden Spesenritter-Kollegen innerlich verabscheut – heute wandelte er selbst auf diesen Pfaden. Bei dem harten Kern ihres Kreises war über die Jahre das sonst übliche zur Show gestellte „was bin ich wichtig“-Geschäftsleutegebaren gefallen, so dass die Vorzüge von Bacchus und der gepflegten Völlerei in den Vordergrund getreten waren.
Diesmal war die Runde besonders übersichtlich: er und Schmidt-Vorbeck allein. Inzwischen hatte sich die Lokalität geleert, so dass sie allein an einem Tisch in der Ecke des Weinrestaurants saßen. Schmidt-Vorbeck nestelte aus seiner Jackett-Innentasche eine zerknüllte Zeitungsseite heraus und legte sie vor van Ridder auf den Tisch. Während Schmidt-Vorbeck die Seite des Bonner General-Anzeigers glatt strich, rief er triumphierend: „Hier, hier steht es schwarz auf weiß!“ Er trommelte aufgeregt mit seinem knochigen, rechten Zeigefinger auf dem Papier. Ridder kniff angestrengt die Augen zusammen, konnte aber beim besten Willen die kleinen schwarzen Buchstaben nicht in eine logische Reihenfolge bringen. Zu sehr hatte ihm die halbtrockene Huxelrebe Spätlese, bei der sie inzwischen angelangt waren, bereits die Sinne vernebelt. Die Buchstaben verschwammen vor seinen Augen, andere tanzten lustig aus der Reihe, schlugen Purzelbäume und hüpften von der Seite…
„Am gestrigen Mittwoch fanden Spaziergänger den Leichnam eines älteren Mannes am Rheinufer auf Höhe von…“, las Schmidt-Vorbeck vor. Er schaute dabei im Wechsel auf den Zeitungsausschnitt und dann wieder über den Rand seiner Lesebrille auf Jan. „Dem Zustand der Leiche nach zu urteilen, muss der Mann bereits seit mindestens einer Woche im Wasser gelegen haben, teilte die Polizei in einer Stellungnahme mit. Der Tote ist Karsten G. aus Meckenheim. Bei den Spaziergängern handelt es sich um einen Herrn, der mit seinem Enkel und seinem Hund einen Spaziergang an der Rheinuferpromenade unternommen hatte. Der Hund hatte an der Uferböschung an einem ins Wasser ragenden Baum geschnüffelt und dann aufgeregt gebellt. Daraufhin sei sein Enkel zum Wasser gelaufen und hätte die Wasserleiche entdeckt, die sich dicht unter der Wasseroberfläche im Wurzelwerk des Baumes verfangen hatte. Die Polizei hat derzeit keine Anhaltspunkte, ob ein Verbrechen oder ein Unglück vorliegt. Da es sich bei G. um einen Bundesbeamten aus dem Bereich einer hoheitlichen Sicherheitsbehörde handelt, wird auch das Bundeskriminalamt in die Ermittlungen mit einbezogen, gab die Bonner Kriminalpolizei bekannt. Im Rhein ertrinken jährlich… und so weiter und so fort.“ Schmidt-Vorbeck schaute ihn erwartungsvoll mit gerötetem Gesicht an.
„Ja, aber woher wollen Sie denn wissen, dass es genau dieser Geester aus dem – was haben Sie noch mal gesagt - Auswärtigen Amt ist?“ fragte van Ridder. Eigentlich hatte er sich innerlich schon vor einer Stunde zum Aufbruch entschlossen und verspürte überhaupt keine Lust, den Abend mit einer weiteren, belanglosen Geschichte von diesem Schmidt-Vorbeck noch länger hinzuziehen.
„Gloster – nicht Geester!“ schrie Schmidt-Vorbeck. Dabei beugte er sich noch weiter über den Tisch. Seine kleine Brille rutschte auf der großen hakenförmigen Nase ein Stück nach vorne. „Genau das wollte ich Ihnen ja gerade erzählen.“ Er goss beiden noch mal nach, so dass auch diese Weinflasche leer war. „Als ich das heute Morgen beim Frühstück im General-Anzeiger lese, denke ich mir – Karsten G., Bundesbeamter aus Meckenheim – Sicherheitsbehörde - Bonn, das kann nur der Kollege Gloster vom Auswärtigen Amt sein. Und wissen Sie auch warum, mein lieber van Ridder? Diesen besagten Gloster habe ich nämlich genau vor einer Woche getroffen!“ Schmidt-Vorbeck schaute ihn aus weit aufgerissenen Augen an. Jan nippte an seinem Weinglas, ein wunderbarer, reichlich verzierter Römer. Er musterte sein Gegenüber: der hat doch längst genug! Die Augen rot gerändert und mit kleinen Äderchen durchzogen. Ob ich auch schon so aussehe? Und bei jedem Ausspruch dieser feine Nebel von Spucke und dieser leichte Mundgeruch – eklig. Ich muss mich mal etwas weiter zurücklehnen.
„Hallo Ridder, was sagen Sie dazu?“ blaffte ihn Schmidt-Vorbeck an. Der Mann drehte auf. Jan tauchte aus seinen Gedanken aus: „Mmh, Gloster aus dem Auswärtigen Amt, der Name sagt mir was. Den kenne ich von früher – lange, lange ist das her. Müsste zu meinen Marcosoft Zeiten gewesen sei.“
„Ridder“, unterbrach ihn Schmidt-Vorbeck, „jetzt passen Sie mal auf, alter Freund! Jetzt wird es nämlich erst richtig spannend. Ich habe mir also überlegt: den Gloster hast Du letzte Woche Mittwoch doch im „Alten Zoll“ gesehen wie er da abends mutterseelenalleine vor seinem Kölsch sitzt. Ich also bei der Polizei angerufen und denen gesagt, dass ich zu der Wasserleiche etwas sachdienliches aussagen kann. Und, Ridder, keine halbe Stunde später saß ich schon auf dem Bonner Polizeirevier und gebe meine Aussage zu Protokoll.“ verkündete Schmidt-Vorbeck mit stolz geschwellter Brust. „Und dabei hat die Polizei dann meinen Verdacht bestätigt, dass es sich bei dem Toten um Karsten Gloster, Ministerialbeamter im Auswärtigen Amt Bonn, handelt. Was sagen Sie nun?“
Auch bei Jan stellte sich zwar ein gewisses Interesse an der Geschichte ein, auf der anderen Seite forderte die Wirkung des Alkohols seine ganze Aufmerksamkeit. Ihm war leicht schwindelig. Hitzewallungen durchströmten seinen Körper. Er wurde zunehmend schläfrig. „Ja, ja, das ist ja wirklich mal interessant.“ lallte er, um Schmidt-Vorbeck zu beschäftigen. „Aber wahrscheinlich war es ein Unfall und der gute Gloster ist angesäuselt mit reichlich Kölsch im Kopf in Gevatter Rhein gestolpert. Wenn ich nicht aufpasse, werde ich heute Abend noch das gleiche Schicksal erleiden. Nur dass es bei mir nicht der Gerstensaft, sondern die köstliche Huxelrebe ist.“ Schmidt-Vorbeck angelte sich mit einer majestätisch ausholenden Armbewegung die Lesebrille von der Nase, nahm sie in die rechte Hand und fuchtelte damit wie mit einem Zeigestab vor Jan in der Luft herum. „Da habe ich aber erhebliche Zweifel, mein Lieber! Die Polizei hat so ein paar Andeutungen gemacht, die auf ein Verbrechen schließen lassen.“ entgegnete Schmidt-Vorbeck mit ernstem Gesichtsausdruck. Dabei schaute er Jan van Ridder mit seinen dunklen Augen unter den buschigen Augenbrauen durchdringend an.
Mit seiner Hakennase sieht er aus wie ein alter Uhu – richtig unheimlich. Das Bild einer überdimensional großen Eule im dunklen Anzug schob sich vor Jans eingetrübtes Blickfeld. Die Eule fixierte ihn aus orange-schwarzen, lodernden Augen, der wuchtige, gebogene Schnabel schloss und öffnete sich, dann hatte die Eule plötzlich eine Lesebrille im Gesicht. Der graue Eulen-Mann verschwand aus seinem Kopf. Stattdessen saß ihm Schmidt-Vorbeck wieder gegenüber. „Nehmen Sie mir es nicht übel, aber ich muss jetzt wirklich los.“ Jan wollte entschlossen klingen, merkte aber selbst, wie sein Lallen die Aussage eher zögerlich-stockend rüberkommen ließ. Er zückte sein Portemonnaie zum Zeichen des Aufbruchs und knallte es unkontrolliert auf den Tisch. „Ach, jetzt schon? Ich dachte wir trinken noch einen…“, warf Schmidt-Vorbeck enttäuscht ein.
Als sie sich am Eingang des alten, üppig mit Weinreben berankten Fachwerkhauses trennten, klopfte Schmidt-Vorbeck ihm verschwörerisch auf den Rücken: „Ich halte Sie auf dem Laufenden, mein Lieber. Die Polizei wird mich sicherlich noch mal hören wollen.“ Aber bitte nicht mehr heute Abend, dachte Jan und stieg leicht schwankend einige Minuten später in das vorgefahrene Taxi. Jan schaute mit vom Wein eingetrübten Blick durch die Windschutzscheibe des Taxis auf die beleuchtete Straße. Die Neonscheinwerfer des Mercedes durchschnitten laserstrahlengleich den dahingleitenden nachtschwarzen Asphaltstreifen. Unter dem Rückspiegel baumelte ein dunkelgrüner Dufttannenbaum. Jan starrte fasziniert auf den kleinen tanzenden Pappanhänger. Die hin und her schaukelnde Bewegung ließ Jans Kopfkarussell noch mehr in Fahrt kommen. Er merkte, wie ihm schummrig wurde. Er riss seinen Blick los. Jan fläzte sich in die durchgesessene Rückbank des Taxis und blickte aus dem Seitenfenster in die vorbeihuschende, nächtliche Landschaft. Die Umrisse der dahinjagenden Bäume verschwammen. Wie alles andere auch vor seinen Augen und in seinem Kopf.
Mit Mal fiel ihm ein, woher er diesen Karsten Gloster kannte. Es ging damals um einen Anlauf, ein großes Migrationsprojekt für Macrosoft im Auswärtigen Amt zu gewinnen, was aber scheiterte, da sich das Auswärtige Amt für sogenannte freie Open Source Software und gegen das proprietäre Macrosoft entschied. Das Projektbudget belief sich über die gesamte Laufzeit auf mehrere Millionen Euro und hätte damit einen hübschen Batzen an Umsatzprovisionen für ihn und seine Mitarbeiter bedeutet. „Tja, der ewige Drang zum Gelde… Mammon, wir verehren Dich. Lange ist es her, dass ich diesen Zirkus aktiv mitgemacht habe.“ brabbelte Jan und schlief mit einem zufriedenen Grinsen auf den Lippen ein.
Der Taxifahrer beobachtete seinen Gast im Rückspiegel, schüttelte den Kopf und stellte das Radio an. Er hoffte inständig, dass ihm der angesoffene Sack nicht unvermittelt auf die Lederpolster reiherte.
1 Das als Millennium- oder auch Y2K-Bug bezeichnete IT-Problem war darauf zurückzuführen, dass man in den 70/80iger Jahren, als Speicherplatz noch deutlich kostspieliger war, Jahreszahlen nur als zweistellige Angabe programmiert hatte. Mit der Jahrtausendwende wurde jedoch eine vierstellige Abbildung notwendig. Bei damals älteren Computersystemen kam hinzu, dass die interne Echtzeituhr nicht automatisch das Jahrhundert umschalten konnte, was weder vom BIOS noch von MS-DOS oder Windows 98 automatisch korrigiert wurde. Speziell IT-gesteuerte Hardwarekomponenten (so genannte embedded systems, z. B. in Alarmanlagen, Videorecordern, Werkzeugmaschinen … ) stellten Probleme dar, da die Software vom Nutzer nicht einfach umprogrammiert werden konnte. Aufgrund dieser potenziellen Risiken wurden im Vorfeld des Jahreswechsels 1999/2000 Katastrophenszenarien über weltweite Computerabstürze mit zum Teil apokalyptischen Ausmaßen vorhergesagt. Betroffen sein sollten demnach besonders sicherheitsrelevante und kritische Infrastrukturbereiche (Banken, Kraftwerke bis hin zu Atomwaffen), die durch den Y2K Bug fehlgeschaltet oder lahmgelegt würden. Als Folgen wurden viele Horrorszenarien prognostiziert: vom Verkehrschaos über einen Börsencrash und eine Weltwirtschaftskrise bis zur Fehlauslösung nuklearer Waffensysteme. Für IT-Anbieter kam es aufgrund dieser Panik zeitweise zu dem negativen Effekt, dass Investitionen in neue Software und Hardware zurückgestellt und das Geld stattdessen in (vermeidliche) Fehlerbehebungen gesteckt wurde.
2 Im März 2000 platzte an den Börsen die Spekulationsblase, die sich insbesondere durch die sogenannten Dotcom-Unternehmen der New Economy gebildet hatte. Die Dotcom-Blase war ein weltweites Phänomen. Der größte Markt für Technologieunternehmen war die US-amerikanische NASDAQ. Die Deutsche Börse richtete den Neuen Markt als eigenes Marktsegment ein, an dem zukunftsweisende Technologieunternehmen notierten. Der Absturz führte zu einer massiven Kapital- und Vermögensvernichtung an den Börsen, zu zahlreichen Firmenpleiten und Kündigungen in der IT-Industrie.
Gedünsteter Schweinekopf und sonstige in Öl frittierte Sauereien
Chen Meng kam mit drei prall gefüllten Tüten zurück und stelle alle Einkäufe in der Küche des Studentenwohnheims ab. In zwei Stunden erwartete er einige befreundete Kommilitonen aus der chinesischen Studentengemeinde Bonn zum Essen. Er musste sich beeilen. Es galt noch einiges bis dahin vorzubereiten. Er war heute am frühen Nachmittag extra mit dem Bus zum Bonner Schlachthof gefahren und hatte zwei Schweineköpfe gekauft, die er gedünstet mit reichlich Wok-Gemüse seinen Gästen heute Abend servieren wollte.
Seine Wohneinheit lag verlassen genauso wie das ganze Studentenwohnheim. Die meisten Studenten waren in den seit zwei Wochen laufenden Semesterferien ausgeflogen. Arbeiten, in der Welt umherreisen, bei den Eltern verwöhnen lassen oder was die überwiegend deutschen Kommilitonen so machten. Die fleißigsten Lerner waren sie nach seiner Beobachtung auf jeden Fall nicht. Von den sechszehn Bewohnern seines Gruppenhauses waren neben ihm nur noch zwei Studentinnen anwesend. Daher konnte er die zentrale Küche des Hauses für den heutigen Abend ungestört und komplett in Beschlag nehmen. Als er diese Abendessen früher für seine chinesischen Freunde, die ebenfalls mit ihm an der Uni Bonn studierten, ausgerichtet hatte, hatte es von der Mehrzahl der anwesenden Mitbewohner immer wieder ärgerliche Blicke und bissige Bemerkungen über den Geruch, dass Sich-Selbstverständliche-Breit-Machen in der einzigen Küche gegeben. Einmal waren diese unterschwelligen Feindseligkeiten eskaliert, indem offensichtlich angetrunkene Studenten in die Küche geplatzt waren und ihren Kreis mit ausländerfeindlichen Parolen angepöbelt hatten. Zwei diesen Störer trugen schwarze T-Shirts mit rechtsradikalen Aufdrucken. Das hatte ihn nachhaltig verstört; war seine Wahrnehmung von Deutschland doch die eines ansonsten friedlichen und kultivierten Landes.
Für den heutigen Abend hatte Chen Meng daher beide Studentinnen vorher um Erlaubnis gefragt, ob er die Küche belegen dürfe. Sie hatten sehr nett reagiert und ihm viel Spaß mit seinen Freunden gewünscht. Wenn er sich richtig erinnerte, hatte ihm eine von den beiden erzählt, dass sie eh nicht da sei, sondern für das Wochenende bei ihrem Freund in Köln.
Chen Meng war Doktorand der Informatik an der Universität Bonn und lag in den letzten Zügen seiner Doktorarbeit. Er hoffte, dass er in einem halben Jahr mit allen Prüfungen fertig werden würde. Nebenher arbeitete er seit zwei Jahren in einer kleinen IT-Firma, was ihm zwar gutes Geld einbrachte, aber neben seiner Promotion auch recht zeitintensiv war, so dass er diesen Sommer in den Semesterferien nicht nach Hause zu seinen Eltern und Verwandten nach China fahren konnte. Wenn er ehrlich war, hatte er sich inzwischen mit dem freieren, liberaleren Leben und dessen Vorzügen hier in Deutschland derart angefreundet, dass er sich nicht wirklich danach sehnte, die langen Semesterferien bei seiner chinesischen Großfamilie zu verbringen. Die Wucht der starren Traditionen und übermächtigen Rituale gaben ihm ein ungutes Gefühl der Einengung und Gängelung. Außerdem wollte er die drängenden Befragungen der Staatssicherheit umgehen, die alle Heimkehrer regelmäßig zu Befragungen vorlud. Die Vielfalt der Möglichkeiten, die ihm in Deutschland zur Verfügung standen, verwirrten ihn auf der einen Seite, aber faszinierten ihn auch zugleich: er konnte lesen, was er wollte, sowohl in Zeitungen, Büchern wie auch dem Internet. Zuhause undenkbar. Die staatliche Überwachung und Zensur war überall und nutzte dabei zunehmend die neuen Möglichkeiten der digitalen Kontrolle. Von Upload-Filtern, automatisierten Mitprotokollierungen bis hin zu KI-basierten social scoring und digitalen engmaschigen Datenerhebungen und -speicherung aller Art über das Verhalten ihrer Bürger. Im deutschen Fernsehen und Internet dagegen gab es eine Fülle an Informationen, die sich auch – soweit er es mit seinen Deutschkenntnissen verstand – kritisch mit der herrschenden Politik auseinandersetzen. Im Kino gab es alle neuen Filme, an der Universität ein weit gefächertes Angebot, Presse- und Meinungsfreiheit waren von der Verfassung geschützte Bürgerrechte. Besonders angetan war er von den zahlreichen Vorlesungen mit ihren offenen Diskursen über die europäische Ideengeschichte, die Aufklärung, die politischen Theorien – all das war nicht zu vergleichen mit der ständigen Bevormundung zu Hause und dem allgegenwärtigen, übermächtigen Staatsapparat.
Nichts desto trotz vermisste er seine Eltern.
Nachdem Chen allerlei Gemüse kleingeschnitten hatte, setzte er den Wok auf den Herd und goss reichlich Sonnenblumenöl hinein. Als er sich gerade zum Kühlschrank bückte, um die chinesischen Gewürzpasten seiner Oma heraus zu holen, hörte er Schritte hinter sich. Bin ich etwa so spät dran? Chen richtete sich auf und sah zwei fremde Männer. Er hatte die Beiden hier noch nie gesehen. Sie sahen nicht nach Studenten aus. Er nickte ihnen freundlich zu. Die suchen wohl jemanden aus dem Haus, dachte er. Es kam öfter vor, dass in den relativ großen Wohneinheiten Verwandte oder Freunde auftauchten und sich nach Bewohnern erkundigten.
„Chen Meng?“ hörte er einen der Männer seinen Namen sagen.
„Ja, das bin ich.“ entgegnete er.
Einer der Männer kam mit großen Schritten auf ihn zu. Chen Meng wich instinktiv zurück, so dass er mit dem Rücken an den Herd stieß. Plötzlich sah er etwas silbrig-metallisches in der Hand des Unbekannten aufblitzen. Chen griff mit der linken Hand zu dem Stil des Wok, hob ihn von der heißen Herdplatte und hielt ihn vor sich. Eine Art Reflex, da er den Eindruck hatte, es sei besser, etwas zwischen sich und diesem fremden Mann zu haben. Als der Arm des Mannes mit der silbernen Klinge nach vorne schnellte, riss Chen Meng den Wok hoch und schleuderte ihn in das Gesicht des Fremden. Gleichzeitig spürte er einen stechenden Schnitt in seiner Seite. Das Stiletto des Angreifers hatte ihn erwischt. Durch seine ruckartige Bewegung war die Stichwaffe allerdings erst an dem Wok entlang geratscht und hatte ihn seitlich, aber nur mit deutlich abgeschwächter Kraft erwischt. Eine langgezogene Fleischwunde klaffte unter seinem zerschlitzten Hemd. Ein intensiver Schmerz durchflutete seinen Bauch. Chen Meng sackte benommen auf die Knie. Er hörte wie sich das siedend heiße Öl knisternd und zischend im Gesicht des Angreifers verteilte, der wie ein Tier schmerzverzerrt aufschrie und sich die Hände vor die Augen hielt. Chen Meng war am Boden auf allen Vieren. Er war völlig verstört. Was ging hier vor sich? Ein Überfall? Wieder so ausländerfeindliche Spinner? Mit einem Mal wurde er mit einem gewaltigen Ruck nach hinten gerissen. Eine messerscharfe Drahtschlinge legte sich von hinten um seinen Hals und zog sich ruckartig zu. Panisch versuchte Chen Meng, um sich zu schlagen, verlor aber schnell das Bewusstsein. Das letzte was er noch hörte, war das Stöhnen und Wimmern des Mannes, dem er das heiße Öl ins Gesicht geschüttet hatte.
Sekunden später durchtrennte die Drahtschlinge die Luft- und Speiseröhre von Chen Meng. Er verendete röchelnd und blutspuckend auf dem Fußboden der Studentenküche - beobachtet von den zwei leer vor sich hinstarrenden Schweineköpfen, die oben auf der Küchenplatte lagen. Man konnte fast den Eindruck bekommen, dass die Schnauzen der beiden Schweineköpfe unter ihren plattgeklopften Rüsselnasen ein höhnisches Grinsen umspielten.
Maden im Bioabfall
Die Sonne stand im Zenit. Die Himmelsscheibe schien regelrecht zu glühen. Hatte sich das Thermometer in den letzten Wochen im Rheinland konstant bei 36 Grad eingependelt, trieb die Hitze das Quecksilber heute auf über 40 Grad.
„Scheiße, was ist das denn für eine Schmiere hier?“ fluchte Ebner lautstark. Er hob seinen rechten Fuß und sah, dass er mit seinem Schuh in einer breiigen Masse stand, die lange, klebrige Fäden an der Sohle zog.
„Der Hausmeister hat sich übergeben als er die Leiche in dem großen Bio-Abfallcontainer gefunden hat.“ teilte ihm sein Kollege Peter Michalke mit.
„Aha!“ erwiderte Klaus Ebner genervt und machte einen großen Schritt zur Seite. Jetzt nahm er in einer Schwade den typisch säuerlichen Gallegeruch wahr, der sich in der Mittagshitze ausbreitete. Sie standen unter dem Fenster der Küche des Studentenwohnheimes vor einem großen, grünen Biomüllcontainer. Myriaden von dicken, schwarzen Fliegen schwirrten umher und erfüllten den Ort mit ihrem Brummen. In dem Unterstand für Fahrräder und Mülltonnen unterhalb der Wohnheimküche stand die Luft. In der katakombenartigen Betonnische war es besonders stickig und heiß. Hier musste es hier an die gefühlten 50 Grad sein. Aus den Mülltonnen roch es streng in den diversen Duftnoten der Verwesung von Essensresten und sonstigem vor sich hin gammelnden Abfällen. Auf der Stirn des Hauptkommissars bildeten sich Schweißperlen. „Was haben wir bis jetzt?“ fragte er seinen Mitarbeiter, Peter Michalke, der als erster am Tatort eingetroffen war. Er hatte den Bereich bereits mit einer anderen Kollegin, deren Name Ebner nicht kannte, mit den obligatorischen rot-weißen Plastikbändern abgesperrt.
„Der Notruf des Hausmeisters des Studentenwohnheimes ist um 13.05 Uhr bei uns in der Zentrale eingegangen. Wir waren gerade in der Gegend und sind um 13.30 Uhr eingetroffen und haben ein erstes Gespräch mit dem Hausmeister geführt. Er wurde laut eigener Aussage am Vormittag gegen 10.40 Uhr von einer der Reinigungsdamen per Haustelefon davon in Kenntnis gesetzt, dass sich in der Küche des Wohnblocks C eine große Lache einer dunkelroten Flüssigkeit auf dem Fußboden befinde, die nach ihrer Meinung wie eingetrocknetes Blut aussähe. Da der Hausmeister gerade mit einer Reparaturarbeit an der zentralen Heizungsanlage beschäftigt war und es immer wieder im Nachgang von Parties in den Wohnheimen und besonders den Gemeinschaftsküchen zu käme – ich zitierte: „Schweinereien der ekelhaftesten Art“ - hat er den Anruf zunächst - ich zitierte wieder: „nicht als übermäßig dringlich“ angesehen. Er hat die Dame von der Reinigungstruppe angewiesen, vorerst andere Bereiche des Blocks zu reinigen und mit der Küche zu warten bis er später dazu käme.“
„Halt mal. Heißt das, dass die Herren und Damen Studenten hier Putzfrauen haben?“ fragte Ebner verständnislos.
„Ja, aber nur in den Wohnblocks mit jeweiligen Gemeinschaftsküchen und –bädern. Und auch nur die und die Flure werden geputzt, die einzelnen Zimmer nicht.“ klärte Michalke ihn auf. „In diesen Blöcken hier gibt es jeweils acht Zimmer auf zwei Stockwerken und eine Gemeinschaftsküche am Ende des Ganges“ - dabei zeigte Michalke schräg über sich nach oben auf das große offene Fenster der Küche unter dem sie standen – „und auf jedem Stockwerk am anderen Ende oben und unten jeweils einen Dusch- und Toiletten-Gemeinschaftsraum. Das Ganze wird nach Frauen und Männern getrennt – in der Regel im unteren Stockwerk die männlichen Studenten und oben dann die weiblichen…“
„Ist gut, Peter“, unterbrach Ebner ihn in seinen monotonen Ausführungen, „mach erst mal weiter mit dem, was hier nun Sache ist.“
„Um 11.10 Uhr hat unser Hausmeister einen erneuten Anruf auf seinem Handy von der Putzkolonne erhalten. Sie seien nun mit diesem Wohnblock fertig und würden gerne die Küche reinigen. Wenn er jetzt nicht käme, kämen sie mit ihrem gesamten Putzplan für den restlichen Tag in Verzug. Daraufhin ist er dann gegen 11.15 Uhr hier eingetroffen und hat sich die Küche angeschaut. Ihm sei - so hat er vorhin berichtet – gleich klar gewesen, dass es sich bei dem Fleck um Blut handeln müsse.“
„So, so, scheint ja ein ganz schlauer zu sein unser Hausmeister.“ murmelte der Bonner Hauptkommissar spöttisch. „Wie heißt er denn eigentlich?“
Peter Michalke schaute in seine Notizen: „Franz Altner, 55 Jahre alt und seit 25 Jahren hier im Studentenwohnheim Hausmeister.“
„Gut und weiter?“
„Nachdem Altner die Lache auf dem Küchenfußboden näher inspiziert hatte, hat er die Putzkolonne vorerst in den nächsten Block geschickt. Er hat sich dann noch weiter in der Küche umgeschaut, aber seiner Meinung nach nichts Auffälliges festgestellt. Außer, dass das große Fenster offenstand. Was aber nach seinem Bekunden öfter vorkommt, da in vielen Küchen neben der Geruchsentwicklung durch das Kochen vor allem auch viel geraucht und daher von den Studenten über Nacht oder dann von dem Reinigungspersonal vormittags während der Hausreinigung gelüftet wird. Danach hat er die Küche mit seinem Zentralschlüssel abgeschlossen und hat sich im Haus umgeschaut - dort aber nach eigenem Bekunden auch nichts Zitat „verdächtiges“ wahrgenommen. Er hat bei den einzelnen Zimmern geklopft, um zu schauen, ob jemanden etwas aufgefallen wäre beziehungsweise ob jemand die Verschmutzung in der Küche erklären könne. Aber Fehlanzeige, da er keinen der Bewohner angetroffen hat. Er ist dann zurück in sein Büro gegangen, da er einen Anruf auf seinem Handy bekommen hat, dass in einem anderen Haus, der Abfluss einer Toilette verstopft sei und das Bad schon unter Wasser stünde.“
„Wie viel Uhr war das? Da fehlt ja von Viertel nach 11 noch einiges bis zu seinem Anruf um 13.00 Uhr!“
„Daran kann er sich nicht mehr erinnern.“ antwortete Michalke. „Aber wart’s ab, es geht ja noch weiter. Er habe sich sofort zu dem anderen Wohnblock auf gemacht, um die drohende Überschwemmung zu verhindern. Nachdem er dort das Wasser abgestellt, die Verstopfung beseitig und die Putzkolonne telefonisch dorthin beordertet habe, sei ihm wieder – O-Ton: „der Blutfleck in Block C“ eingefallen. Daraufhin ist er wieder quer von Haus J, das mit der Überschwemmung, durch die Wohnheimanlage zurück zu Haus C gegangen. Dort angekommen, habe er sich erneut in der Küche umgeschaut und dann auf dem Fensterbrett des offenen Fensters erst einmal eine geraucht, um – wie er sagte – nach der ganzen Aufregung zur Ruhe zu kommen. Als er die Kippe nach unten schnipsen wollte, habe er gesehen, dass der Biocontainer nicht an ihrem Platz an der Wand neben den anderen Mülltonnen stand, sondern schräg unter dem Küchenfenster. Er sei dann aus dem Haus zu den Tonnen gegangen und wollte den grünen Biocontainer wieder in die richtige Position schieben. Dabei sei ihm aufgefallen wie ungewöhnlich schwer die Tonne sei und habe daraufhin den schwenkbaren Deckel aufgeschoben und hineingeschaut. Naja, und dabei hat er dann direkt unserer Leiche hier ins Gesicht geblickt und sich daraufhin übergeben müssen. Kann ich ihm nicht verdenken. Ist auch wirklich kein schöner Anblick.“ schloss Michalke seinen Lagebericht ab.
Ebner nickte: „Danke Dir, Peter. Wo ist dieser Altner jetzt?“
„Er ist oben mit Kollegin Fei in der Küche. Sie nimmt weitere Angaben von ihm zu Protokoll.“
„Und… wissen wir schon was zu dem Toten?“
„Nach den Angaben des Hausmeisters handelt es sich um Chen Meng, einem Studenten beziehungsweisen Doktoranden aus China, der laut Belegungsplan hier in diesem Gruppenhaus wohnt.“
Ebner näherte sich bedächtig dem Großbehälter für Biomüll. Während der Schilderungen von seinem Mitarbeiter hatte er bereits die Umgebung unter Augenschein genommen. Er hatte sich trotz der ganzen Dienstjahre nicht im Entferntesten an diese Augenblicke des Todes in seinen unterschiedlichsten Darstellungsformen gewöhnt. Er hätte sie trotz aller Routine am liebsten vermieden, um sich vor den seelischen Verheerungen zu schützen, die diese erschütternden Bilder der menschlichen Vernichtung in seinem tiefsten Inneren immer wieder hervorriefen. Aber dies war ein wichtiger Teil seines Jobs, sich einen unverstellten Eindruck des Tatortes und der dazugehörigen Leichen, ihrer Lage, ihres wie er es nannte „Ausdruckes“ und sonstiger Umgebungseindrücke zu verschaffen. Gerade der ungekünstelte, freie Blick auf die harte Realität des Tatortes mit all seinen speziellen Details waren oft entscheidende Mosaiksteine, die später wie in einem Puzzle das Geschehene rekonstruieren ließen. Trotz aller kriminalistischer HighTech-Entwicklungen bei der Spurensuche, der Forensik, der Pathologie, der Kriminaltechnik, DNA-Analysen, Einsatz von IT und anderer Disziplinen der modernen polizeilichen Arbeit, war sein ganz persönlicher Blick verbunden mit den situativen Empfindungen für das Gesamtbild häufig bei den weiteren Ermittlungen spielentscheidend. Er trat an den großen Container, der bis auf Höhe seiner Brust reichte. Auf dem grünen, dreckverschmierten Rand bemerkte er Bewegungen. Maden. Unzählige kleine, hellbraune Maden krabbelten an den Rändern des Containers. Langsam blickte er über den Rand. Noch bevor seine Augen ein Bild aufnehmen und an sein Gehirn zur Verarbeitung weiterleiten konnten, nahm seine Nase den intensiven – leicht süßlichen – Verwesungsgeruch wahr. Es verschlug ihm den Atem. Kurz drehte er den Kopf zur Seite, holte tief Luft, sammelte sich und schaute dann erneut in den Container. Der Tod sah ihn aus einem jungen, unschuldigen Gesicht an. Umgeben von Bioabfällen. Schwarz-gelbliche Bananenschalen lagen wie ein Kranz um den Kopf. Das rechte Ohr war von einer halben, bräunlich-grünen Avocado verdeckt. Eine zermatschte und von Schimmel überzogene Gurke lag auf der rechten Schulter. Daneben gekräuselte, welke Salatblätter. Ein Stielleben alter, flämischer Meister – nur im Stadium der fortgeschrittenen Verwesung. Kein Wunder bei dieser Hitze, dachte er. Unnatürlich zusammengekrümmt lag die Leiche in ihrem modernden Bett aus Abfall. Ebner speicherte in seinem Kopf die visuellen Informationen ab: männlich, asiatischer Typ, hellblaues Poloshirt, jung, schmales Gesicht, glatte Haut, keinerlei Bartwuchs, pechschwarzes, kurzes Haar, die Augen geschlossen… Was war das? Unter den Augenlidern bewegte sich etwas. Er schaute näher hin. Am rechten Auge hatten an den Rändern der Augenlieder mehrere Maden bereits ihren Fraß durch das dort weichere Fleisch begonnen und waren offensichtlich in die Augenhöhle eingedrungen. Der Mund des Toten war leicht geöffnet, so dass man eine Reihe Zähne sehen konnte. Allesamt gelblich. In der Mundhöhle, an und in den Lippen nahm er ebenfalls Bewegungen wahr. Sein Blick ging tiefer und blieb an der Halspartie hängen. „Wenn es denn in der Küche das Blut von diesem jungen Mann war, dann haben wir hier die Ursache.“ dachte Ebner. Der Hals war kaum zu erkennen, da die gesamte Partie über und über mit Blut besudelt war, welches bereits angetrocknet war und alles dunkelrot eingefärbt hatte. Der Hals war auf der Höhe des Kehlkopfes von einem Kranz aus Maden befallen. Dort war das Gewimmel am Stärksten. Die Leiche hatte sich mit einer pulsierenden, lebenden Halskette geschmückt. Das Polohemd war halsabwärts mit Blut durchtränkt, so dass die hellblaue Farbe des T-Shirts kaum noch zu erkennen war. Der Rest des Körpers lag wie abgeknickt in dem Container. Zwischen den Bioabfällen konnte der Kommissar eine dunkelblaue Jeans erkennen. Und der Tote war barfuß. Klaus Ebner nahm das entsetzliche Bild in sich auf. Asche zu Asche, Staub zu Staub, aus der Erde kommen wir, in die Erde gehen wir zurück, schoss es ihm durch den Kopf. Allerdings sehr deutsch, feinsäuberlich getrennt nach Biomüll. Ökologisch korrekt kompostiert.
Der Hauptkommissar hatte fürs erste genug gesehen und wandte sich wieder an seinen Mitarbeiter: „Hast Du den Spurendienst und das übliche Programm… “
„Jawohl, habe ich bereits verständigt, Chef. Müssten auch gleich hier sein. Noch zwei Mann Verstärkung. Ich denke, es gibt noch einige Befragungen durchzuführen.“
„Gut“, antwortete Ebner, „ich geh ins Haus und schaue mich dort um. Vielleicht finden wir schon was.“