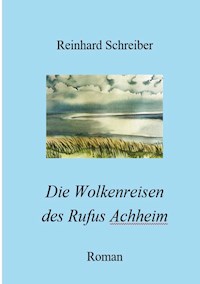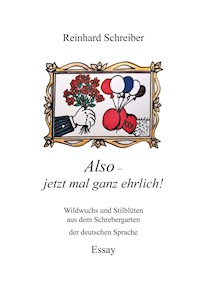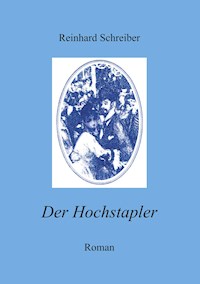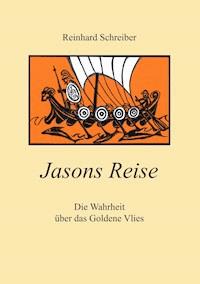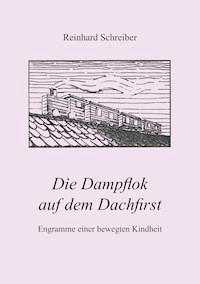3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1824 begegnen sich in Weimar überraschend der Weltreisende Zacharias Taurinius und der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe. Die beiden Protagonisten sind historische Persönlichkeiten, das Treffen jedoch ist Fiktion. Was beide verbindet, ist das Jahr 1786, in dem Taurinius eine Wanderung von Kapstadt nach Kairo begonnen und Goethe von Karlsbad aus eine Reise durch Italien nach Sizilien angetreten hatte. Während die Berichte über seine Afrika-Reise ihrem Autor heftige Anfeindungen gelehrter Rezensenten eintragen, wird dem Verfasser der Italienischen Reise höchste Anerkennung entgegengebracht. Die wichtigste Nebenrolle besetzt dabei der engste Mitarbeiter und spätere Nachlassverwalter Goethes, Johann Peter Eckermann. Dieser erhält vom Geheimrat den Auftrag, Nachforschungen zur Person des wunderlichen Fremden anzustellen. Dabei werden außer dem beharrlich behaupteten Plagiat-Vorwurf des Theologen Professor Heinrich Paulus auch eine Reihe positiver Beurteilungen einiger Zeitgenossen recherchiert, wie die des Universalgelehrten Immanuel Kant, des Experimentators Karl Gottfried Hagen, des Erzählers Achim von Arnim und des Kupferstechers Carl Heinrich Rahl. Angesichts dieser Erkenntnisse weicht Goethes anfängliche Skepsis einer aufrichtigen Anerkennung der Lebensleistung seines geheimnisvollen Besuchers, den er aber zu seinem Bedauern zu Lebzeiten nicht mehr zu Gesicht bekommt. Eckermanns Tagebuchnotizen, Briefwechsel und Protokolle gehen auf tragische Weise verloren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 64
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
2001
Der Biedermeier-Sekretär
2002
Das Leben des Zacharias Taurinius
Eckermann trifft Goethe
1823
Der geheimnisvolle Besucher
1824
Die Reiseberichte
1825
Verleger und Kritiker
1826
Zeitzeugen
1827
Des Geheimrats Sinneswandel
1828
Begegnung an der Fürstengruft
1832
2004
Der große Brand
2013
Der Nachlass
Anhang
Mein besonderer Dank gilt Herrn Alexander Gregorius für die freundliche Unterstützung bei der Lösung von EDV-technischen Problemen, die mit der Herstellung dieses Buchs verbunden waren.
R.S.
2001
Der Biedermeier-Sekretär
Es ist ein milder beschaulicher Herbstnachmittag. Ein duftig-blauer Himmel ruht hoch über kupferroten Baumkronen. Kaum merklich zieht ein frischer Lufthauch durch die Straßen von Weimar, in denen reges und dennoch fast lautloses Treiben herrscht. Bisweilen dringt gedämpftes Lachen aus den Straßen-Cafés der Altstadt – man genießt allenthalben den Goldenen Oktober.
Wilhelm Sartorius, Studiendirektor a.D., schlendert gemächlich durch die Altstadt. Die Hände halten, im Rücken verschränkt, einen eleganten Flanierstock aus poliertem Mahagoni mit Silberknauf, den er von seinem Vater geerbt hat und eher aus Gewohnheit mit sich führt, als dass er ihn jemals wirklich benutzt hätte. Wenn das Wetter dazu einlädt, führen seine Spazierwege vorbei an den historischen Gebäuden und Stätten, die im 18. und 19. Jahrhundert ihre große Zeit gehabt hatten. Im vergangenen Jahr war er in den Ruhestand getreten, nachdem er vier Jahrzehnte lang die Fächer Deutsch, Geschichte und Geografie am Wilhelm-Ernst-Gymnasium unterrichtet hatte, das man vor zehn Jahren im Zuge der deutschen Wiedervereinigung in Goethe-Gymnasium umbenannt hat.
Gegenüber der klassizistischen Fassade des Hoftheaters macht er bisweilen am Steinsockel Rast, auf dem die Bronzefiguren von Goethe und Schiller stehen und in weite Fernen blicken. Er schaut eine Weile zu den beiden Dichterfürsten empor und hebt, bevor er weitergeht, die Hand leicht wie zum Gruß. Über den Frauenplan mit Goethes Wohnhaus wendet er sich zum Stadtschloss und kommt mitunter am Hotel Elephant vorbei, wo sich der Geheimrat einst mit seinen Freunden zu einer Art literarischem Stammtisch zu treffen pflegte. Ein anderer Spazierweg führt ihn am Roten, Gelben und Grünen Schloss vorbei, und an Tagen wie diesem besucht er auch schon mal das Gartenhaus im Park an der Ilm, das Goethe bewohnt hatte, bevor er das Haus am Frauenplan bezog.
Wenn das Wetter weniger zum Bummeln einlädt, besucht er die ehrwürdige Bibliothek der Herzogin Anna Amalia, um dort in alten Schriften oder Büchern etwas nachzulesen, oder auch nur, um das großartige Ambiente der historischen Räume zu genießen. Wenn es nicht schon zu spät am Tag ist, beendet er seine Runde nie, ohne bei einem der Trödler in den schmalen Gassen der Innenstadt vorbeizuschauen. Dort sieht er sich nach kleineren Objekten aus den Anfängen des 19. Jahrhunderts um und hat im Laufe der Zeit schon allerlei Figuren und Gefäße aus Meissener Porzellan, Leuchter aus Zinn, Messing oder Silber, edel gestaltete Gemmen und so manche alte Münze erstanden.
Wenn er früher solch ein Fundstück mit nach Hause brachte, schlug seine Frau jedes Mal mit verzweifeltem Augenaufschlag die Hände über dem Kopf zusammen. Dabei beklagte sie lauthals die künftige Mühsal beim Staubwischen, obwohl all diese Stücke in einer Vitrine aufbewahrt wurden und somit weitgehend vor Staub geschützt waren. Als ihr Mann vor einiger Zeit voller Stolz eine Miniatur mit einer Marktszene in Öl anschleppte, die eindeutig mit C. Spitzweg signiert war, wich ihr Widerstand sprachloser Resignation und sie tolerierte fortan kommentarlos dieses Steckenpferd des Gatten.
Heute schaut Wilhelm Sartorius bei Georg Buchwaldt herein, einem älteren Trödler in der Marktstraße, den er bereits seit vielen Jahren kennt und mit dem er ab und zu ein Schwätzchen hält. Dieses Mal sind zwar keine Neuzugänge an Antiquitäten zu begutachten, aber der alte Herr berichtet, er habe im Magazin, wie er sein Lager im Hinterhof nennt, ein Möbelstück wiederentdeckt, das er schon fast vergessen hatte. Er geht mit Sartorius über den Innenhof zu einer Scheune, die früher wohl als Remise gedient hatte, öffnet das große Tor und knipst eine schwache Pendellampe an. Aus einer dunklen Ecke holt er ein schlichtes Stehpult ans Licht und erklärt, sein Vater habe ihm ein paar Mal erzählt, der Urgroßvater habe dieses nach Mitte des 19. Jahrhunderts bei einer Haushaltsauflösung in ebendieser Straße erworben. Es sei zwar nur aus Fichtenholz, aber solide gearbeitet und gut erhalten. Er könne ihm auch, da sich nie ein Kunde dafür gefunden habe, einen guten Preis machen.
Sartorius sieht sich das gute Stück, das zweifellos aus der Biedermeier-Zeit stammt, gründlich an und findet außer kleineren Gebrauchsspuren nichts, was ernstlich zu beanstanden wäre. Als er das Möbelstück leicht kippt, um den Unterboden zu inspizieren, ist im Fach unter der schrägen Schreibfläche ein leises Rollen und Klappern zu hören. Zum Schloss an der Vorderseite fehlt allerdings der Schlüssel, wie der Trödler mit Bedauern anmerkt, aber er wisse einen alten Schlossermeister, der sich mit antiken Verriegelungen gut auskenne.
In der Hoffnung, im Inneren des Sekretärs vielleicht noch ein paar kleinere Objekte aus der Biedermeier-Epoche vorzufinden, schätzt Sartorius kurz die mögliche Reaktion seiner Gattin ein und wird schließlich mit Buchwaldt handelseinig. Am folgenden Tag liefert der Trödler das Stehpult auf einer Karre an und teilt mit, er habe dem Schlosser bereits Bescheid gegeben. Als die zierliche Antiquität nach reiflicher Überlegung dann im Wohnzimmer neben dem Fenster einen würdigen Platz gefunden hat, bleibt Frau Sartorius stumm und straft den Neuling durch Nichtbeachtung.
Tags darauf erscheint der bestellte Handwerker mit einem guten Dutzend alter Schlüssel, die an einem eisernen Ring hängen, besieht zunächst unter leichtem Kopfwiegen das Schlüsselloch und beginnt dann, ein paar seiner antiken Mitbringsel auszuprobieren. Beim fünften ist ein leises Knacken zu vernehmen – und wie von Zauberhand lässt sich der Deckel vom Fach darunter hochheben. Sartorius dankt dem Sesam-öffne-dich-Magier überschwänglich, erteilt ihm den Auftrag, einen Schlüssel mit passendem Bart anzufertigen, und entlohnt ihn mit einem angemessenen Honorar.
Dann macht er sich daran, den Inhalt des Sekretärs zu inspizieren. Die tags zuvor beim Kippen wahrgenommenen Geräusche rühren von allerlei Schreibutensilien. Er findet ein paar alte Federkiele und einige Stahlfedern mit Halterung, ein kleines Messer zum Anspitzen der Kiele und zum Wegschaben von Schreibfehlern, ein verkorktes Glasgefäß mit vertrockneter Tinte, eine Dose mit feinem Streusand zum Löschen und ein paar leere Bögen von Büttenpapier.
Ganz hinten aus dem Fach holt er ein verschnürtes Aktenbündel mit der Aufschrift Taurinius hervor und ein Büchlein, dessen Pappdeckeleinband mit braun-marmoriertem Leimpapier kaschiert ist. Er schlägt es auf und findet als erstes den Kupferstich mit dem Porträt eines Mannes in Form eines ovalen Medaillons und darunter in schwungvollem Schriftzug den Namen Z. Taurinius. Am unteren Bildrand erkennt er ein winziges Rahl fecit, was wohl die Signatur des Kupferstechers ist. Auf der Seite gegenüber ist – gleichfalls in Kupfer gestochen – als kalligrafisches Frontispiz der Titel des Büchleins zu lesen mit folgendem Wortlaut:
Lebensgeschichte und Beschreibung der Reisen
durch Asien, Afrika und Amerika
des Zacharias Taurinius, eines gebornen Ägyptiers.
Nebst einer Vertheidigung gegen die
wider ihn in verschiedenen gelehrten Zeitungen
gemachten Ausfälle, vorzüglich in Rücksicht der unter
dem Nahmen Damberger von ihm herausgegebenen
Landreise durch Afrika.
Leipzig
in Joachims literarischen Magazin.
Sartorius blättert voller Neugier weiter und findet als nächstes einen kurzen Vorbericht, in dem ein offenbar damit beauftragter Dritter als Inhalt dieses Buchs eine ausführliche Neubearbeitung früherer Reiseberichte ankündigt. Des Weiteren weist er auf eine Rechtfertigung des Autors gegenüber irgendwelchen Kritikern im Anhang hin. Ein paar kunstvolle Schachtelsätze lassen eine nicht ganz einfache Lektüre befürchten. Unterzeichnet ist dieses ungewöhnliche Vorwort aber nicht namentlich, sondern anonym mit Der Bearbeiter und datiert mit Prag, am 20. May 1803.
Diese verwunderliche Präambel macht Sartorius ebenso stutzig wie gespannt. Er beschränkt sich aber bewusst darauf, nur noch die nachfolgende Inhaltsübersicht zu überfliegen, die in zwei Abteilungen gegliedert ist: einen Ersten Theil mit sieben und einen Zweyten Theil