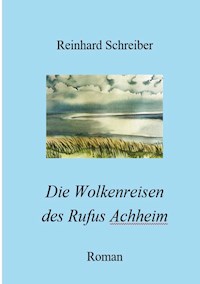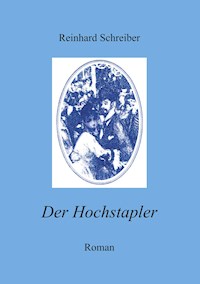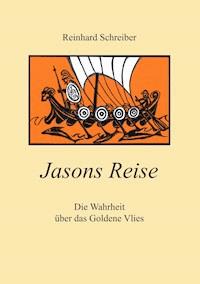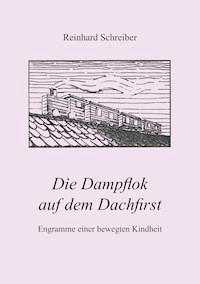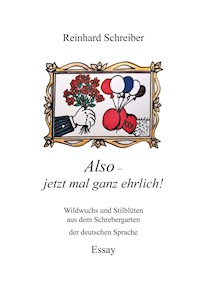
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jede Sprache ist in Folge einer Durchdringung von Völkern ent-standen und hat im Laufe der Geschichte ihre Eigenarten entwickelt. Der Prozess der Übernahme von fremden Begriffen wird nie abgeschlossen sein, ist jedoch mit der zunehmenden Verfügbarkeit kommunikativer Medien rasant fortgeschritten. Die Sorge, dass spezifische Charakteristika der eigenen Sprachkultur dabei verloren gehen könnten, ist berechtigt und fordert uns zur kritischen Wachsamkeit heraus. Anliegen dieses Essays ist es, eingefahrene Floskeln, seltsame Kunstwörter und missverständliche Fremdbegriffe unter die Lupe zu nehmen und ihren gewollten Sinn oder oberflächlichen Unsinn zu hinterfragen. Das Spektrum der ausgewählten Beispiele reicht von der Sprache der Jugend der Achtziger Jahre über das Vokabular der etablierten Yuppies bis hin zum Small talking und den modisch-smarten Anglizismen der Gegenwart, die über die Medien - und hier vor allem über die sozialen Netzwerke - ein breites Publikum erreichen. Vorsorglicher Hinweis für habituelle Skeptiker und notorische Be-denkenträger unter den Lesern: Mehr feuchter Humor als trockene Materie - es darf gelacht werden!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 50
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Wandlungen der Sprache und ihrer Worthülsen
Die wort- und wertschöpfende Macht von
Yuppies
und Politikern
Die
vernetzte
Sprache
Buchhaltérisch
– sprachliches Glanzlicht der Administration
Zeugnisdeutsch – der Geheimcode der Personalbeurteilung
Die smarte Kommunikation von
Small-talkern
und notorischen Wortführern
Das Unwort des Jahres
Die diametrale Botschaft positivierter
un-
Wörter
Humor – Spagat zwischen Wortwitz und Wahnwitz
Der
Dschornalist
Wetterleuchten der Schülersprache
Von der Würde des Wortes
Die Macht der Umgangssprache
Mein besonderer Dank gilt Herrn Alexander Gregorius für die freundliche Unterstützung bei der Lösung von EDV-technischen Problemen, die mit der Herstellung des Buchs verbunden waren.
R.S.
Wandlungen der Sprache und ihrer Worthülsen
Gegen Ende der Siebzigerjahre des vorigen Jahrhunderts entwickelte die Generation der Heranwachsenden eine eigene Sprachkultur, deren Vokabular sich auf Schlagworte und kurze Sätze beschränkte und beim Gegenüber eine rasche Assoziationsfähigkeit voraussetzte.
Eines der bekanntesten Produkte dieser Bewegung waren die sog. Sponti-Sprüche – ein Kunstwort der Jugendszene, deren Druckwerke nach anfänglicher Irritation zunehmend auch das Interesse der etablierten Gesellschaft weckten (Sponti-Sprüche,No. 1–4, Eichborn, Frankfurt a.M.: 1 – 1981: Ich geh kaputt – gehst du mit? 2 – 1982: Es wird Zeit, dass wir lieben. 3 – 1983: Nimm’s leicht, nimm mich! 4 – 1984: Ohne Dings kein Bums).
Die Ursache dieser wachsenden Wahrnehmung lag vermutlich darin, dass die Werbefachleute von Industrie, Touristik und Politik die lockere Eingängigkeit dieser Sprüche erkannten, die von Meinungsbildnern der Presse sogar zur Neuen Jugend-Lyrik hochstilisiert wurden. Dabei nahm man wohlwollend zur Kenntnis, dass deren Protagonisten, die Spontis, anderen Szenegruppen wie Punkern, Poppern und Teds zwar nahestanden, sich aber von diesen bewusst abgrenzten. Derartigen Gruppierungen gegenüber war die etablierte Gesellschaft zunächst mit skeptischem Argwohn auf Distanz geblieben, nutzte dann aber zunehmend deren Sprache, um sie – vor allem auch wegen ihrer zahlreichen Sympathisanten – für die Zielgruppe der jungen Konsumenten, Touristen und Wähler nutzbar zu machen.
Die Anfänge dieser neuen sprachschöpferischen Stilrichtung wurden in den frühen Achtzigerjahren von Claus Peter Müller-Thurau, einem gelernten Philologen und Psychotherapeuten, frühzeitig wahrgenommen und in einer höchst amüsanten Publikation analysiert (Lass uns mal ’ne Schnecke angraben – Sprache und Sprüche der Jugendszene, Goldmann München, 1983). Sein Anliegen war es, bei der älteren Generation Verständnis für das Lebensgefühl der jüngeren zu wecken und ihr quasi mit einem Lexikon der Jugendsprache als Übersetzungshilfe sowie mit einer Auflistung von Sponti-Sprüchen eine Annäherung an deren Denkweise zu ermöglichen.
Dabei ging es ihm nicht nur um Befindlichkeiten der Jugendlichen wie Easy going, Cool bleiben oder Null Bock, sondern auch um Trouble mit dem Gesülze der Alten und ähnlich provokante Redewendungen. Wenn seinerzeit also der Sohnemann auf einem heißen Ofen durch die Pampas bretterte, eine scharfe Tussi anbaggerte und sich mit ihr beim Itaker am Eck eine Mafia-Torte reinzog, dann hieß das für die Alten, dass er mit dem von ihnen gesponserten Kleinmotorrad durch die Gegend fuhr, um dann mit der neuen Freundin im nahe gelegenen italienischen Restaurant eine Pizza zu verspeisen.
Doch damit nicht genug: Ein Jahr darauf prangerte der gleiche Autor in einem weiteren Sachbuch die kopflastigen Leerformeln der Erwachsenensprache an: Über die Köpfe hinweg – Sprache und Sprüche der Etablierten (Econ Düsseldorf, 1984, Goldmann München, 1986). Er stellt darin fest, dass der Elterngeneration das spontane >aus dem Bauch heraus< der Jugendsprache weitestgehend fehlt. Dazu führt er die gängigen Redewendungen derer gnadenlos vor, die das öffentliche Sagen haben, und macht uns bewusst, dass diese Worthülsen – ganz gleich, ob sie aus Pappmachée, Plastik oder Edelstahl bestehen – im Inneren hohl sind, ohne dass es jeder gleich merkt.
Der Leser nimmt die lockere Vermittlung dieser Botschaften nicht nur mit großem Vergnügen wahr, sondern ertappt sich bisweilen auch selbst als leichtfertigen Täter, der dann ebenso reu- wie demütig Asche auf sein Haupt streuen darf. Zur Erwartungshaltung gegenüber einem zeitgemäßen Gespräch in der Kneipe erfahren wir unter anderem, dass dabei an einer psychosozialen Kontaktstelle beim Austausch im Hier und Jetzt das Bedürfnis nach sozialer Interaktion, vermehrter emotionaler Zufuhr und Abbau eines Beachtungsdefizits im Vordergrund steht.
In unserem kollektiven Bewusstsein sind historische Erinnerungen an die unblutige Sprachrevolution der jungen Generation vor annähernd vierzig Jahren mittlerweile stark verblasst. Dies hat seinen Grund sicher auch darin, dass beachtliche Anteile der damaligen Sprache der Jugend sich inzwischen in unseren Alltag eingenistet und demzufolge im Laufe der Jahre auch Eingang in die heilige Bibel unseres Sprachschatzes gefunden haben: den Duden.
Seit ihren Anfängen bis zum heutigen Tag wurden immer wieder kostenlose Anleihen bei klassischen Sponti-Sprüchen gemacht, ohne dass die öffentliche Wahrnehmung sie zum Plagiat stempelte. Solche stillen Übernahmen reichten vom Namen der Rock-Gruppe Die Toten Hosen, 1982 von Frontmann Campino gegründet, bis hin zum Filmtitel des Kultstreifen von Marcus H. Rosenmüller:Wer früher stirbt, ist länger tot, der 2006 in den Kinos anlief.
In den letzten drei Jahrzehnten hat sich ein neuer Sprachstil etabliert, der zum einen geprägt ist von den verbalen Konstrukten einer elitären Leitungsebene, in der redegewandte Manager business gestalten wollen, und zum anderen durch das Vokabular von Mitarbeitern der Unternehmensbasis, deren Kommunikation zunehmend in Anglizismen stattfindet – oder dem, was sie dafür halten.
Was sich genau hinter diesen linguistischen Fremdkörpern verbirgt, ist nicht immer auf Anhieb erkennbar. Eines aber scheint – gottlob! – festzustehen: Deutsche Wortschöpfungen haben gegenwärtig immer noch bessere Chancen, irgendwann in den Duden aufgenommen zu werden, als die inflationären angloamerikanischen Wort-Chimären – vermutlich aber nicht mehr lange.
Den hilflosen Opfern solcher willkürlich etablierter Code-Wörter aller Couleurs wäre vermutlich ein umfassendes Nachschlagewerk für Neologismen höchst willkommen, dessen Glossar allerdings engmaschig aktualisiert und revidiert werden müsste. Diese Marktlücke wurde im letzten Jahrhundert angesichts ihrer Brisanz vielleicht wahrgenommen, jedoch nicht gefüllt. Aber es begann, in den Köpfen zu rumoren, und es wird wohl nur noch eine Frage der Zeit sein, bis dieser Gärungsprozess anfängt, Blasen zu schlagen.
Die wort- und wertschöpfende Macht von Yuppies und Politikern
Im Laufe der Achtzigerjahre etablierte sich auch hierzulande die soziale Gruppierung der young urban professionals, kurz Yuppies